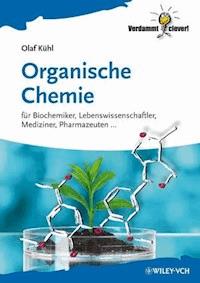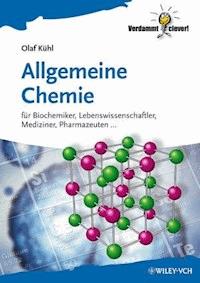9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Der Reiseleiter Konrad Mauser gerät ahnungslos in das Getriebe einer Geheimdienstaktion in Berlin. Die CIA hält ihn für den Mörder eines russischen Überläufers, was ihn zum Untertauchen zwingt. Als Konrads bester Freund Pawel – gebürtiger Pole, Nietzsche-Spezialist und eher nur mit einem Bein im Leben stehend, nichts von Konrad hört, macht er sich auf die Suche. Dabei lernt er die siebzehnjährige Jana kennen, die in ihm einen romantischen Helden sieht und den gemeinsamen Nachforschungen Schwung verleiht. Beide ahnen nicht, dass sie im Visier der CIA stehen, die in einer Abhöraktion aber nur das Drama von Pawels erkaltender Ehe beleuchtet und deshalb umso misstrauischer wird. Als eine erneute Obduktion den Mord zum natürlichen Tod umqualifiziert, zeigt auch der Geheimdienst Spaltungserscheinungen: Der junge Agent Cowley argwöhnt, dass ein politisches Attentat vertuscht wird – und ermittelt auf eigene Faust weiter. Olaf Kühls glänzender literarischer Politthriller erzählt, wie eine kleine Fehldeutung der CIA das Leben mehrerer Menschen in Berlin auf den Kopf stellt – mit unabsehbaren Folgen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Olaf Kühl
Letztes Spiel Berlin
Roman
Über dieses Buch
Der Reiseleiter Konrad Mauser gerät ahnungslos in das Getriebe einer Geheimdienstaktion in Berlin. Die CIA hält ihn für den Mörder eines russischen Überläufers, was ihn zum Untertauchen zwingt. Als Konrads bester Freund Pawel – gebürtiger Pole, Nietzsche-Spezialist und eher nur mit einem Bein im Leben stehend – nichts von Konrad hört, macht er sich auf die Suche. Dabei lernt er die siebzehnjährige Jana kennen, die in ihm einen romantischen Helden sieht und den gemeinsamen Nachforschungen Schwung verleiht. Beide ahnen nicht, dass sie im Visier der CIA stehen, die in einer Abhöraktion aber nur das Drama von Pawels erkaltender Ehe beleuchtet und deshalb umso misstrauischer wird. Als eine erneute Obduktion den Mord zum natürlichen Tod umqualifiziert, zeigt auch der Geheimdienst Spaltungserscheinungen: Der junge Agent Cowley argwöhnt, dass ein politisches Attentat vertuscht wird – und ermittelt auf eigene Faust weiter.
Olaf Kühls glänzender literarischer Politthriller erzählt, wie eine kleine Fehldeutung der CIA das Leben mehrerer Menschen in Berlin auf den Kopf stellt – mit unabsehbaren Folgen.
Vita
Olaf Kühl, 1955 geboren, studierte Slawistik, Osteuropäische Geschichte und Zeitgeschichte an der Freien Universität Berlin und ist vor allem als Übersetzer aus dem Polnischen und Russischen bekannt. 2005 wurde er mit dem Karl-Dedecius-Preis für sein polnisch-deutsches Übersetzungswerk ausgezeichnet. Seit 1996 ist er Russlandreferent des Regierenden Bürgermeisters von Berlin. 2011 erschien Olaf Kühls Debütroman «Tote Tiere».
Inhaltsübersicht
«Deine Hände riechen nach Blut», sagte meine Frau und schob mich weg.
Ich führte meine Finger unauffällig an den Mund. Kuppen. Haut. Meine Haut. Nichts Fremdes.
Morgens. Im Bett.
Ich durfte jetzt nicht voreilig nachfragen. Mir keine Blöße geben. Möglicherweise hatte sie das in einem übertragenen Sinn gemeint. Sie würde dann nur wieder denken, dass ich als Pole überfordert bin. Von der Denk- und Ausdrucksweise dieses großen weiblichen Körpers an meiner Seite, einer Deutschen. Ich – das Kind. Der Pole. Überfordert vom deutschen Geist. Will ja nur spielen. Nicht erwachsen werden. Ich weiß, was sie denkt.
Wie ein Kleinkind hungerte ich nach ihrem Blick, den zwei lebendigen Augen. In guten Zeiten gab dieser Blick mir das Gefühl, ein vollwertiger Mensch zu sein. Ernst genommen zu werden. In schlechten Zeiten vermochte er mich auszuhungern. Die Therapeutin, strafend, hart, abgewandt. Du willst mich nicht verstehen, sagte der zur Wand gerichtete Blick.
«Bzdura!», rief ich, verletzt vom Verdacht wie von ihrer erotischen Zurückweisung, spürte aber auch sofort wieder dieses verdammte Schuldgefühl. Sie schaffte es noch jedes Mal. Wieder war ich das kleine Kind im weiß gestrichenen, einschüchternden Wartezimmer des Zahnarztes in einem Vorort von Warschau und nahm mit bebenden Nasenflügeln wahr, dass da irgendetwas roch. Als ich entdeckt hatte, dass ich draußen in Hundedreck getreten war, musste ich so tun, als wäre nichts. Meine Mutter hätte mich umgebracht. Sie konnte sich den Arzt nur mit Mühe leisten.
Sekunden später stand ich vor dem Badezimmerspiegel. Zeigefinger auf der Oberlippe. Ein Hauch von Metall, vielleicht. Wenn ich meinen Geruchssinn anstrengte. Eine ferne Erinnerung der Haut – an abgewetzte Türklinke, Kupfermünze …
Oder die Pistole.
Ich erschrak selbst vor dem Lächeln, das auf meinen Lippen aufplatzte. Sollte sie meckern. Ich stand vor dem Badezimmerspiegel und wusch mir die Hände.
Der im Spiegel grinste.
Und wenn es ihr Blut ist? Die wäscht ihre Hände doch in Unschuld, sagte der Ungepflegte. Ich ertappte mich, wie ich ihm die Worte von den Lippen ablas und sie nachsprach: Von der lässt du dich einschüchtern?
«Vo’em?», fragte ich, die schäumende Zahnbürste im Mund.
Von dieser Deutschen.
«Immerhin ist sie meine Frau», gab ich zu bedenken. Und gurgelte.
Unschuld gibt es nicht, sagte er. Sie hoffen auf unser Vergessen.
Ich stellte die Bürste in den Keramikbecher, beugte mich dicht zum Spiegel und sah diesem Gesicht nachdenklich in die Augen. Der da war zurückgedriftet in seine eigene Welt.
Zurück ins Bett ging ich nicht. Vermutlich lag Frieda sowieso schon auf dem Fußboden und machte Yoga. Ich wusste, wie sie reagiert, wenn ich die Tür auch nur einen Spalt weit aufmache und einen Blick hineinwerfe. Selbst wenn es nur wäre, um tschüs zu sagen. Ich zog mich an.
In der Küche öffnete ich das Doppelfenster. Ein frischer Frühlingstag. Über den Hof redete jemand laut Arabisch, ein Mann im langen weißen Gewand, der auf dem Balkon im dritten Stock telefonierte. Mich faszinierte die Ungehemmtheit, mit der er seine widerspenstigen, fremden Kehllaute in die Berliner Luft stieß, sodass alle Nachbarn zum Mithören gezwungen waren. Kurz darauf trat eine kleine, verschleierte Person zu ihm. Das dunkelblaue Tuch reichte ihr bis auf die Brust. Sie stand klein und schwarz da und hörte reglos zu. Der Mann brüllte jetzt ins Handy. Er regte sich über irgendwas sehr auf. Ich wandte mich der bunten Blechbüchse mit dem Kaffee zu, das Pulver roch wie brauner Tropentabak an meinen Fingern, als ich drei Löffel in den Papierfilter gab. Bewegungslos stand ich da, lauschte der wilden Rede draußen und wartete, dass das Wasser sprudelte. Das dauerte mir zu lange. Als der Automatikschalter knackte, hatte ich meine Jacke schon übergezogen, dann schlug ich die Wohnungstür zu.
Die Straße war dunkler als der Hof, sie lag im Schatten der hohen Backsteinmauer gegenüber. Mehr als ein Jahr lang war ich an dieser Mauer vorbeigeschlichen, ohne zu wissen, was sich hinter ihr verbirgt. Wohl nicht einmal den Kopf habe ich gehoben, um sie in ihrer ganzen Höhe wahrzunehmen. Eine Mauer wie ein Meer, das viel zu gewaltig ist, um in seinem ganzen Ausmaß wahrgenommen zu werden. Immer bog ich rasch nach links ab, steckte höchstens den Kopf in Alis Wettspielhölle und eilte zur nächsten Kreuzung, wo das Menschengewimmel mich erlöste.
Diese Kirche war mir, auch nachdem ich sie als solche erkannt hatte, lange fremd und unzugänglich geblieben. Berlins Gotteshäuser sind meist verschlossen. Ich hatte es gar nicht erst versucht. An einem Heiligabend wagte ich mich das erste Mal dort hinein. Ohne Frieda. An den Worten des Priesters erkannte ich, dass er Pole war. Ich beichtete zum ersten Mal seit dreißig Jahren. Er fragte nicht nach meiner letzten Kommunion.
«Montag, 11:03 Uhr. Der Pole verlässt das Haus. Dunkle Jeans, schwarze Lederjacke, Leatherboots. Immer die gleiche Aufmachung. So was haben sie bei uns in den Sechzigern getragen. Ich kenn das aus Filmen von den Vietnam-Demonstrationen. Easy Rider. Ziemlich verspätet hier angekommen, oder es ist das Einzige, was ihm von seiner Vergangenheit geblieben ist. Vielleicht hat er auch nicht mehr Auswahl im Schrank. Vielleicht hat er da sogar noch den alten Hochzeitsanzug hängen. Sahnebonbonhell, mit unsauberer Bügelfalte. Manche Leute werfen so was nie weg. Stinkt nach Mottenpulver, stört sie nicht. Leute erstarren in ihrem Outfit wie Krebse im Gehäuse. Du weißt nicht mal, ob sie da selbst noch drin sind. U5 Richtung Osten, da siehst du solche DDR-Beaus mit langem, gewelltem Haar. Kleiderpuppen ihrer selbst.
Jetzt bleibt er vor der Spielhölle stehen, wirft einen Blick durch die Tür, hebt die Hand, ruft hinein, ein unrasierter Türke kommt raus, der ihn offenbar kennt, nicht zu verstehen, was sie sagen. Dann geht er weiter.
Ecke Turmstraße wird er verlangsamt vom Strom der Menschen und Automobile. So wie jemand, der durch die Dünen ans Meer tritt. Dabei ist die Kreuzung hier eher Tümpel als Meer. Für Berlin aber offenbar schon Großstadt genug. Denk ich an Chicago … Zwischen dem türkischen Händler an der linken und dem Bioladen an der rechten Ecke bleibt er stehen und lässt alles an sich vorbeifluten, nach der trügerischen Ruhe dort oben in der Wohnung. Die Ampel schaltet auf Rot.»
Niemand wusste genau, woher der Gesichtslose seinen Spitznamen hatte. Der Grund jedoch ist offensichtlich: der schreckliche Brandunfall vor vielen Jahren, von dem Kollegen sagten, er habe sein ganzes Leben verändert. Die Flammen hatten die Gesichtshaut geschädigt. Die Augen waren unversehrt geblieben, doch betrug die Sehkraft seines rechten Auges ohnehin nur noch einen Bruchteil der früheren Stärke. Sein Kopfhaar soll nur noch eine Matte von kleinen, verklumpten Kügelchen gewesen sein. Verbrennungen dritten Grades vernarben wulstig. Sie sollen am meisten zu der Verunstaltung beigetragen haben. An den weniger betroffenen Flächen löste sich, wie es hieß, lappenweise die Haut vom Gesicht.
Faceless. Inzwischen war er sogar ein bisschen stolz darauf. Er hielt das Blatt vor seine kurzsichtigen Augen und drehte es ins silbrige Tageslicht. Viel war es nicht, denn das Grundstück war von hohen Pappeln überschattet. Das Fenster des Büros ging auf eine vierspurige Allee im Süden Berlins, mit baumbestandenem Mittelstreifen. In beiden Richtungen zogen Autokarosserien vorüber. Auf der Wiese zwischen Haus und Allee zitterte das noch junge Laub im Wind. Der Gesichtslose dachte an die Straße, an der sein Haus in Amerika gestanden hatte. Die Bäume dort waren kleiner.
Aber mich kann nichts mehr überraschen – er hob das Blatt und ließ es bei diesem Satz gleich wieder sinken. Als er vor einigen Wochen die ersten Berichte dieses jungen Kerls auf den Tisch bekommen hatte, war er perplex gewesen. Der war neu in Berlin und schrieb ganze Romane statt der üblichen knappen Observationen: «Objekt bewegt sich zur Kreuzung Turmstraße, verharrt, geht nach rechts. Setzt sich in einen Dönergrill.» Nein, stattdessen bekam er nun seit Tagen Cowleys Ergüsse:
Es ist, als kokettierte er mit sich selbst, jeden Morgen. Noch nie habe ich gesehen, dass er das Haus zusammen mit seiner Frau verlassen hätte.
Der Pole wendet sich nach rechts in Richtung Gotzkowsky-Straße, setzt die ersten paar Schritte neugierig und energisch wie ein junger Hund, fällt aber sofort zurück in sein übliches Schlendern. Dazu das für ihn typische Schulterzucken. Er verlangsamt den Gang. Spielt Gleichgültigkeit.
«Wer sagt’s denn?!», grinste der Gesichtslose. «Von Hunden lernen.»
Hoppala, hab ich’s eilig?, schien das Schulterzucken zu sagen. Schon geht sein Blick auf meine Straßenseite. Ich drehte rasch den Kopf weg, auch wenn es unwahrscheinlich war, dass er mich im Gedränge der schwarzen Kopftücher und bunten Röcke wahrnehmen würde. Sehen vielleicht, wahrnehmen nicht.
Er lernt es nicht, fluchte der Gesichtslose. In einem Observationsbericht hat das Ich nichts zu suchen. Denjenigen, der da beobachtet, darf es nicht geben. Es darf keinen Körper geben, der zuschaut. Keinen Mann, der sich ärgert, weil er die Spur verloren hat. Der gerade seinen Job verflucht, weil er in ausgelatschten Halbschuhen an der Bordsteinkante umgeknickt ist, um einer Horde Halbstarker auszuweichen. Denn wenn es ihn gäbe, diesen Mann, dann bestünde die Gefahr, dass man von irgendeiner Kleinigkeit der Beschreibung auf ihn schließen, ihm auf die Fährte kommen könnte. Das muss dieser Kerl endlich kapieren.
Auf der Turmstraße schiebt es sich hoch und runter, zum Eingang der U-Bahn. Die Stromstraße rüber liegt dieses Amt, das für Hunderttausende von Migranten zuständig war, passenderweise heißt es Landesamt für Gesundheit und Soziales. Vor drei Jahren sollen sich davor große Mengen von Menschen gesammelt haben. Jetzt ist alles aufgesogen, über die Stadt verteilt. Man sieht nur noch Reste. Junge Männer in der Grünanlage, die scheinbar unschlüssig dastehen, ein paar Schritte auf und ab tun, warten. Man müsste ihnen länger zuschauen, um den Sinn ihrer Bewegungen zu enträtseln. Wer steckt wem was zu. Das ist nicht einfach. Sie merken blitzschnell, wenn ein Fremder den Schritt verlangsamt oder den Kopf zu ihnen wendet. Sie wittern das. Noch sind sie nicht lange genug hier, um frech zu werden, sind noch unsicher, was sie sich herausnehmen dürfen und was nicht.
Das Auge des Polen wanderte über mich. Physikalisch war ich auf seiner Netzhaut abgebildet, wenige Pixel groß – aber wahrgenommen hat er mich nicht. Die Information ist da, aber sie wird nicht rezipiert. Ich hätte genauso gut der graue Wasserfleck an der Hausmauer dort sein können. Dabei war ich es leibhaftig. Operations Officer Jonathan Cowley aus Jackson, Kentucky, von dem seine Großmutter nie gedacht hätte, dass er einmal vor einer türkischen Bäckerei in der Stadt stehen würde, in der ihr Mann vor fast siebzig Jahren Besatzungssoldat gewesen war. Und in der es damals fast noch keine Türken gab. Sie wäre jetzt stolz auf mich, ganz sicher.
Der Gesichtslose fluchte leise. Seine Hauptbeschäftigung bestand in dem Löschen von Ich-Sätzen.
Bald saß er im Kebab-Laden an der nächsten Ecke und trank Kaffee. Die Glastür des Bistros war aufgeklappt, es war warm genug. Der Türke säbelte an dem Kebab-Torso herum. Gepresste Fleischreste, eher weiß als rosig. Hätte auch Spanplatte sein können. Keine Ähnlichkeit mit den Tieren, aus denen sie es gemacht haben. Nur das Wissen, dass es ein Tier gewesen ist. Ein Tier, das Augen hatte. Die Augen sind das Problem. Deshalb hat der Russe Tschikatilo seinen Opfern, bevor er sie tötete, die Augen ausgestochen. Ich beobachtete, wie der Mann das Messer hält und mit welcher Hand. Linkshänder, Rechtshänder? Wie er das Aas ganz leicht mit zwei Fingern berührt, als müsste er es vor dem Schnitt beruhigen. Wie ein Barbier die Kinnlade des Kunden fixiert, um ihm nicht unbedacht in die Wange zu schneiden. Ich musste an die Schulungs-Aufnahmen in Langley denken, kennen Sie die? – Enthauptung russischer Söldner durch die Tschetschenen. Man denkt sich, das geht ruck, zuck. Von wegen. Es dauert quälend lange. Quälend schon für den Betrachter. Mancher aus unserer Gruppe hat’s nicht ausgehalten und ist rausgelaufen. Mag sein, dass man sich mental für so etwas wappnen kann. Ich glaub’s ehrlich gesagt nicht. Wenn es wirklich losgeht, ersäufst du in Angst und bist ein nasses Bündel Nerven.
Vielleicht bist du zu zart besaitet für diesen Job, Officer Cowley? Zu geschwätzig auf jeden Fall. Der Gesichtslose musste an die Passagen in Cowleys Personalakte denken, die ihn von Anfang an stutzig gemacht hatten. Früher hätte man solche Leute nicht eingestellt.
Der Pole ist weitergewandert zu einem Café-Tischchen schräg gegenüber vom Rathaus an der Turmstraße. 13:22 Uhr erhebt er sich dort, durchquert den kleinen Park, klatscht irgendjemandem die Hand, geht rüber nach Alt-Moabit und von dort die Kirchstraße Richtung S-Bahnhof Bellevue. Auf der Brücke bleibt er stehen und guckt auf den Fluss. Träge, fast zögerlich, wallen die grauen Wassermassen Richtung Westen. Zwei unnahbare grüne Glastürme ragen neben dem Hotel Abion in die Höhe. Am roten Pilz der Imbissbude kauft er eine Currywurst. Steht damit rum, dreht sich manchmal im Kreis und sichtet, was um ihn herum passiert, sticht in die Pelle der Wurst oder die Pommes und schiebt sie sich in den Mund.
Mann, der scheint alle Zeit dieser Welt zu haben. Ich wette hundert Dollar, dass er heute wieder genau dieselbe Strecke fahren wird.
Oder er hat was gemerkt, argwöhnte der Gesichtslose. Irgendetwas stimmt an dieser Sache nicht. Dieses Gefühl verließ ihn seit Tagen nicht.
Im März steht die rote Bude mit den Erdbeeren, selbst in kantiger Erdbeerform, noch verschlossen da. Jetzt kommt dieser Lisiecki die S-Bahntreppe runter, ein polnischer Maler. Ist überprüft: Wohnung am Hansa-Platz, Atelier in Steglitz, verkauft ganz ordentlich. Klein, schwarzhaarig, Dreitagebart, so ein knubbliger Künstlertyp; keine Anhaltspunkte für weitere Nachforschungen. Sie klatschen ihre Handflächen gegeneinander. Kurzer Wortwechsel. Überflüssige Menschen haben die alten Russen das genannt.
Wie kommt er auf die Russen?, fragte sich der Gesichtslose. Will sich wohl bei mir einschmeicheln. Solche Bemerkungen versöhnten ihn immer wieder mit Cowleys Logorrhö. Es war ja richtig: Die Größe eines Volkes bemisst sich daran, wie viel Wahrheit es über sich selbst verträgt.
Der Pole fährt die Rolltreppe hoch. Ich nehme ausnahmsweise den Fahrstuhl, verliere ihn eine Minute aus den Augen. Mache mir den Spaß und riskiere es. Der Fahrstuhl spricht und erklärt mir lang und breit, dass er jetzt die Türen schließen wird. Als ich endlich oben rauskomme, fährt die Bahn ein, der Pole steht wie erwartet am Bahnsteig. Er fährt von Bellevue fast immer Richtung Osten, zur Friedrichstraße. Ein manisches Ritual. Am Zielbahnhof lässt er sich von der Rolltreppe am Westende des Bahnsteigs nach unten tragen, geht an der üppigen Front der Obsttheke auf der Zwischenetage vorbei, an der er nie etwas kauft. Zu teuer für ihn. Ich habe einmal gesehen, wie er die Münzen aus seiner Hosentasche nachzählt. Er nimmt die zweite Rolltreppe nach unten und wartet auf die S1. Fährt bis Yorckstraße. Dort steigt er aus, wirft einen kurzen Blick durch die Baulücke über die Gleise nach rechts, nimmt die Treppe nach unten, fast unlustig, als überlegte er, ob er vielleicht lieber umkehren sollte, geht in die Unterführung, vorbei am Türkenmarkt, wo sie gerade die Zelte abbauen, es ist später Mittwochnachmittag, zertretenes Obst und Plastikfolie liegen auf dem Boden, er bleibt an einigen Ständen stehen, manch einen scheint er zu kennen, reicht den Türken die Hand, wechselt Worte, geht rechts rein in die Mansteinstraße. Läuft mit verhaltenem Schwung, so als könnte er mit dem gewohnten Gang die Wirklichkeit überlisten, könnte alles, was passiert ist, ungeschehen machen, und es würde sein wie immer – sein Freund, der Killer, wäre wieder ein Guter und würde die summende Haustür öffnen. Er würde die Treppe hochgehen, sie würden einen Kaffee am offenen Balkon trinken und ihre linken Weltverbesserungspläne ausbreiten, oder was immer sie dort gemacht haben. Jetzt steht er vor dem Eingang der Nummer neun, drückt gegen die Haustür, klingelt und wartet ein paar Sekunden. Heute vergebens. Nur wenn der Hausmeister die Zugfeder nicht nachjustiert, fällt sie nicht richtig zu. An solchen Tagen steigt er hoch in den zweiten Stock und bleibt vor der Wohnungstür stehen. Sie ist nach wie vor unversiegelt. Ein lächerliches Sicherheitsschloss. Er klopft nach einer Weile, nicht laut, so als tue er etwas Verbotenes. Nie hat er versucht, die Tür mit einer Scheckkarte zu öffnen.
Unsere kleinen Überraschungen warten dort, unsere Ostergeschenke liegen ungeöffnet auf dem Gabentisch. Wer konnte wissen, dass dieser Mensch so ein Versager ist. Kein Sturm, kein Drang. Was ist aus den großartigen Polen der Vergangenheit geworden? Aus den aufsässigen Adligen mit ihrem Liberum veto? Napoleons tapferen Soldaten, die sich auf dem Marsch nach Moskau vor den Augen des Oberbefehlshabers in den reißenden Strom stürzten und mitsamt ihren Pferden ertranken? Ihre Gene sind von der Geschichte verweht. Dieser lahme Gaul hier scheut sogar vor einer Wohnungstür. Die wir absichtlich nicht mal verschlossen haben. Er fürchtet sich davor, was er dort zu sehen kriegen könnte. Das ist der wahre Grund. Wenn sich ein Freund von mir ein paar Tage nicht melden würde, würde ich als Erstes nachsehen, ob er nicht tot in seiner Wohnung liegt. Kommt im besten Alter vor. In der Badewanne ausgerutscht, mit dem Kopf aufgeschlagen. Bums. Fertig.
Er tritt ein paar Schritte zurück und guckt nach oben.
Die Pflanzen am Fenster sind immer noch grün. Ich habe sie neulich gegossen, es wäre schade drum. Hab zu Hause in Jackson auch solche.
Rein mit dir, Junge!
Aber nein. Er geht hoch zur Yorckstraße, steigt in die U-Bahn und fährt zum Hermannplatz. Auch diese Strecke kenne ich schon auswendig. Ich positioniere mich an der nächsten Tür und behalte ihn über die Bänke im Blick. Er setzt sich selten hin.
Sinnlose Fahrten. Hypnotisierend und leer.
Hier in der Sonnenallee hört man jetzt viele neue Sprachen. Ich kann sie zwar auseinanderhalten, aber nicht immer genau sagen, wer woher stammt. Dazu war unser Unterricht nicht gründlich genug. Die Gesichterformen – irakische, syrische, jemenitische, albanische, tschetschenische … die haben sie uns eingepaukt. Auf jeden Fall Moslems, fast durch die Bank. Jetzt gehen arabische Großfamilien zu dritt oder viert nebeneinander und weichen den Entgegenkommenden aus Prinzip nicht aus. Sie haben das Trottoir für sich gepachtet. Dabei sind die Bürgersteige sowieso schon viel breiter als in Amerika. Arabische Großväter sitzen mit mehreren Generationen ihrer Nachkommen an Wasserpfeifen vor den Cafés, auf den ersten Blick ganz friedlich. Aber wer weiß, was daraus wird. Spätestens in diesem Schlauch der Sonnenallee merkt man, dass von einer ausgewogenen Bevölkerungsstruktur nicht mehr die Rede sein kann.
Der Gesichtslose schwenkte vom Ausdruck des Berichts zum Bildschirm, klopfte die Zigarre im gläsernen Aschenbecher ab. Er scrollte den Text seines jungen Mitarbeiters, suchte den letzten Satz und löschte ihn. Die Feststellung war erstens banal, zweitens unsinnig, drittens irrelevant für den Fall. Und sie hätte Cowley selbst schaden können. Man merkte, dass er in dieser elenden Kleinstadt in Kentucky aufgewachsen war. Hätte sich mal ein paar Monate in New York austoben, von den Vorzügen der Vielfalt überzeugen sollen. Trotzdem ist er gut, dachte der Gesichtslose. Er lernt schnell, er hat Grundkenntnisse in Arabisch. Sein Traum war Beirut, aber nun war er zur Verstärkung der operativen Arbeit nach Berlin geschickt worden. Sein erster Einsatz im Ausland, gleich nach der Ausbildung.
Hier am Ende des langen Büroflurs beschwerte sich niemand über den Zigarrengeruch. Er rauchte wenigstens keine Machorka mehr. Die Fenster standen weit offen. Sein Faible für alles Russische hatte der Gesichtslose vor vielen Jahren entwickelt, bei seinem Studium der Sowjetwissenschaften. Er hatte noch den berühmten Professor George Kennan in Seminaren erlebt. Am Institute for Advanced Russian Studies in Washington D.C. war er auf den Geschmack von Wodka gekommen. Damals war das so ein Studentenulk – Wodka, Machorka rauchen, Radio Moscow hören, zur sowjetischen Hymne salutieren und strammstehen. Ein Gefühl für den Feind entwickeln. In seine Haut schlüpfen. Dann war das sowjetische Kartenhaus zusammengebrochen und alles Wissen darüber wertlos. Schwere Zeit damals. Der Dienst hatte kein Feindbild mehr. Was war jetzt die größte Bedrohung? Drogen, Terror? Der Präsident ließ sie hängen. Clinton hatte keine Ahnung von Außenpolitik, er interessierte sich nicht dafür. Er hasste diesen Schwanzlutscher. Nein, das war ja umgekehrt gewesen. Viele gute Leute verließen damals die Agency. Es war keine große Ehre mehr, dort zu dienen. Er saß mehrere Jahre untätig rum und schob Verwaltungsdienst. Untätigkeit macht einen Mann kränker und wütender als zu viel Arbeit. Die längst fällige Beförderung blieb aus. Seine Frau hatte genug und verließ ihn. Sie war damals schon Esoterikerin und schloss sich nun auch noch der Partei der Grünen in den USA an. Von deren Chefin hatte er ein ganz gutes Bild aus seinen Akten. Das war eine, die sich bei Putin anbiederte. Nicht zuletzt deshalb hegte er ex post eine Zeitlang die Befürchtung, seine eigene Frau könnte auf ihn angesetzt gewesen sein; den Verdacht hatte er nie aufklären können. Er musste das Haus verkaufen und stand ohne einen Dollar da. Wie ganz zu Anfang, als junger Student. Nur eben dreißig Jahre älter. Schlechte Erinnerungen, die Zeit damals.
Dann kam 9/11.
Und jetzt, als er schon zu alt war für etwas Neues und sich jeden Morgen fragte, wozu er überhaupt noch aufstand, wenn alles bis zum Überdruss getan und gesagt war – jetzt holperte plötzlich die Geschichte wieder los. Seine Lebenszeit lief aus, und die große Zeit da draußen begann gerade wieder. Das war nicht gut synchronisiert. Er legte den Daumen auf sein linkes Handgelenk. Die erschöpfte, lustlose Welle seines Pulses beruhigte ihn.
Andere Lebenszeiten standen mit der Gegenwart besser im Einklang. Die jungen Leute hatten Power. Und Cowley schrieb und schrieb.
Der Pole klingelt am Hauseingang Nummer 51 und wartet. Niemand öffnet. Der Pole geht über den Mittelstreifen, setzt sich in einen Falafel-Laden und bestellt einen Kaffee.
Nach einer halben Stunde geht er zurück über die Straße und klingelt erneut. Nach wenigen Sekunden drückt er die Tür auf. Wie das? In der vergangenen halben Stunde hat niemand das Haus betreten. Wer hat ihm da jetzt geöffnet? Soll ich ihn gehen lassen? Mir bleibt nicht viel anderes übrig. Gleich hinter ihm durch die Haustür rein, das würde er merken. Also warte ich zwischen den Holzkästen des Blumenhändlers an der Ecke und wimmle die Verkäuferin ab, die hilfsbereit aus dem Laden tritt. Schlendere herum und stoße um die Ecke auf einen kleineren Eingang von der Nebenstraße. Verschlossen. Als eine junge Frau kommt und aufschließt, schlüpfe ich ihr nach, bevor die Tür ins Schloss fällt. Hier muss auch derjenige hereingekommen sein, der ihn eingelassen hat.
Ein Hof mit Beeten und Fahrrädern. Sehr idyllisch. Meine Großmutter hat zwar im Norden Berlins gelebt, aber vielleicht war es ein ähnliches Haus wie das hier? Von hier geht es in den Treppenflur des Vorderhauses, in dem er vorhin verschwunden ist. Ich steige bis zum Treppenabsatz unter dem zweiten Stock hoch, lehne mich ans Fensterbrett, gucke raus und warte, um – wenn er runterkommt – ungefähr einschätzen zu können, in welchem Stock er gewesen ist.
Eine ältere Frau kommt herunter.
«Guten Tag!», sagt sie argwöhnisch.
«Tag. Meine Freundin braucht immer ewig zum Schminken», sage ich in dem Deutsch, das ich von meiner Großmutter gelernt habe.
Sie guckte nicht gerade freundlich. Vielleicht wegen meines amerikanischen Akzents, oder weil sie sowieso kein Wort verstanden hat.
Als ich ihr nachschaute, sah ich den Araber auf dem Hof. Ein Libanese offenbar. Er blickte schnell weg, blieb aber stehen.
«So stürmisch? Wer hätte das gedacht?», sagte Evîn zur Begrüßung. Dabei stand ich nur da. Sie war es, die mir das Hemd aus der Hose fummelte und ihre Finger auf meinem Bauch hochwandern ließ. Die Wohnungstür war zugefallen, ich schob sicherheitshalber den Riegel zu. Jedes Mal hatte ich ein bisschen Angst, ob ihr Mann auch wirklich weg war. Ich wusste, was folgen würde. Evîn war schmal und jungenhaft, sie hatte fast keine Brüste, kurzes schwarzes, im Nacken ausrasiertes Haar. Wenn sie ihren kleinen Körper gegen den meinen drückte, konnte ich sie spielend anheben.
«Da steht einer im Hof», sagte ich.
«Wie sieht er aus?», fragte sie.
«Libanesisch.»
«Ach so, der. Mein Verehrer. Oder Aufpasser, wie du willst.»
«Bist du sicher, dass dein Mann nicht gleich zurückkommt?», fragte ich.
«Der sitzt längst im Flieger nach Istanbul. Hat mir gerade getextet.»
«Und wenn er lügt?»
«Lügen tut er sowieso. Aber er liebt mich.»
Sie hielt mir das Smartphone vor die Nase. «Willst du lesen?»
Und als sie mein Gesicht sah: «Komm …»
Sie zog mich auf die Wohnzimmercouch.
Die Olivenhaut ihres Bauches unter dem ungeduldig hochgezogenen roten T-Shirt. Erwartungsvoll angewinkelte Beine, krauses Haar.
Kurz bevor ich kam, hatte ich die silberne Pistole im starr werdenden Blick. Sie lag auf dem unteren Regalboden in ihrem Bücherschrank. Eine Phönix HP25. Rühr sie nicht an!, hatte Evîn gerufen, als ich beim ersten Mal danach greifen wollte. Ist die echt?, hatte ich noch gefragt. Und sie: Du hinterlässt Fingerabdrücke! Außerdem ist sie geladen! – Wozu brauchst du so was?, hatte ich wissen wollen. Hat mir mein Mann geschenkt. Zur Selbstverteidigung.
Zum Abschied machte sie uns einen starken Espresso.
Als ich wieder angezogen in der Wohnungstür stand, zog sie mich sachte aus dem Hausflur zurück.
«Willst du noch mal?»
Die Schamlosigkeit ihrer Frage wirkte verlässlicher als Viagra.
Cowley war anders. Viel jünger. Er kannte den Kalten Krieg nur aus Büchern. Er zählte zu jener neuen Generation der Agency, für die es heißere und spannendere Pflaster gibt als das alte Europa. Der Nahe Osten steht dabei an erster Stelle. Israel, Jordanien, Libanon. In den Iran wagten sich nur wenige Leute.
Europa war fauliger Brei. Es zersetzte sich von ganz allein.
Cowleys Vorzüge: Er besaß das unschätzbare Talent, unbemerkt an den Leuten dranzubleiben. Andere lernen das erst nach Monaten, wenn überhaupt. Nur wenn es schnell gehen musste, fehlte ihm die Kondition. Aber für die unauffällige Observierung hatte er die richtige Erscheinung, das uninteressierte Gehabe des kleinen Angestellten. Mit seinen leicht schwappenden, weichen Wangen und im durchschnittlichen Anzug konnte er an jeder Ecke, an jedem Zeitungskiosk stehen und in einem Autojournal oder Softporno blättern, er würde niemandem auffallen. Ein bisschen wie ein Zeuge Jehovas, dachte der Gesichtslose. Cowley wirkte wie der nette Schwiegersohn von nebenan. Aber – und das war das nächste Plus – dieses Aussehen täuschte. Der Gesichtslose hatte seine Personalakte studiert. Die Beurteilungen enthielten dezente Hinweise auf Sadismus in Kindheit und Jugend. Er hatte Tiere gequält. Bei den Einstellungstests wollte er das herunterspielen, aber die Agency hatte ihre Quellen, Familienangehörige, das ganze Umfeld. Aus den Kampfsportschulen, die er besuchte, kamen Berichte, dass er äußerst aggressiv sei und keine Rücksicht auf Verletzte nehme. Während der Ausbildung fand man auf seinem Phone Videos, die Hinrichtungen des IS in Syrien zeigten. Menschen, die bei lebendigem Leibe im Käfig verbrannt wurden. Köpfungen. Er konnte das alles dienstlich rechtfertigen, konnte sich rausreden. Und dann ein Punkt, der eigentlich nicht erheblich war: Seine Großmutter war Deutsche gewesen. Schließlich stammt jeder Bürger unseres großen Landes von irgendwo her. Und dennoch brachte diese Tatsache den Gesichtslosen zum Grübeln: eine junge Frau von einundzwanzig Jahren, die sich zum Kriegsende ins zerbombte Berlin gerettet hatte, eine Frau mit zerstörten Träumen, deren Jugend in den Glückstaumel des deutschen Größenwahns gefallen war, bis dann die Vernichtung folgte – und das Ultimatum: Untergehen – oder vernünftig werden. Eins von beiden. Wir haben sie alle gezwungen. Haben sie gezwungen, von einem Tag auf den anderen vernünftig zu werden. Manche haben natürlich nur so getan. Sie aber hat sich nicht einfach nur angepasst. Sie ist mit einem Amerikaner in die Staaten gegangen und hat versucht, ein neues Leben zu beginnen. Ob ihr das gelungen ist? Wer weiß, was der Enkel da alles abzuarbeiten hat, ohne es zu wissen. Ihr einziger Sohn James kam 1954 zur Welt. Dieser Mann, Cowleys Vater, war derjenige, der der CIA das größte Kopfzerbrechen bereitet und sie zu den langwierigsten Nachforschungen gezwungen hatte. An ihm wäre Cowleys Bewerbung auch fast gescheitert. Als Jonathan Cowley 1990 zur Welt kam, hatte sein Vater die Arbeit im Stahlwerk bereits verloren, war Alkoholiker. Den kleinen Jungen, seinen einzigen Sohn, soll er geschlagen haben. Im Alter von zweiundvierzig Jahren war er mit einer jungen Frau durchgebrannt und nie wieder aufgetaucht. Nicht einmal die Agency hatte herausfinden können, wo er abgeblieben war. Cowley lebte seit seinem sechsten Lebensjahr in einem reinen Frauenhaushalt – Mutter, Großmutter und ab und zu eine mexikanische Haushaltshilfe.
Den Ausschlag bei der Gesamtbeurteilung gaben Cowleys persönliche Qualitäten. Nach einem verlorenen Jahr mit Creative Writing in Iowa City hatte er Arabisch gelernt und Kampfsport trainiert. Ganz bewusst, denn er wollte zur Agency und wusste, dass ihnen Leute mit solchen Sprachkenntnissen fehlten. Sie waren oft sogar auf Kollegen vom jordanischen Geheimdienst angewiesen. Der Gesichtslose war überzeugt, dass die aktuellen politischen Anforderungen den Ausschlag für Cowley gegeben hatten. Er sympathisierte mit der neuen amerikanischen Revolution, wollte mit dem Präsidenten den Sumpf in Washington trockenlegen. Einer von den jungen, weißen Kräften gegen das verfaulte Establishment der Ostküste. Wollte die Staaten wieder den Leuten zurückgeben, die sie aufgebaut hatten, den weißen Arbeitern. Der Gesichtslose hatte nur ein Lächeln dafür übrig. Wiedergeburt, dachte er verächtlich: Von Russland über Polen bis zu uns, überall erheben sie sich von den Knien. Die ganze Menschheit glaubt, eine Herde von Erniedrigten zu sein. Er spuckte einen Krümel Zigarrentabak in die Ecke. Schieb dir deine Wiedergeburt in den Arsch. Hättet lieber auf allen vieren bleiben sollen, wäre für euch und für die Menschheit besser gewesen. Ihr werdet uns überrollen. Grauenhaftes Heer von Zombies, die eben noch am Boden gekrochen sind. Dostojewski hätte seine Freude daran gehabt. Er wusste nicht, ob es dieser Name, die Vorstellung der Zombies oder seine Magenprobleme waren, die den leichten Brechreiz auslösten. Er griff nach dem Fläschchen und ließ eine Dosis Iberogast ins Wasserglas tropfen.
Cowleys Nachteile fielen weniger ins Gewicht. In seinem Ehrgeiz hoffte er, gleich zu Beginn seiner Karriere auf eine große Sache zu stoßen. Neigte deshalb dazu, sich Dinge einzubilden. Vermutlich als Spätfolge seines ersten, abgebrochenen Studiums schrieb er jeden Tag einen halben Roman, statt seine Beobachtungen knapp zusammenzufassen. Das musste der Gesichtslose dann selbst analysieren, und es kostete Zeit. Davon allerdings hatte er genug. Im Grunde saß er hier in Zehlendorf und las Cowleys Fortsetzungs-Gossenroman – jeden Morgen eine neue Folge. Sonst gab es nicht viel zu tun. Berlin schien in Vergessenheit geraten zu sein. Monatelang waren sie ohne Botschafter ausgekommen, und fast niemand hatte es gemerkt. Irgendetwas lief da schief in der Zentrale. Die wenigen Aufträge von dort waren blödsinnig. Jemand in Washington wollte wissen, welche der meinungsbildenden Exil-Amerikaner und Multiplikatoren in der Stadt gegen den neuen Präsidenten hetzten oder heimlich gegen ihn intrigierten. Das wussten sie natürlich, es war ja die Mehrzahl. Aber solche Informationen weiterzugeben, war ihnen nach der Satzung der Agency sogar verboten. Abhängen lassen nannten sie, was sie mit solchen Aufträgen taten. Von solchen abgehangenen Vorgängen gab es immer mehr in den schwarzen Bisley-Schränken, weder alphabetisch noch nach Aktenzeichen geordnet, aber eben auch nicht vernichtet, sodass man sich bei beharrlicher Nachfrage damit herausreden konnte, der Vorgang sei falsch abgelegt worden. Schuld der Sekretärin. Vorteil des abgehangenen Vorgangs im Vergleich zum Steak: Er fängt nicht an zu stinken. Manchmal machten sie sich einen Spaß und lieferten Fake-Berichte. Mit Alias-Namen oder über Leute, denen sie eins auswischen wollten. Das ging so lange, bis Cowley kam. Seit Cowley auf Station war, hüteten alle ihre Zunge und das Übrige sowieso. Er merkte sehr bald, dass sie hinter seinem Rücken über seine Orientierung witzelten.
Cowley selbst war anfangs wenig erbaut, dass er als Nahost-Experte, statt in Beirut die Hisbollah zu penetrieren (auch so ein Lieblingswort des Gesichtslosen), in Berlin einem Polen nachlaufen sollte. Ostblock interessierte ihn nicht. Ostblock war kein ernstzunehmender Gegner mehr. Vielleicht lebte etwas von der alten Verachtung seiner Großmutter in ihm fort. Als Frau, die im April 1945 vor der Roten Armee in den Westteil der Stadt geflohen war, hatte sie allen Grund zu dieser Abneigung gehabt. Er, der Enkel, konnte die Nachfahren jetzt an den U-Bahn-Ausgängen der Stadt beobachten. Polen, Russen, spielt keine große Rolle. Man erkannte sie an ihren runden Gesichtern, den kurzgeschorenen Schädeln und großen Hundeaugen voll rot unterlaufener, hilfloser Wut. Meist rotten sie sich zu Gruppen zusammen, wozu schwache Wesen ohnehin die Neigung haben. An ihnen vorbei strömten Türken, die hielten sich besser. Je länger einer in dieser Stadt lebte, desto angegriffener wirkte er, glaubte Cowley. Es schien eine Art von Duldsamkeit zu sein, die Berlin den Menschen aufprägte, in die Psyche und ins Gesicht. Am besten hielten sich noch die Araber. Weil sie keinen Alkohol trinken, schätzte Cowley. Dadurch behalten sie einen klaren Kopf. Sind stiller, gefasster. Ihre Wut kommt, wenn, dann konzentriert. Gezielt. Eine feinere Rasse, irgendwie.
Je mehr Zeit er mit dem Polen verbrachte oder, besser gesagt, hinter ihm, und je länger er seinen wogenden Gang, die federnde und manchmal erschlaffende Linie des Rückens, das beinahe boxerische Auf und Ab der Schultern unter der Lederjacke beobachtete, je mehr er sich in diesen Mann hineinversetzte, das uneindeutige Profil des verbrauchten Gesichts betrachtete, desto stärker fühlte er sich von ihm angezogen. Lauf einem Mann ein paar Tage hinterher, Stunde um Stunde, sitz hinter der Zeitung versteckt im Café ein paar Tische weiter und warte geduldig, bis er die Tasse zur Seite schiebt und aufsteht, lass dich im Vorübergehen von seiner Traurigkeit streifen, finde ihn dann mit gestrecktem Arm an die Stange der U-Bahn geklammert, den Körper leicht durchgebogen wie ein Gorilla im Zoo, genauso stark und genauso gefangen in seinem Leben wie der Affe hinter den Gittern, und dieser Mann wird sich in dein Auge einbrennen. Und tiefer, ins Gehirn.
Hermetische Lederkerle mit ölglänzender, gebräunter Haut machten Cowley weniger an. Er stand auf unsichere Jungs. Kleine Gesten waren es, die sein Interesse erregten: eine unentschlossene Schrittfolge, ein leichtes Stolpern, unbewusstes Schulterzucken. Ein echter Kerl zuckt nicht mit den Schultern. Der Pole war nicht mehr der Jüngste, dennoch ließ er Cowley manchmal vergessen, dass er eigentlich viel lieber in der Hitze Beiruts herumgestreunt wäre. Er brauchte Geduld. Geduld war eine der ersten Agententugenden. Cowley tröstete sich damit, dass noch viel passieren konnte.
Schritte kamen die Treppe hoch. Der Libanese blieb breitschultrig vor Cowley stehen. Zu nah für westeuropäische Verhältnisse.
«Suchst du was?», fragte er mit starkem arabischen Akzent.
Cowley antwortete nicht, wich aber auch keinen Zentimeter zurück. Er starrte den Araber an. Sein Gesicht wurde zu jener unbeweglichen, teigigen Maske, die den Leuten mehr Angst einflößt als die gruseligste Grimasse. Das wusste Cowley. Er selbst empfand die Bedrohung eher als körperliche Erregung. Der Araber stellte keine Gefahr dar. Er konnte ihn mit wenigen gezielten Schlägen liquidieren und hätte das insgeheim gern getan. Cowleys Erektion konnte der Libanese zwar nicht sehen, er nahm aber sehr wohl wahr, dass bei seinem Gegenüber etwas nicht stimmte. Diese Wahrnehmung wirkte wie ein feiner Geruch, und sie genügte, ihn abzuschrecken. Vorsicht, ein Verrückter, dachte er, drehte sich wortlos um und ging die Treppe runter.
Cowley ließ die über dem Zwerchfell gesammelte Luft heraus. Die Nähe dieses muskelbepackten, dunkelhaarigen Mannes, der feine, uneuropäische Geruch seines Schweißes und der Sturm von Adrenalin hatten ihm gutgetan, auch ohne die erhoffte körperliche Lösung. Endlich ein Hauch von Gefahr.
Kurz darauf schlurft der Pole die Treppen herunter. Vierter Stock oder höher. Zwischendurch war eine Wohnungstür aufgegangen, ich hörte tuscheln, Schritte, dann klickte sie wieder ins Schloss. Eine halbe Stunde verging. Jetzt kommen Schritte runter. Ich setze mich in Bewegung. Tue so, als stiege ich die Treppen hoch, komme an ihm vorbei. Er schaut mir nicht ins Gesicht. Einer von denen, die einen nie angucken.
Als ich seine Schritte auf den Steinkacheln des Erdgeschosses höre, eile ich hinunter, ihm nach.
Er geht die Sonnenallee in Richtung Hermannplatz.
Vor ihm ein junges Mädchen, strähnige Locken, nicht wirklich Rasta, mit einem Hund, schwer zu sagen, ob sie es ist, die so stark riecht, um nicht zu sagen stank, oder ihr Hund. Beide verfilzt.
«Scheiße!», zischte der Gesichtslose und löschte, was zu löschen war.
Das Tier, ein strubbliger Mischling, pudelgroß, trottelt ihr hinter her. Ohne Leine. Zwei Frauen in dunkelblauer Uniform stellen sich ihr in den Weg. Die blasssilbernen Buchstaben «ORDNUNGSAMT» gut lesbar. Das Mädchen steht da, redet, gestikuliert, fängt an zu schreien. Ihre kreischende Stimme trägt weit, die Worte bleiben unverständlich. Die Frauen, Mitte bis Ende fünfzig, zeigen sich wenig gerührt. Die Fülligere greift zu ihrem Telefon. Der Pole bleibt zwanzig Meter vor mir, aber hinter der Gruppe, stehen. Ein paar Leute sammeln sich um die drei Frauen. Arabische Männer mischen sich ein.
«Warum vergreifen Sie sich immer an den Schwächsten? Kleine Mädchen mit Hunden!»
«Vergreifen Sie sich mal nicht im Ton!», sagt die Hagere der beiden, als wäre das Deutsche keine lebende Sprache mehr, und kritzelt ungerührt weiter in ihrem Notizblock.
«Wann kümmern Sie sich um die Drogenhändler hier?» Ein älterer Mann tritt von der Seite hinzu.
«Fällt nicht in unsere Zuständigkeit», sagt die andere fast schüchtern.
Das Mädchen scheint es sich plötzlich überlegt zu haben. Sie beruhigt sich. Sinnlos, wegen so einer Kleinigkeit auf den Putz zu hauen. Respekt vor den Ordnungshüterinnen jedenfalls ist nicht der Grund. Bald darauf geht sie weiter, der Hund immer noch nicht angeleint. Der Pole sieht, wie sie das Tier anschreit, brüllt, wenn es nicht sofort pariert oder missversteht. Gleich darauf ist sie wieder überzärtlich. Wie soll ein Hund da Charakter entwickeln? Dabei hat sie nun plötzlich doch eine Leine. Sie zieht sie aus der Hosentasche und bindet das Tier vor dem Supermarkt an. Der Pole bleibt stehen und guckt. Sie kommt nach einer Weile mit mehreren Packungen Hundefutter wieder raus. Zieht eine Dose auf, schüttet den Inhalt auf die Straße. Braune, feucht glänzende Masse mit helleren Klümpchen.
Er spricht sie an. Thema ist, den Gesten zu entnehmen, der Hund. Vielleicht versucht er, ihr zu erklären, wie man so ein Tier erzieht.
Jetzt brüllt sie ihn an. Ich kann von hier aus nichts verstehen, obwohl sie laut schreit. Er steht da, ungerührt. Schaut ihr ins Gesicht. Dann wendet er sich ab und geht weiter.
Was ist das jetzt? Ein anderer als sein depressiver Vormittagsgang. Kein schulternzuckendes Abwimmeln der eigenen Zweifel. Es ist der erschrockene, aber auch empörte Schritt eines Mannes, der sich schon viel zu lange alles gefallen lässt. Dem im nächsten Moment die Hutschnur reißen wird. Jetzt ist der Moment gekommen. Er wird kehrtmachen und etwas tun … Denkste. Der Pole geht einfach weiter. Er wirft nicht mal einen Blick zurück. Als würde der Film ihn jetzt langweilen, als hätte er alles verstanden und verließe das Kino.
Als er die Treppe aus der U-Bahn Yorckstraße hochsteigt, rollt oben auf der Brücke die S-Bahn ein. Plötzlich entwickelt er erstaunliche Sprinter-Qualitäten, die Steintreppe hoch. Ich lasse ihn laufen.
Als die Wohnungstür ins Schloss gefallen war, merkte Frieda, wie ihre Rückenmuskeln lockerließen und ihre Wirbelsäule sich endlich auf die Gummimatte senkte. Sie zog den linken Schenkel zum Bauch hoch, dann den rechten, streckte abwechselnd die Knie, hob die Arme und ließ sie wieder sinken, vertiefte sich in die Schwere jedes einzelnen Körperglieds. Solange die Geräusche von laufendem Wasser und dem Klirren des Kaffeebechers aus der Küche kamen, konnte sie sich nicht völlig entspannen. Jetzt war es so still in der Wohnung, dass sie die Wanduhr in der Küche ticken hörte.
Weiches Sonnenlicht fiel auf den Teppich. Sie genoss die natürliche Wärme. Es war ein oder zwei Tage vor Vollmond. Heute hatte sie frei, brauchte nicht in die Einrichtung nach Schöneberg zu fahren. Brauchte sich keine schlimmen Geschichten von fremden Mädchen und Frauen anzuhören. Sie hatte genug eigene Sorgen.
Die Übungen halfen ihr, abzuschalten und auch jeden Gedanken an Paweł zu verbannen.
Er hatte zum Glück noch so viel Anstand, tagsüber wegzugehen. Als würde er arbeiten. Er kam am späten Nachmittag zurück, manchmal erst in der Nacht. Das tat ihr gut. Auch wenn sie sich zuweilen Sorgen machte, weil er dort draußen sinnlos herumlief. Sie musste aufpassen, dass sie nicht zu viel Mitleid mit ihm entwickelte. Er war für sich selbst verantwortlich. Er ging, um sich selbst vorzumachen, dass es da etwas für ihn zu tun gäbe. Vorher bewunderte er sich immer noch in seiner Montur – schwarze Lederjacke, Jeans – vor dem Flurspiegel. Er fuhr sich auch tatsächlich mit der rechten Hand durch das noch dichte, noch dunkle Haar. Sie ahnte, wie er sich sehen wollte. Komm mal runter von deinem Sockel, dachte sie, du bist kein Held, du bist ein hilfloser Junge, der sich was vormacht.
Sie hatte im Laufe der Jahre so viele Ideen für ihn gehabt, so viele Anregungen gegeben. Er hätte sich doch ein Buch mitnehmen können. Sich damit in einen Park setzen. Sie glaubte leider nicht, dass er in die Staatsbibliothek ging, wie er manchmal sagte. Sein Vertrag als Gastdozent an der FU war vor zwei Jahren ausgelaufen. Das war eine gute Zeit, er war beschäftigt gewesen. Auch wenn die Bezahlung so beschämend gering gewesen war, dass sie es anfangs gar nicht glauben konnte. Eine Herausforderung weniger. Bourdieu oder ein anderer Franzose, in Anwendung auf. Und sein geliebter Nietzsche, natürlich. Darin war er gut. Sie schlug ihm manchmal vorsichtig vor, was er noch probieren könnte. Je länger die beschäftigungslose Zeit andauerte, desto empfindlicher reagierte er auf Ratschläge, wurde immer gereizter. Man konnte nicht mehr mit ihm diskutieren. Er rastete aus, schrie herum. Knallte mit der Tür. Sie hatte dann den Eindruck, er stünde kurz vor einer Gewalttat. Damit hatte sie Erfahrungen.
Es war gar nicht, dass er mehr trank als früher. Er war nur nach der gleichen Menge irgendwie anders.
Früher hatte er sich immer mit Konrad treffen können. Wenn Konrad gestorben wäre, bei einem Unfall, dann wäre das alles leichter zu ertragen gewesen, auch für Paweł. Dann würde wenigstens Klarheit herrschen.
Seit er weg war, gab es kein Gegengewicht mehr, keinen Sparringspartner. Pawełs existenzielle Situation lastete sozusagen ganz und gar auf ihr allein. Die meisten seiner Bekannten waren ebenso passive, ziellose Menschen wie er selbst, Polen oder Deutsche mit zu viel Freizeit, die gern mit ihm rumhingen. Dieser Maler zum Beispiel, der in einem der Hochhäuser am Hansa-Platz wohnte. Solche Leute waren natürlich froh über jeden, der seine Zeit mit ihnen vertat, sie besuchte oder abends mit ihnen trank. Diesem Menschenschlag war sie regelmäßig auf Vernissagen begegnet. Davon gibt es in Berlin genug; im Polnischen Institut am Hackeschen Markt, in allen möglichen Galerien. Anfangs war sie noch mitgegangen. Bis ihr klargeworden war, dass dort immer dieselben Gesichter auftauchten und es nicht zuletzt der kostenlose Wein war, der sie anzog. Sie flanieren anstandshalber vor den Bildern oder Installationen auf und ab und sahen es ansonsten als Party, die sie für einige Stunden aus ihrer Einsamkeit erlöste. Irgendwann hatte sie verstanden, dass diese sogenannte Geselligkeit in Wahrheit nur ein folgenloses Gerede und Nichtstun war. Ein Überquasseln der eigenen Lebenssinnlosigkeit. Als Psychologin hätte sie Verständnis dafür haben sollen. Aber als Protestantin, die sie auch war, hatte sie überhaupt keines. Sie selbst arbeitete hart und erwartete das auch von anderen. Mühsam hatte sie durchgesetzt, dass die Gelage wenigstens nicht mehr in ihrer Wohnung stattfanden. Diese Menschen gaben Paweł nichts, sie forderten ihm nichts ab. Es war schade um ihren Mann … Aber so dachte sie nicht, sie dachte nie: mein Mann. Sie dachte immer nur: Paweł.
Konrad, obwohl auch nicht gerade ein Ausbund an Erfolg, war der einzige unter den Freunden, der Leben in sich hatte, dachte sie und erschrak zugleich: Denn man konnte ja nicht ausschließen, dass er schon tot war. Bei Konrad hatte sie immer einen authentischen Widerstand gespürt, etwas Echtes, das zur Gegenrede herausforderte, ein Nachdenken, Bemühen um die Wahrheit. Für Paweł als Katholiken war Wahrheit verhandelbar. Sie dürfen ja auch alles tun und mit der Beichte wieder zurechtrücken. Mit Konrad dagegen hatte sie gerne gestritten, nächtelang. Auch wenn sie Kopfschmerzen vom Rauch bekam, und einen leichten Kater. Aber es blieb der Eindruck, sie hätten die Wahrheit umkreist, hätten sich redlich mit ihr abgemüht und nicht nur die Zeit verplaudert.
Konrad hatte Leben in ihre Beziehung gebracht. Dass er nun einfach weg sein sollte, machte ihr Angst. Weil es so unerklärlich war. Es dauerte jetzt schon zu lange. Sie hatte Erfahrung mit Mädchen, die plötzlich verschwanden und nie wieder auftauchten. Auch Frauen, die einfach weggingen. Dieser berühmte Gang zum Zigarettenziehen und Nie-wieder-Kommen ist gar nicht so selten. Sie hatte lange darüber nachgedacht, wo er sein könnte. Wann er verschwunden sein musste … Sie hatte Paweł nie von dem letzten, langen Telefongespräch erzählt, als Konrad in bester Laune aus dem Hotel anrief und nichts auf sein Verschwinden hindeutete. Sie redete nicht mehr oft mit Paweł. Vor einigen Tagen war sie zur Polizei gegangen und hatte eine Vermisstenanzeige erstattet. Auch davon hatte sie Paweł nichts gesagt. Der Beamte hatte wissen wollen, in welcher Beziehung sie zu dem Vermissten stand. Ein Freund von mir, hatte sie gesagt. Daraufhin hatte man ihr erklärt, dass bei einem Mann diesen Alters, der nicht suizidgefährdet oder dement ist oder bei dem auch sonst kein Verdacht auf eine Straftat besteht, nichts unternommen werden könne. Jeder Mensch dürfe frei über seinen Aufenthaltsort entscheiden, auch ohne Angehörige und Freunde darüber zu unterrichten. Da wurde ihr klar, in welches Licht sie sich mit dieser Anzeige gesetzt hatte. Vermutlich hielten die netten, hemdsärmligen Beamten sie jetzt für eine verschmähte Liebhaberin. Eine Stalkerin. Jedenfalls war die Auskunft quasi die amtliche Bestätigung, dass sie sich mit dem Verlust abfinden musste. Nach über zwei Wochen hielt sie es für wenig wahrscheinlich, dass Konrad noch am Leben war. Er hätte bestimmt gemailt oder angerufen. Sein Handy war tot. Von seiner Mailadresse kam die Meldung «Postfach überfüllt».
Sie ließ die Wanne ein und schüttete Badesalz hinzu. Das Wasser färbte sich grünlich und schäumte. Frieda streifte die Träger ihres weichen Schlafkleides über die Schultern und ließ es auf den Boden sinken. Dann setzte sie prüfend eine Fußspitze ins Wasser. Im Wandspiegel sah sie ihren Rücken und fand ihn immer noch muskulös und schlank. Ihre Gesäßbacken waren immer schon kräftig flach gewesen, wie abgerundete Rechtecke. Auf diesen Po war sie stolz, die Männer hatten ihn gemocht. Kurz darauf lag sie ganz im Wasser und atmete tief und gleichmäßig. Sie fuhr sich mit der Hand über die Innenseite des Oberschenkels, die Haut war schon weich vom warmen Wasser. Sie streichelte sich, zuerst einfach so, ohne eine konkrete Vorstellung, später kam sie auf einen Israeli, den Konrad einmal zum Essen mitgebracht hatte, Gast einer Reisegruppe, die er betreute. Das durfte er eigentlich nicht, jemanden privat mitnehmen, ein Verstoß gegen die Reiseführeretikette. Das war ein junger Mann mit dichter schwarzer Wolle auf dem Kopf und einem strahlend weißen Gebiss. Woher sie dieses Lächeln nur immer noch nehmen, nach allem, was wir ihnen angetan haben, hatte sie damals gedacht. Sie hatte ihn nur ein Mal im Leben gesehen. Gerade fremde Männer erregten ihre Phantasie oder solche, mit denen es eigentlich unvorstellbar war. Manchmal dachte sie sogar an Konrad. Sie stellte sich vor, er hätte plötzlich seine Neigungen geändert, und sie hätte ihn herumgekriegt.
Sie war jetzt Mitte vierzig und litt schon seit einiger Zeit unter der Ahnung, dass in ihrem Leben vielleicht nicht mehr viel passieren würde. Trotz ihrer psychologischen Ausbildung konnte sie das Gefühl nicht genau definieren. Gut, die Arbeit war nicht mehr das, was sie sich einmal vorgestellt hatte. Die Klientinnen langweilten sie. Sie sah in diesen missbrauchten, traumatisierten oder aggressiven Frauen keine Schicksale mehr, keine Menschen. Nur wenige von ihnen weckten ihre Empathie. Schematisch arbeitete sie die Behandlungsrichtlinien ab. Ertappte sich dabei, dass sie sie minutenlang reden ließ und mit ihren eigenen Gedanken woanders war. Zu viele solche Frauen hatte sie erlebt, zu viele begleitet, therapiert. Da wiederholten sich einige wenige Muster, immer wieder. Lange hatte sie sich das nicht vor sich zugeben wollen, doch mittlerweile war ihr klar, dass sie nicht mehr gern nach Schöneberg in die Beratungsstelle fuhr. Und seither fragte sie sich, was sie noch vom Leben erwartete. Paweł konnte ihr jedenfalls nichts geben. Paweł war immer nur das Problem. Man konnte auch mit ihm nicht darüber reden. Er war so von sich selbst überzeugt, so verliebt in sich, dass er alle derartigen Fragen mit ängstlicher Nonchalance wegwischte. Sie wusste bis heute nicht, welche Vorstellungen er von seiner Rolle hier hatte, er schwärmte von Nietzsche, von einem idealisierten «Deutschtum», ein Wahnsinn – ein Pole, der für den Ideologen der «Herrenrasse» schwärmt. Das Wort «Deutschtum» allein war so ewig gestrig. Dabei hatte Paweł selbst nichts von diesem Ideal. Er war keine Spur von kämpferisch. Er war abhängig wie ein Kind und benahm sich oft dementsprechend, und das trug nicht gerade dazu bei, dass sie Lust auf ihn als Mann gehabt hätte.
Sie sank noch tiefer in die Wanne und lag mehrere Minuten regungslos. Erst das Klingeln an der Wohnungstür riss sie aus dem Dämmer.
Sie zögerte einige Sekunden. Dann stieg sie aus der Wanne, zog den Frotté-Bademantel über und ging an die Tür. In der Sprechanlage meldete sich eine männliche Stimme. Sie öffnete die Haustür und lauschte den Schritten auf der Treppe. Ein blonder junger Mann in einem Overall erschien. Der Heizungsmonteur. Von der Wohnungsbaugesellschaft bestellt, sagte er, um die Ventile an den Heizkörpern zu kontrollieren. Während er auf dem Wohnzimmerboden sein Werkzeug auspackte, ging sie in die Küche und machte ihm einen Kaffee.
«War gar nicht einfach, was?», fragte sie, als er ihr einen Zettel zum Unterschreiben vorlegte. Sie wollte freundlich sein. Es hatte lange gedauert.
«Ne.»
So ein Stiesel. Die meisten Männer haben Probleme damit, ganz normal zu kommunizieren. Sie bereute, ihm den Kaffee angeboten zu haben.
Als er weg war, setzte sie sich an den Schreibtisch, um ausstehende Patientenberichte zu schreiben, für den Verein. Missbrauch, Gewalt, Anti-Aggressionstraining für junge Mädchen. Es gab viel mehr Mädchen, die sich selbst verletzten, als man glaubte.
[...]
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Shekardesign / Getty Images
Schrift DejaVu Copyright © 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved.
Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-00414-6
www.rowohlt.de
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
ISBN 978-3-644-00414-6
Verbinden Sie sich mit uns!
Neues zu unseren Büchern und Autoren finden Sie auf www.rowohlt.de.
Werden Sie Fan auf Facebook und lernen Sie uns und unsere Autoren näher kennen.
Folgen Sie uns auf Twitter und verpassen Sie keine wichtigen Neuigkeiten mehr.
Unsere Buchtrailer und Autoren-Interviews finden Sie auf YouTube.
Abonnieren Sie unseren Instagram-Account.
Besuchen Sie unsere Buchboutique!
Die Buchboutique ist ein Treffpunkt für Buchliebhaberinnen. Hier gibt es viel zu entdecken: wunderbare Liebesromane, spannende Krimis und Ratgeber. Bei uns finden Sie jeden Monat neuen Lesestoff, und mit ein bisschen Glück warten attraktive Gewinne auf Sie.
Tauschen Sie sich mit Ihren Mitleserinnen aus und schreiben Sie uns hier Ihre Meinung.