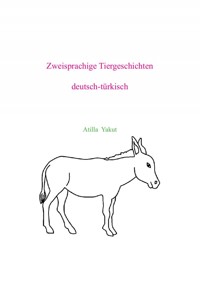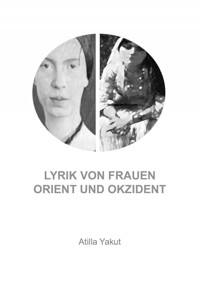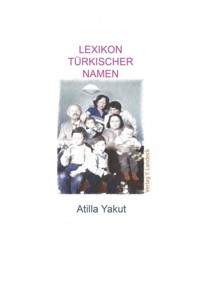
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
In vielen Kulturen wird dem Namen einer Person große Bedeutung beigemessen. Das Aussprechen eines Namens kann manchmal Glück und oft Unglück bringen, wenn er einem Toten gehört. Oder man gibt dem Kind den Namen einer bestimmten Person, in der Hoffnung, daß das Kind die gleichen Eigenschaften und die gleiche Bestimmung wie diese Person erlangt. Und manchmal will man, daß durch das Kind, das den Namen eines gestorbenen Verwandten oder eines Ahnen erhält, der Geist sanft gestimmt wird. Die Funktionen der Namensgebung sind vielfältig und sozial und psychisch wichtig. Deshalb sollte man den Namen wie dessen Träger respektieren. Dazu gehört auch, daß man über den Namen, und, was noch besser ist, auch über die Namensgebung der anderen Kultur Bescheid weiß. Oft enthalten Standardwörterbücher keine oder keine genügenden Einträge über Personennamen. Das vorliegende Lexikon soll die Suche erleichtern, auch wenn es sie nicht in allen Fällen überflüssig machen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Da jetzt über zwei Millionen Bürger türkischer Abstammung in Deutschland leben, und Teil der Gesellschaft geworden sind, ist es wohl an der Zeit, mehr und mehr Informationen über sie, ihre Kultur und Traditionen für alle zugänglich gemacht werden sollten. Eine der vielleicht wichtigsten Informationen über einen Menschen ist sein Name und wie er zu diesem Namen gekommen ist.
In vielen Kulturen wird dem Namen einer Person große Bedeutung beigemessen. Das Aussprechen eines Namens kann manchmal Glück und oft Unglück bringen, wenn er einem Toten gehört. Oder man gibt dem Kind den Namen einer bestimmten Person, in der Hoffnung, daß das Kind die gleichen Eigenschaften und die gleiche Bestimmung wie diese Person erlangt. Und manchmal will man, daß durch das Kind, das den Namen eines gestorbenen Verwandten oder eines Ahnen erhält, der Geist sanft gestimmt wird.
Die Funktionen der Namensgebung sind vielfältig und sozial und psychisch wichtig. Deshalb sollte man den Namen wie dessen Träger respektieren. Dazu gehört auch, daß man über den Namen, und, was noch besser ist, auch über die Namensgebung der anderen Kultur Bescheid weiß. Oft enthalten Standardwörterbücher keine oder keine genügenden Einträge über Personennamen. Das vorliegende Lexikon soll die Suche erleichtern, auch wenn es sie nicht in allen Fällen überflüssig machen kann.
Hier werden einige Grundregel und Gepflogenheiten bei der Namensbildung erläutert; soziale, geographische und historische Hintergründe zur Sprache gebracht; und die häufigsten Wörter und Wortteile in Namen aufgelistet.
Das Gebiet der heutigen Türkei wurde das erste Mal von einer türkischen Volksgruppe im 11. JH betreten, die einen beachtlichen Staat gegründet hatten. Dieser wurde nach seinem Gründer „seltschukisch“ genannt.
Die Seltschuken haben die damaligen Herrscher des Landes, die Byzantiner, zurückgedrängt und das größte Teil Anatoliens besetzt. Nach der Zerschlagung des seltschukischen Reichs, sind viele Fürstentümer entstanden. Eines davon, übrigens ein relativ kleines, hat sich durchgesetzt. Das waren die Osmanen. Diese haben schließlich dem byzantinischen Reich ein Ende gesetzt, und ein eigenes Weltreich etabliert, aus dessen Trümmern nach dem 1. Weltkrieg, die heutige Türkei entstanden ist.
Die Türken haben sich in Anatolien und später in eroberten Gebieten Balkans u.a. mit den dort lebenden Völkern gemischt. Das Osmanische Reich war ein Vielvölkerstaat. Es galt nicht die Nationalität sondern die Religion. Daher war es kein Problem, daß eine Russin als Sultans Frau oder ein Serbe als Großwesir die Geschicke des Landes mitbestimmten.
Nach dem ersten Weltkrieg strömten aus den verlorenen Gebieten viele Millionen Menschen in das Kernland, und mit ihnen viele unterschiedlichsten Namen zusätzlich zu denen, die bereits in Anatolien lebten.
Mehr als 100 Nationalitäten leben heute in der Türkei. Viele haben sich vollständig in die türkische Kultur integriert. Einige versuchen, die Reste ihrer Kultur zumindest in Vereinen lebendig zu erhalten. Manche der älteren Menschen sprechen noch ihre Heimatsprache, wenn auch brüchig.
Aber all diese Unterschiede leben teilweise in den Namen weiter. Daher ist die Schatzkiste von türkischen Namen voll gepackt mit endloser Form- und Bedeutungsvielfalt.
Hinzu kommt, daß die türkische Sprache in der Bildung von Personennamen viele Möglichkeiten hat, von denen auch Gebrauch gemacht wird.
Die Türken, die Anatolien das erste Mal betreten waren, waren nicht allzulange Zeit davor dem Islam übergetreten. In Zentralasien waren sie Angehörige verschiedener Glaubensrichtungen, manche z.B. Budhisten, aber hauptsächlich Schamanisten. Auch heute wird in Zentralasien unter vielen türkischen Volksgruppen Schamanismus praktiziert.
Nach der Begegnung mit Arabern wurden sie zum Islam bekehrt. Später in der Zeit des Osmanischen Reichs wurden sie Verfechter der Religion. Diese Teilung, Islam und Vor-Islam, zeigt sich vielleicht am stärksten in der Namengebung. Während der Islam das Symbol für den Konservativismus ist, ist die vorislamische Zeit das Symbol für das nationale Bewußtsein, für die Republik und für den Fortschritt.
Dennoch ist dieses Bild nicht zu sehr zu verallgemeinern. Heute vor allem sind die soziokulturellen Grenzen nicht deutlich gezogen. So sind islamische Namen nicht unbedingt Anzeichen für Konservativismus.
Der männliche Name „Demir“ (Eisen) z.B. stammt aus der vorislamischen Zeit. „Mehmet“ (die gekürzte Version des Namens des Propheten) dagegen ist der geläufigste Name der islamischen Zeit. Die könnten jedoch nicht unbedingt als symbolhaft für die Einstellung der Familie anzusehen, weil diese Namen sich zu sehr in der türkischen Kultur verankert haben. Die Konnotationen sind verwischt. Beide Namen sind gleichermaßen türkisch.
Andererseits ist der Unterschied in der sozialkulturellen Einstellung der Namengeber klar und deutlich, wenn es um Namen wie „Abdülvahab“ (Diener Wohltaten erweisenden Gottes) und Tamay (Vollmond) geht. Der Mond ist ein gebräuchliches Symbol im Schamanismus. Namen mit Mond gehören zu den ältesten der türkischen Kultur, während Abdülvahab arabisch ist. Die Bedeutung von Tamay ist damit jedem, der Türkisch spricht, zu verstehen. Was aber Abdülvahab bedeutet, wüßte oft nicht einmal der Träger dieses Namens.
Der islamische Kultureinfluß war in der Zeit des Osmanischen Reichs am stärksten. Die Sprache war durchsetzt mit arabischen und persischen Wörtern. Um literarische Werke von damals verstehen zu können, braucht man heute ganze Wörterbücher. Und sogar dann ist manches nur den Experten verständlich. Personennamen waren fast nur arabisch und persisch. Nach der Republiksgründung nahm der Anteil von Namen türkischen Ursprungs stark zu.
Die religiöse Einstellung ist nicht nur durch das Bildungsniveau geprägt, sondern auch dadurch, ob es sich um eine Familie aus der Provinz oder um eine städtische Familie handelt. Die Provinz, d.h. Dörfer, kleine und mittlere Städte, ist religiös-traditionell eingestellt. Da findet man mehr arabische und persische Namen. Aber auch in Großstädten, wo sehr viele Menschen aus der ärmlichen Provinz eingewandet sind, und wo sie ihre Lebensweise und Traditionen behalten haben, tragen viele Leute gleichfalls arabisch-persische Namen.
Die türkischen Namen werden immer mehr, auch aus dem Grund, weil neue Namen gebildet werden können. Der Namenschatz arabischpersischen Ursprungs ist beschränkt. Außerdem bei der Wahl von solchen Namen gilt, daß es solche sein müssen, die im Koran vorkommen, oder den Großen der Religion gehörten. Damit ist die Auswahl noch enger eingeschränkt.
Im Osmanischen Reich war es den Moslems verboten, nicht-moslemische Namen anzunehmen. Anders herum war es auch den Nicht-Moslems ver boten, moslemische Namen anzunehmen. Diese Verbotspraxis wurde auch nach der Gründung der Republik längere Zeit fortgesetzt. Nichttürkische Namen, z.B. kurdische o.a., durften nicht vergeben werden. Arabisch-persische zählten natürlich nicht dazu.
Trotzdem kam es vor, daß, sei es durch die Unachtsamkeit des Standesbeamten sei es durch die Unwissenheit, fremde Namen sich eingeschlichen haben. Und manchmal brachten Menschen ihre
Und jetzt, wo Millionen Türken außerhalb der Türkei leben und ihren Kindern lokale Namen geben, und gemischte Ehen Kinder mit fremden Namen hervorbringen, ist die Schatzkiste türkischer Namen viel größer geworden. So ist in Deutschland keine Seltenheit mehr, daß ein Kind türkisch-stämmiger Eltern Monika oder Melissa heißt.
Ein Grund bei der Verbreitung von arabisch-persischen Namen in der türkischen Gesellschaft und vor allem in der religiös-traditionellen ländlichen Gesellschaft war, daß Kinder nach Großeltern oder anderen nahen Verwandten genannt wurden. So gab es in einer Sippe vielleicht viele Alis, Ahmets und Mehmets, und in einer anderen viele Osmans, Süleymans und Hüseyins.
Die Väter und Mütter von heutiger Gesellschaft, die sich durch Bildung und durch Öffnung zur westlichen Kultur auszeichnen, ziehen leicht verständliche blumige Namen der rein türkischen Sprache. Den Namen „Yonca“ (Klee) ziehen sie dem Namen „Fazilet“ (arab.: Tugend) vor. Sie bilden neue Namen von Wortkombinationen wie „Gülen“ (lächelt) und „Gül“ (Rose). Jeder versteht das: „Rose, die lächelt“.
Bei der Bildung von rein türkischen Namen („rein“-türkisch im Gegensatz zu Namen aus dem Arabischen und Persischen) werden einige Wörter und Wortteile sehr häufig gebraucht, wie z.B.:
ak weiß
alp Held
bay Herr
bey Herr, edler Herr
can Leben, Herz
doğan Falke
er Mann, Krieger, Soldat
gül Rose, lächeln
gün Tag, Sonne
han Khan
kan Blut
kaya Stein
kor Glut, Feuer
kurt Wolf
san Ruf, Name
soy Herkunft, Geschlecht, Familie tan Morgendämmerung
tay Fohlen
türk Türke, Türkin
Es sind auch andere Wörter bzw. Wortteile, von denen man nicht genau weiß, ob sie mit ihrer Bedeutung oder mit einer Funktion an der Namenbildung beteiligt sind, wie z.B.:
sal kann „frei lassen“ oder „Floß“ bedeuten, aber auch die Endung sein, die vom Hauptwort ein Eigenschaftswort macht:
z.B. Oksal: (ok – Pfeil) kann bedeuten „laß ein Pfeil los!“ oder „auf ein Pfeil bezogen“ bzw. „vom Pfeil“.
sel kann „Flut“ bedeuten, aber auch die Endung sein, die ebenfalls vom Hauptwort ein Eigenschaftswort macht: z.B. „Göksel“ (gök – Himmel) kann bedeuten „Flut vom Himmel“ aber auch „himmlisch“ bzw. „vom Himmel“.
Bei uralten türkischen Namen, die oft von Titelbezeichnungen hergeleitet sind, kann es sein, daß die Bedeutung nicht immer klar zu ermitteln ist.
Die Möglichkeiten der türkischen Sprache sind sonst reichhaltig, so daß auch die Bildung, d.h. Erfindung, von seltenen Namen unproblematisch ist.
Nicht nur viele Wörter und Wortteile können miteinander kombiniert werden; sondern auch grammatische Endungen oder Prefixe können eingesetzt werden; z.B. von „sev“, der Grundform von „lieben“, kann abgeleitet werden: „Seven“ („wer liebt“ oder „liebende“), „Sevil“ („laß dich geliebt werden“ oder „mögest du geliebt werden“), „Sevsen“ („wenn du nur lieben würdest“), und sogar „Sevdi“ („sie/er hat geliebt“).
Auch Verneinungen kommen in der Namenbildung vor: „Ölmez“ („er/sie stirbt nicht“) ist z.B. ein Ausdruck des Wunsches in einem Land, in dem Kindersterblichkeit bis vor einiger Zeit nicht niedrig war, daß das Kind der Familie erhalten bleibt.
Die Possesivform „mein“ und „dein“ wird genauso in der Bildung von Namen eingesetzt: „Didem“ („meine Liebe“ oder „mein Auge“) oder „Eşim“ („meine Gefährtin“).
Eine Eigenschaft der Namenbildung mit türkischen Wörtern und Wortteilen ist die Mehrdeutigkeit, während die arabischen und persischen Begriffe als Personennamen keine Mehrdeutigkeit zulassen.
„Sezer“ z.B. kann als ein Wort verstanden werden, was dann bedeuten würde „wer fühlt“. Es kann aber auch als zwei Wörter begriffen werden: „sez“ („Stammform von „fühlen“) und „er“ („Mann, männlich, Soldat, Krieger“ usw.). Demnach würde es bedeuten: „Fühle es, Soldat!“ oder „der Mann, der es fühlt“ oder „Fühle es männlich!“ u.a. Was die Deutungsmöglichkeiten noch weiter ausdehnt, ist die Tatsache, daß dieser Name sowohl männlich als auch weiblich sein kann.
Deshalb wurde in diesem Lexikon darauf verzichtet, alle Interpretationen von Namen, die aus zwei (manchmal eventuell drei) Wörtern zusammengestellt sind, wiederzugeben. Auch nicht wurde es versucht, alle vorkommenden und möglichen Namen aufzunehmen, weil das ein nicht zu bewältigendes Unterfangen gewesen wäre.
Viele Namen in diesem Lexikon kommen auch als Familiennamen vor. Es war aber nicht das Ziel, daß das Lexikon ebenso Familiennamen enthielt.
Insbesondere bei Familiennamen wäre das Problem, daß viele anderen Sprachen außer Türkisch, Arabisch und Persisch ins Spiel kommen würden, und daß die etymologische Bestimmung nicht in allen Fällen möglich gewesen wäre.
Während Vornamen in vielen Fällen aus zwei oder nur aus einem Wort bestehen, können Nachnamen länger sein. Schon dadurch erhöhen sich die Möglichkeiten der Namenbildung, und dadurch die Tatsächliche Zahl von Nachnamen.
Die Schreibweise des Türkischen wurde vor ca. 70 Jahren revolutioniert; d.h. die arabische Schrift wurde durch die lateinische ersetzt. Das größte Teil des Wortschatzes, der aus arabischen und persischen Wörtern bestanden hatte, wurde eliminiert, und türkische Entsprechungen, die teils in der Volkssprache weiter gelebt hatten, und teils neu konstruiert wurden, wurden eingesetzt und deren Gebrauch in Schulen und in der Presse forciert.
Damit zusammenhängend ist die türkische Schreibweise heute eine „phonetische“, d.i. es wird geschrieben wie ausgesprochen. Nur arabische und persische Wörter, also auch Namen, haben wenige Buchstaben, z.B. „a“, die anders als türkische Buchstaben ausgesprochen werden. So gibt es langes „a“, langes „u“ und langes „i“. Für diese Buchstaben gibt es auch ein Längungszeichen. In der Praxis jedoch wird es kaum oder gar nicht mehr gebraucht. Auch die Aussprache dieser fremden Laute wurde in vielen Fällen türkisiert. Hier im Lexikon wurde ebenfalls auf den Gebrauch dieser Zeichen verzichtet.
Einige Namen der Türken, insbesondere die des religiösen Ursprungs, findet man auch in Deutschland, wie z.B. „Maria-Meryem“, „David-Davut“ oder „Jakob-Yakub“, mit etwas unterschiedlicher Schreibweise. Dann gibt es auch homophone Namen, also Namen, die gleich klingen oder sogar gleich geschrieben werden, die aber eine andere Bedeutung haben; z.B. „Kurt-Kurt“, wobei der türkische „Kurt“, „Wolf“ bedeutet.
Mehrere Gemeinsamkeiten:
Birgit (lautliche Ähnlichkeit) Danyal („Daniel“)
Deniz (nur lautliche Ähnlichkeit)
Denk (hat aber nicht mit Denken zu tun)
Havva (“Eva”)
İsa (“Jesus”)
İshak (“Itzhak”)
İsmail (“Ismail”)
Yusuf (“Joseph”)
Yunus (“Jonas”)
Musa (“Moses)
Nil (der Fluß Egyptens)
Nuh (“Noah”)
Namen sind nicht nur Laute oder kombinierte Buchstaben. Als solche würden sie uns nichts bedeuten. Laute, die schwierig zum Aussprechen sind, oder Wörter, aus denen man keine Laute hervorbringen kann, stellen Hürden dar, wenn wir mit unseren Nachbarn mit fremden Namen zusammen leben wollen. Namen, die etwas bedeuten, sind leichter zum Aussprechen und zum Buchstabieren. Namen, die etwas bedeuten, sind eine Spalte offene Tür in die geheime Welt unserer Nachbarn mit fremden Namen. Lassen Sie uns sie kennenlernen!
ALPHABET UND AUSSPRACHE DES TÜRKISCHEN
1. a a
2. b b manchmal assimiliert zu “p”
3. c wie in Dschunke; manchmal assimiliert zu “q” 4. ç wie in Tscheche
5. d d manchmal assimiliert zu “t”
6. e ä oder e
7. f f
8. g g in der Mundart dunkler
9. ğ Längung; Vokale, die davor kommen, werden länger ausgesprochen
10. h h manchmal dunkler ausgesprochen
11. ı wie in habe; auch bei Großbuchstabe ohne i-Punkt 12. i i auch bei Großbuhcstabe mit i-Punkt 13. j wie in Journalist; nur in wenigen Fremdwörtern 14. k k manchmal zu “g” assimiliert
15. l wie in Ball oder in Dunkel
16. m m
17. n n in der Mundart manchmal “ng”
18. o o klingt manchmal wie “u” im Deutschen
19. ö ö klingt manchmal wie “ü” im Deutschen
20. p p
21. r r oder “r-sch”; am Wortende mehr als wie “r-sch” ausgesprochen
22. s s wir immer scharf wie in “daß” ausgesprochen und nicht wie “Riese”
23. ş wie in Schiff
24. t t manchmal zu “d” assimiliert
25. u u
26. ü ü
27. v wie in Vanille
28. y wie in ja
29. z wie in See
Abbas m. Löwe, seriös (arab.)
Abdi m. von Dienern (Gottes; s. unten) (arab.)
Abdullah m. Diener Gottes (arab.)
Abdülazim m. Diener mächtigen Gottes (arab.)
Abdülaziz m. Lieblingsdiener Gottes (arab.)
Abdülbaki m. Diener allexistierenden Gottes (arab.)
Abdülbasir m. Diener allwissenden Gottes (arab.)
Abdülcabbar m. Diener allmächtigen Gottes (arab.)
Abdülcemal m. Diener großen und vollkommenen Gottes (arab.)
Abdülferit m. Diener einzigartigen Gottes (arab.)
Abdülfettah m. Diener lebensspendenden Gottes (arab.)
Abdülgaffar m. Diener vergebenden Gottes (arab.)
Abdülhalik m. Diener erschaffenden Gottes (arab.)
Abdülhalim m. Diener sanftmütigen Gottes (arab.) Abdülhamit m. Diener Lob und Preis gebührenden Gotte (arab.)
Abdülkadir m. Diener allmächtigen Gottes (arab.)
Abdülkerim m. Diener großherzigen Gottes (arab.)
Abdüllatif m. Diener gnädigen Gottes (arab.)
Abdülmelik m. Diener das Universum beherrschenden Gottes (arab.)
Abdülvahap m. Diener Wohltaten erweisenden Gottes (arab.)
Abdülvahit m. Diener einzigen Gottes (arab.)
Abdürrahim m. Diener barmherzigen Gottes (arab.)
Abdürrahman m. (s. oben)
Abdürrezzak m. Diener allernährenden Gottes (arab.)
Abdüsselam m. Diener friedensgewährenden Gottes (arab.)
Abidin m. wer anbetet (arab.)
Abuzer m. Goldwasser (pers.)
Aca m. Onkel, stark, groß
Acabey m. (s. oben; bey: Herr)
Acahan m. (s. oben; han: Herrscher, König)
Acar m. stark, mutig
Acarbey m. starker, mutiger Herr
Acarkan m. starkes, mutiges Blut
Acarman m. starker, mutiger Mann
Acarsoy m. starkes, mutiges Geschlecht
Acatay m. starkes Fohlen
Acuner m. Welt-Mann
Acunman m. (wie oben)
Açanay w. aufgehender Mond
Açangonca w. aufgehende Blüte
Açangül w. aufgehende Rose
Açıkalın m. offener Stirn (nicht zu verbergen, ehrlich)
Açıkel m. offene Hand (großzügig)
Açıker m. offener Mann Açılay w. geh auf, Mond!
Açılgül w. geh auf, Rose!
Adahan m. Insel-König
Adak w. m. Gelübde, Votivopfer
Adal w. m. nimm einen Namen an!
Adalan m. wer einen Namen annimmt
Adalet w. Recht
Adalettin m. Recht
Adamış m. wer ein Gelübde abgelegt hat
Adanan m. wer versprochen worden ist
Adanır m. (s. oben)
Adanır w. wird versprochen
Adanmış w. wurde versprochen
Adar m. wer ein Gelübde ablegt
Adar w. legt ein Gelübde ab
Adasal m. von der Insel
Adem m. Adam
Adıgüzel w. sein Name ist schön
Adıvar m. er hat einen Namen
Adil m. gerecht
Adile w. Gerechte
Adilhan m. gerechter König
Adlı m. mit Namen, bekannt
Adnan m. vom Paradies
Adsız m. ohne Namen, unbekannt
Afet w. absolut schöne (arab.)
Afife w. Ehrliche (arab.)
Afitap w. schön wie Sonne (pers.)
Afşar m. ein türkisches Volk
Afşin m. Waffe, Panzerkleidung Agah m. wissend (pers.)
Ağa m. älterer Bruder, Landbesitzer, ein Titel
Ağahan m. Landbesitzer-König
Ağan w. m. Sternschuppe
Ağca m. ähnlich wie weiß
Ahi m. Freund, Bruder
Ahmet m. der Hochgepriesene (arab.)
Ahsen w. Schönste (arab.)
Ahu w. die mit Rehaugen
Ajda w. junger Sproß
Aka m. älterer Bruder, Respektperson
Akad m. weißer Name (ehrliche Person)
Akalın w. m. die mit weißem Stirn (ehrlich) (arab.)
Akalp m