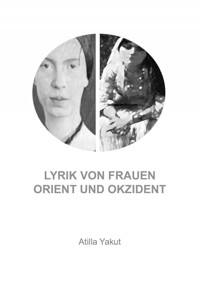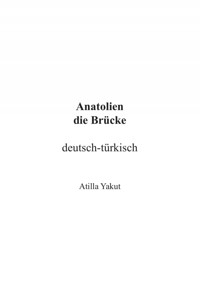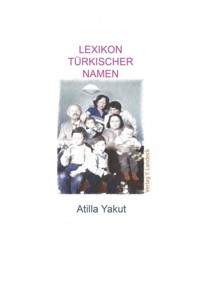Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In der folgenden Sammlung von unterschiedlichen Thesen, die im Bereich der Sprachentwicklung und Sprachphänomene der Immigration in Deutschland aufgestellt wurden, wird der Schwerpunkt hauptsächlich darauf gelegt, wie die Familienstruktur und Zweisprachigkeit innerhalb einer nicht-zweisprachigen Gesellschaft auf einander wirken können. Es wurde versucht, die besondere Bedeutung der Familie in der Sprachentwicklung im Hinblick auf die Zweisprachigkeit zu analysieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
S o z i o l i n g u i s t i k
d e r
t ü r k i s c h e n
I m m i g r a t i o n
Atilla Yakut
Verlag Y. Landeck
Laubenweg 11
69123 Heidelberg
Es hängt alles von der
Sprache ab
Inhalt
Vorwort
Grundwissen: türkische Familie
Grundwissen: türkische Sprache
Die Bedeutung der Familie für das Lernen Einflüsse des Deutschen
Familiensprache und Deutschunterricht Familiolekt und die Methodik
Family Language and the SLA
Funktion und Organisation
Familien-, Immigranten- und Standardsprache Landeskunde und Sprachvergleich
Linguistische Aspekte
Sprachumwelt der Immigranten
Türkisch als Fremd- und Zweitsprache Projekt „Zweisprachige Schülerzeitung“
Vorwort
In der folgenden Sammlung von unterschiedlichen Thesen, die im Bereich der Sprachentwicklung und Sprachphänomene der Immigration in Deutschland aufgestellt wurden, wird der Schwerpunkt hauptsächlich darauf gelegt, wie die Familien-struktur und Zweisprachigkeit innerhalb einer nicht-zweispra-chigen Gesellschaft auf einander wirken können. Es wurde versucht, die besondere Bedeutung der Familie in der Sprachentwicklung im Hinblick auf die Zweisprachigkeit zu analysieren. Denn die Familie in einer „feindlichen“ Umgebung, wie die deutsche Gesellschaft zu bezeichnen wäre, weil sie auf die Entstehung der Multikulturalität und Multisprachlichkeit nicht vorbereitet war, klare Konturen der Anpassungsbemühun-gen zu Tage befördert.
Daß die Zweisprachigkeit ein sozialisatorisches Naturphänomen ist, wurde auch in diesem Rahmen ausdrücklich betont, obwohl die Zweisprachigkeit beinahe in den meisten Ländern eine aner-kannte und respektierte Eigenschaft der Gesellschaft angesehen wird. Daß dies in Deutschland erst in Erinnerung gerufen und belegt werden muß, ist eine traurige Tatsache. Wie sich die Immigration auf die deutsche Gesellschaft auswirkt hat, wird noch längere Zeit ein Untersuchungsthema werden. Auf die Sprachentwicklung der Immigranten bezogen ist es klar zu erkennen, daß die Zweisprachigkeit einen Fuß in Deutsch-land gefaßt hat.
Lediglich ist die zweisprachige Erziehung noch weit zurück von der Notwendigkeit und sozialen Gerechtigkeit. Auch die Instru-mentarien einer solchen Erziehung noch nicht in einem prakti-zierbaren Umfang ausgearbeitet. Da blickt man etwas hilflos auf die beiden nord-amerikanischen Länder, die länger Erfahrungen mit solchen Problemen gesammelt haben. Die türkischen Immigranten wurden meistens als Hauptproblem in Deutschland angesehen. Die türkische Immigrantenfamilie war sozusagen die Brutstelle dieser Probleme. Heute noch sind Äußerungen in dieser Richtung zu hören, was die Verzweiflung berechtigen würde, ob und wann überhaupt die Immigration in Deutschland mit ihren ganzen Begleiterscheinungen und Kon-sequenzen von der Gesellschaft und Politik akzeptiert werden würde. Von dieser Akzeptanz hängt es ab, daß Erziehungs- und Sozialisationsarbeiten und die diesbezügliche Forschung hand-feste Ergebnisse liefern.
Grundwissen: türkische Familie
Die Türken der heutigen Türkei, aus Anatolien und Ostthra-kien, haben ihr jetziges Land, Anatolien, erst im 11. Jh. in Besitz genommen. Sie hatten etwa ab dem 9. Jh. den isla-mischen Glauben angenommen. Die Türkei-Türken haben also eine sehr lange Geschichte, die nicht arabisch und nicht islamisch ist. Sie unterscheiden sich daher in wesentlichen
Zweisprachigkeit ist ein
Grundrecht
Merkmalen von den anderen islamischen Völkern wie z. B. den Arabern.
Diese vorislamische Zeit, die hauptsächlich in Zentralasien und in Turkistan sich abspielte, ist im wesentlichen dadurch gekennzeichnet, daß die Familie, u. a. bedingt durch den Nomadis- mus, eine gesellschaftsfundamentale Rolle spielt (z. B. Familieneigentum statt Privateigentum) und daß die Frau gegenüber dem Mann in der Gesellschaft eine ega-litäre Stellung hat. Verschiedene Quellen, unter anderem auch Berichte ausländischer Besucher in den vorisla- mi-schen türkischen Staaten, liefern ein Bild der für unser Ver-ständnis liberalen Familienverhältnisse und einer liberalen Kindererziehung, deren wichtigste Basis war, daß die Frau und Mutter eine der Gesellschaft gegenüber mitgestaltende Rolle in der Familie besaß.
Die Besucher aus der islamischen Welt erstaunten (und entsetzten!) sich über die Freizügigkeit und Liberalität der Frauen. Sie durften selbständig Geschäfte abschließen, zu Pferd reiten, reisen, unbehindert und unbelästigt in der Öffentlichkeit auftreten. Die sexuellen Delikte gegenüber Frauen wurden schwer bestraft; für die Vergewaltigung ei-ner verheirate- ten Frau z. B. galt die Todesstrafe. Auch die Töchter und Söhne einer Familie waren gleichberechtigt. Von einem Herrscher wird berichtet, daß er dem Gott seine Dankbarkeit für die Geburt seiner Tochter aussprach. Töch-ter durften auch zu Herrscherinnen werden, sie durften ih-ren Ehepartner selbst wählen. Polygamie war nicht bekannt. Nach einer Theorie war die ursprüngliche Familienform in Zentralasien unter den Türken sogar matriarchalisch und entwickelte sich erst dann zu einer egalitären Form. In völligem Gegensatz dazu steht die islamisch-patriarcha-lische Familie im islamischen Staat der Osmanen, der etwa 600 Jahre bestand: Die Familienform wurde durch die Re-ligion tief geprägt; damit änderten sich auch die Vorstellun-gen von der Kindererziehung.
Allerdings sind hier die städtische Bevölkerung, d. h. die mittlere und obere Schicht, und die ländliche Bevölkerung, d. h. Bauern, zu differenzieren. Während die Bauern vie-le der Gesellschaftseigenschaften der vorislamischen Zeit nicht aufgaben und sogar heute noch beibehalten, verstärk-ten die privilegierten und gebildeten Schichten manche Regeln des Islams bezüglich des gesellschaftlichen Lebens noch. So wurde z. B . der Schleier für die Frauen von vor-nehmen osmanischen Familien eingeführt und kurz danach von städtischen Frauen imitiert. Heute sieht man in der Türkei vor allem in Kleinstädten noch verschleierte Frau-en, die hinter ihren Männern gehen, während Dorffrauen unverschleiert neben Männern arbeiten. Da in der Regel die gehobene Klasse der Osmanen zuerst härtere (und nicht un-bedingt vom Koran vorgeschriebene) islamische Praktiken einführte, wurde vieles im Sinne eines Statussymbols und nicht in erster Linie als Gebot der Religion von der übrigen städtischen Bevölkerung übernommen. So z. B. hatten sich die Braut und der Bräutigam bis nach dem Vollzug der Ehezeremonie nicht gesehen. Die Braut-suche erfolgte über die Verwandten. Oft war die Braut so-gar bei dem Akt der Eheschließung nicht anwesend, son-dern wurde durch einen männlichen Verwandten vertreten. Die osmanische Frau verbrachte ihr ganzes Leben einge-schlossen im Haus, in dem getrennte Quartiere für Frau-en (haremlik) und für Männer (selamlik) existierten. Das Frauenquartier hatten nicht nur die Ehefrau bzw. Ehefrauen des Hausherrn, sondern auch Sklavinnen und Hausdiene-rinnen zu teilen. Zwischen beiden Quartieren und an den Fenstern waren Holzgitter angebracht, durch die die Frauen die anderen betrachteten, ohne daß sie selbst gesehen wer-den konnten. Auch die Scheidung unterlag den Regeln des Korans, das heißt, sie mußte nicht vor einem Gericht er-folgen, sondern das Wort des Mannes „ich stoße dich aus“ genügte. Deswegen war die Lage der Frau, die über keine wirtschaftliche Selbständigkeit mehr verfügte, nur dann sicher, wenn sie ein Kind oder mehrere Kinder hatte. Die Mutter des ersten Sohnes hatte sogar die befehlende Rolle im Frauenquartier.
Auch das Leben der Kleinkinder spielte sich im Frauen-quartier ab. Die Kindererziehung war nicht nur die Auf-gabe der Mutter, in größeren Haushalten reicher Familien sogar gerade nicht die der Mutter, sondern die Aufgabe der Dienerinnen und Sklavinnen. Dazu kam, falls die Mutter selbst nicht stillen konnte, eine Amme. Diese hatte eine besondere Rolle: Nach dem Koran existiert eine „Milch-verwandtschaft“; danach gelten die Amme und das gestill-te Kind wie Mutter und eigenes Kind, die Eheschließung zwischen „Geschwistern“ ist beispiels- weise ausgeschlos-sen. Die Kindererziehung der osmanischen Zeit war durch die folgenden Prinzipien charakterisiert: Strenge Trennung der Mädchen von den Jungen, mit der späteren völligen Isolierung der ersteren, Unterwerfung unter die religiösen Vorschriften und die Einflüsse der Priester und letztlich die Pflege einer Dekulturalität und/oder Multikulturalität. Das Prinzip nationaler Erziehung wurde erst nach der Grün-dung der Republik und nach den türkischen Reformen an-genommen. Diese Reformen haben das Leben in der Stadt von Grund auf verändert.
Es begann damit, daß das Rechtssystem statt nach dem Ko-ran nun nach der westlichen Rechtsauffassung modelliert wurde. So wurde das Zivilrecht der Schweiz mit wenigen Änderungen übernommen. Das hatte enorme Folgen vor al-lem für die Frauen. Die Scheidung z. B. mußte gesetzlich entschieden werden; das Wort des Ehemannes reichte nicht mehr. Dies stärkte die Stellung der Frau in der Gesellschaft, aber auch in der Familie. Die Gleichstellung der Frau ge-genüber dem Mann wurde gesetzlich verankert und auch in der Praxis vom Staat systematisch unterstützt. Als die Frauen in einigen Ländern Europas noch für sich um das Stimmrecht kämpften, durften die Frauen in der Türkei be-reits wählen und gewählt werden.
Bauern-Arbeiter-Familien in der Türkei heute Die eigentliche Volksmasse, das heißt die Landbevölke-rung, war jedoch weder in der Zeit der Osmanen noch nach der Republik einer Radikalisierung ihrer Lebensweise aus-gesetzt. Während die Osmanen ihre Kultur einfach igno-rierten, erklärten die Republikaner sie zum Maßstab. Das gewohnte Leben im Dorf setzte sich aber nach den Tradi-tionen fort.
Mit der Industrialisierung und dem enormen Zustrom der Bauern in die Städte in den letzten 50 Jahren geriet ein Teil der Landbevölkerung in den eigentlichen Wirkungskreis der gesellschaftlichen Änderungen. Diese Veränderungen wurden jedoch nur zum Teil wirksam: Die in die Städte ausgezogenen Dorffamilien lebten weiterhin „mit einem Fuß im Dorf“. Sie behielten alle ihre Verbindungen zum Dorf, sogar ihre Felder, die sie immer noch selbst bestellten oder durch ihre Verwandten bestellen ließen. Ein ständiges Pendeln der Familienmitglieder und Verwandten zwischen der Stadt und dem Dorf kennzeichnet diese neue Schicht in den Städten. Man kann daher heute im Dorf und in der
Stadt Erziehungsvorstellungen und -praktiken gleichen
Ursprungs begegnen. Andererseits sickern westlich
geprägte Vorstellungen und Regeln allmählich in die
sich überschneidenden Bereiche durch. So werden bei-
spielsweise die Hochzeiten in diesen Bauern-Arbeiter-
Familien in der Stadt manchmal auf der Straße wie im
Dorf und manchmal in Hallen mit westlicher und tür-
kischer Musikgefeiert.
Die meistverbreitete Familienform in der Türkei so-
wohl auf dem Lande als auch in der Stadt ist die Kern-
familie. Nur im Schwarzmeergebiet, in dem der Boden
zwar sehr fruchtbar, der einzelne Betrieb aber klein
und dadurch nicht wirtschaftlich teilbar ist, herrscht die Großfamilie vor.
Die Familienform, die von den meisten, auch von den Kernfamilien, gewünscht wird, ist aber die Großfami-lie. Für diesen Wunsch sind nicht die ökonomischen Gründe maßgebend, sondern es handelt sich um ein Gesellschaftsideal. Obwohl die Großfamilie durch die zunehmende Beschäftigung von Arbeitskräften im industriellen Sektor ihre Funktion als Produktionsge-meinschaft weitgehend verloren hat, bleibt die (Kern-) Familie eingebettet in ein enges Netz verwandtschaft-licher Bindungen, wird beispielsweise die Versorgung alter, kranker oder erwerbsloser Familienmitglieder oder die Erziehung der (Klein-)Kinder als gemein-schaftliche Aufgabe der Familie gesehen, orientieren sich die Erziehungsvorstellungen vieler Familien an denjenigen der Großfamilie.
Bei der Gründung einer Familie spielen die Verwandten und vor allem das Familienober- haupt in Großfamilien eine wichtige Rolle. Selbst wenn die Entscheidung in der Partnerwahl nicht direkt von ihnen getroffen wird, kann der Heiratskandidat die Wünsche seiner älteren Familienmitglieder und Verwandten nicht völlig außer acht lassen, denn in der Bauern-Arbeiter-Familie ist ebenso wie in der dörflichen Familie die Familiengrün-dung haupt- sächlich von der finanziellen Hilfe der El-tern und Verwandten abhängig.
Heiraten ist nach der islamischen Lehre eine gute Tat. So wird erwünscht, daß sowohl die Söhne als auch die Töchter so bald wie möglich verheiratet werden. Für die Töchter wird oft das erstbeste Angebot akzeptiert; für Männer ist die Zeit nach dem Militärdienst gekommen. Daß der Sohn nach der Entlassung aus dem Militärdienst zu lange „freibleibt“, wird nicht gern gesehen: Man glaubt, daß das selbstaufer-legte Zölibat die Moral der jungen Männer unterminiert. Trotz vieler strenger Regeln haben der Islam und die Tra-dition der türkischen Gesellschaft eine recht liberale Hal-tung gegenüber der Sexualität. So ist sie auch unter Frauen ein offenes Gesprächsthema. Die Beschneidungen werden auch von Frauen mit Aufmerksamkeit beobachtet; über die Geschlechtsorgane ihrer beschnittenen Söhne werden von stolzen Müttern gelegentlich Witze gemacht. Körperkon-takt (z. B. Umarmen) ist häufig und üblich, auch beispiels-weise unter Männern.
Auch das Verhalten zwischen dem Ehemann und der Ehe-frau, die oft als die zwischen dem Dominierenden und der Dominierten interpretiert wird, ist stark normgebunden und nicht an erster Stelle ein Ergebnis der Unterwerfung der Frau. Ein Forscher beschreibt diese Beziehung als „duo-focal“: Das heißt, die Familie hat zwei Zentren, eines ist der Mann, ein anderes die Frau; jeder von ihnen reguliert die Aktivitäten im jeweiligen Wirkungskreis. Männer- und Frauenwelt sind im Dorf durch ihre Funktion im allgemei-nen klar getrennt. Nur dort, wo Mann und Frau gemein-sam auftreten, erscheint der Mann als Autoritätsträger. Die
Aufgaben im öffentlichen Leben sowie die Vermittlerrolle zwischen Haus und Öffentlichkeit werden vom Mann wahr-genommen; er repräsentiert die Familie nach außen. Seine Aufgabe ist es auch, die Ehre seiner Familie gegenüber anderen zu verteidigen (s. dazu den Materialteil). Ob die türkische Gesellschaft von einer Gleichstellung von Mann und Frau weiter entfernt ist als die Gesellschaften westli-cher Industriestaaten, kann hier nicht entschieden werden (es sei dazu auf den Materialteil und die Diskussionsanre-gungen verwiesen). Im wesentlichen unterscheidet sich die türkische (Kern-)Familie von der Familie westlicher, indu-strialisierter Gesellschaften dadurch, daß die gemeinsamen Aktivitäten des Ehepaars sehr begrenzt bleiben. Nach man-chen Forschern ist die türkische Frau in der isolierten Welt einer Kleinstadt in der ägäischen Region sogar in vieler Hinsicht selbständiger als die sogenannten emanzipierten Frauen in Europa und Amerika.
Während in der städtischen Familie Belastungen durch körperliche Arbeit praktisch nicht mehr existieren, muß die jungverheiratete Frau in der Dorffamilie auch die schwer-sten Arbeiten allein erledigen können: Holzfällen, Weizen-säcke auf dem Rücken zur Mühle tragen u. a. Nicht selten geht die schwangere Frau bis zum letzten Moment noch auf das Feld arbeiten. Ihre Wünsche werden allerdings mehr als vorher beachtet. Vor allem sorgt man dafür, daß sie alles zum Essen bekommt, was ihr Appetit macht: Man glaubt, daß die Befriedigung der Bedürfnisse der werdenden Mut-ter auf das Baby übertragen wird.
Nicht zuletzt wegen der großen Arbeitsbelastung ist der Anteil der totgeborenen Kinder auf dem Lande höher als in der Stadt. Die Sterbefälle bei Säuglingen sind in den letzten Jahrzehnten allerdings dank eines umfangreichen Mutter- und Babyprogramms zurückge- gangen, obwohl die Säug-lingspflegepraktiken im Dorf sich relativ wenig geändert haben. So wird z. B. der Säugling noch in vielen Dörfern in seinem Schaukelbett oder seiner Wiege auf eine Schicht von Erde gelegt, die die Nässe aufsaugen soll. Die Geburt eines Sohnes ist ein großes Ereignis; die Ge-burt einer Tochter dagegen nur ein fröhliches Ereignis. Als maßgebend dafür gilt, daß die Eltern eine Altersver-sorgung mehr von ihren Söhnen erwarten können als von ihren Töchtern. Die islamische Lehre schreibt dagegen vor, die Kinder, Söhne und Töchter, gleich zu behandeln. Ande-rerseits aber, auch unter Berufung auf den Koran, werden Söhne häufig länger gestillt als die Töchter. Alle Kinder ha-ben jedoch ein Recht darauf, eine bestimmte Zeit gestillt zu werden; sonst haben sie als Erwachsener einen Anspruch auf einen „Schadensersatz“ bei der Mutter.