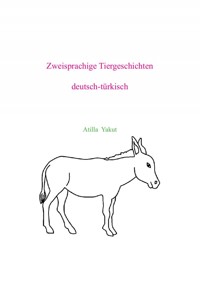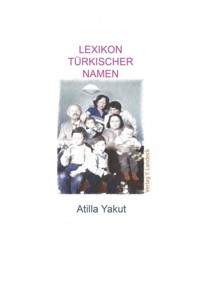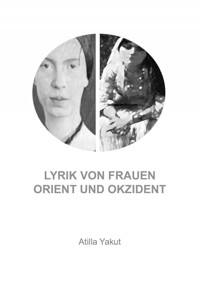
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es stellte sich heraus, daß essentielle Ähnlichkeiten zwischen westlichen und östlichen Dichterinnen bestehen. Ist es die Frauenseele oder eigentlich mit wenigen Differenzen die Stellung der Frau in der Gesellschaft, die diese Ähnlichkeiten hervorrufen? Es ist jedenfalls nicht schwierig, vom Werk einer okzidentalen Künstlerin zum Werk einer orientalischen Künstlerin hinüber zu gleiten. Man ist immer noch im Reich der Frau.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 113
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LYRIK VON FRAUEN
ORIENT UND OKZIDENT
Atilla Yakut
Verlag Y. Landeck
Laubenweg 11
69123 Heidelberg
Frau ist das Licht des Lebens (Mevlana)
Lyrik ist die Natur der Frau
(Anonym)
Inhalt
Vorwort
Eine Dichterin aus Amerika
Dichterin des Orients
Dichterin des Okzidents
Vorwort
Es ist nicht verwunderlich, daß Emily Dickison einer der primären Namen ist, auf den man in einer Studie zu „Frauen als Dichtungskünstler“ trifft. Deshalb liegt der entsprechende Teil der vorliegenden Abhandlung weiter zurück und ist umfangreicher ausgefallen. Die Abhandlung baut sich also um Emily Dickinson herum bzw. auf Emily Dickinson darauf. Allerdings ist der Um- bzw. Aufbau nicht konsekutiv strukturiert sondern eher assoziativ. Es ist nicht ein Vergleich zwi-schen Dickinson und anderen Dichterinnen. Es ist auch kein Vergleich zwischen den Dichterinnen des Ostens und Westens.
Aber die Beschäftigung mit Dickinson führt unweiger-lich dazu, um sich Gedanken zu machen, wie es wohl bei anderen Dichterinnen ist. Gibt es kulturelle Unterschie-de? Ist die feminine Poesie von der Kultur des Landes geprägt? Gibt es auch Ähnlichkeiten? Ohne das alles vergleichen zu wollen, führt ein Beispiel auf das andere weiter. Und auch ohne Vergleiche anzustellen, werden viele Punkte etwas klarer, die die Poesie der Frauen ausmachen. Insbesondere läßt ein näherer Blick auf die Frauen, die im Osmanischen Reich, in Anatolien, in der islamischen Kultur insgesamt, viele Fragen aufkommen, die nicht abschliessend behandelt aber mit Beispielen verdeutlicht werden.
Zunächst wurden hier kulturell bedingt Dependenzen in der türkischen Literatur und insbesondere in der der vorrepublikanischen Zeit gesucht. Davon ausgehend wurden Beispiele aus anderen Kulturen mit einbezo-gen.
Es stellte sich heraus, daß essentielle Ähnlichkeiten zwischen westlichen und östlichen Dichterinnen beste-hen. Ist es die Frauenseele oder eigentlich mit wenigen Differenzen die Stellung der Frau in der Gesellschaft, die diese Ähnlichkeiten hervorrufen? Es ist jedenfalls nicht schwierig, vom Werk einer okzidentalen Künstlerin zum Werk einer orientalischen Künstlerin hinüber zu gleiten. Man ist immer noch im Reich der Frau. Anatolien und Mesopotamien waren die bisher uns be-kannte Wiege der Prägung des weiblichen Bewußtseins in der Gesellschaft. Die Muttergottheit Kybele und ihre Vorgängerinnen waren hier heimisch. Die erste bekannte Dichterin Enheduanna, die sumerische Priesterin, hat hier gelebt. Männer und Frauen haben hier Jahrtausende lang gemeinsam und in Kooperation mit einander das Gesellschaftsleben aufgebaut. Die Frauen waren Prieste-rinnen, Herrscherinnen und eben auch Dichterinnen. Die Brautkammer wartet auf dich. Gehe hinein und fülle dein Herz auf!
Ich habe alles getan, was ich kann. Ich habe dir gesun-gen, Herrin.
Was ich mitternacht gesungen habe, laß die Sänger es wiederholen in der Mittagszeit! (Enheduanna) Für manche ist die Rolle nicht ausreichend stark, die die Frauen in der Literatur und insbesondere in der Dichtkunst im Orient gespielt haben. Von den Frauen der Hethiter oder von Urartu liegen keine Gedichte vor. Sogar die Frauen von vorislamischen arabischen Gebieten haben wenig zurückgelassen. Hauptsächlich Trauerlieder waren das. Im Singen der Trauer sind nicht nur arabische sondern auch türkische und kurdische Frauen in diesem Gebiet Expertinnen. Ein männlicher Mann trauert wohl nicht.
Das osmanische Reich hat ebenfalls während 6 Jahrunderte seines Bestehens relativ wenig Dichterinnen hervorgebracht. Das gilt allerdings für schriftlich über-lieferte Werke. Was und wieviel Bäuerinnen gesungen und gedichtet haben, wurde bis jetzt kein Forschungs-thema. Die anonyme Literatur des Volkes hat immer die sogenannte Hofliteratur überragt.
Die Werke der Frauen der letzteren Gruppe wurden in Anthologien ihrer Zeit aufgeführt. Sie hiessen z.B. Zey-nep Hanım (hohe Dame), Mihri Hatun (Herrin), Adile Sultan (Prinzessin) oder Leyla Hanım. Diese Frauen waren allesamt Angehörige höherer Ge-sellschaftssichten und des Hofes. Manche waren sogar Töchter und Ehefrauen von Religionsgelehrten und der obersten Religionsrichter. Einige dagegen gehörten Re-ligionsorden an, die allerdings nicht christlichen Orden entsprechen sondern eine lose Bindung mit vielen ihren Mitgliedern hatten, so daß es Frauen möglich war, Fa-milienleben zu führen und Lyrik zu verfassen. Dichterinnen dieser Zeit benutzten die literarischen Techniken ihrer männlichen Zeitgenossen. Man kann ihnen aber nicht vorwerfen, ihre Lyrik den Regeln der männlichen Literatur unterworfen zu haben. Denn diese Regeln waren standardisiert, und man hat erwartet, daß jeder oder jede sich an die Regel hielt. Es wird Mihri Hatun als eine Dichterin erwähnt, die sich mit eigenen Techniken etwas aus der Reihe gekommen zu sein. Fest steht allerdings, daß, was das System auch immer verlangt haben, die Frauen in irgendeiner Form ihren weiblichen Stempel auf ihre Werke gedrückt ha-ben.
Ihre Sorge, als Dichter Anerkennung zu finden, und deshalb die Regeln zu beachten, die gleiche Metaphorik einzusetzen, die gleiche Wortwahl zu benutzen, kann man nur anerkennen.
Daß manche sogar ihre Identität als Frau von der Öf-fentlichkeit versteckt haben, ist angesichts ihrer Lage in der Gesellschaft nur verständlich. Eine Schlußfolgerung für den konservativen Druck der Gesellschaft läßt sich hier nicht zu.
Nach der Sprachreform der Republik Anfang des 20. Jahrhunderts, wurde die arabische Schrift abgeschaft und damit die ganze Literatur der vorrepublikanischen Zeit zur Unverständlichkeit degradiert. Man hat während der Refom versucht, alle Fremdelemente, sprich arabische und persische Wörter mit türkischen, ja sogar zum Teil mit „urtürkischen“ auszutauschen. Deshalb braucht man heute eine besondere Ausbildung und dicke Wörter-bücher, die Lyrik dieser Frauen zu verstehen. Manche behaupten, daß nur eine gewisse Vertrautheit mit dem Regelwerk der damaligen Literatur eine Verständlichkeit ermöglicht. Das kann nur bis zu einem gewissen Grade akzeptiert werden.
Diese Dichterinnen waren selbstverständlich auch in den Sprachen Arabisch und Persisch ausgebildet. Das osma-nische Reich war ein Vielvölkerstaat und die Sprachen Arabisch und Persisch waren in der Kultur, zumindest in der des Hofes und der gebildeten Schicht, verankert. Die Dichterinnen haben naturgemäß von diesen Sprachen und deren Literatur Gebrauch gemacht. Die Städte, in denen die Dichterinnen gelebt haben, waren die Kulturzentren des Reiches. Viele Künstler und Gelehrte lebten in ihrer Umgebung, auch die aus arabischer und persischer Kultur.
Die herrschende Klasse hat traditionell die Künste pro-tegiert und gefördert. Auch die Dichterinnen haben von dieser Förderung profitiert.
Auch in den Höfen arabisch-islamischer Dynastien war die Lyrik der Sprache des intellektuellen Lebens. Dichter konnten berühmt und reich werden. Das galt auch für Dichterinnen, solange sie den oberen Schich-ten angehörten. Durch literarische Tätigkeit konnten sie im gesellschaftlichen Status aufsteigen. Auch in jenen Zeiten hatten Konventionen in der Literatur einen hohen Stellenwert. Die Frauen allerdings konnten nicht nur die Konventionen beachten; sie konnten auch darüber hinaus mit Metaphern und anderen Ausdrucksmöglichkeiten spielerisch umgehen. Das brachte ihnen Anerkennung, während ihre männlichen Zeitgenossen sich diese Frei-zügigkeit weniger leisten konnten.
Diese Frauen haben ihre Weiblichkeit geschickt in ihre Werke übertragen, Beschreibungen und Andeutungen ihres Körpers und ihrer Liebesbeziehungen taktisch-literarisch in der Lyrik einsetzen.
Was die Stellung der türkischen Dichterinnen angeht, ist es ratsam, die geschichtliche Entwicklung anzuschau-en.
In der Gesamtheit der Gesichte der Türken, von Zen-tralasien bis zur heutigen Türkei, haben Frauen eine hervorgehobene Rolle im gesellschaftlichen Leben inne gehabt.
Nur die Einführung des Islam hat einige wesentliche Veränderungen verursacht.
Dabei ist zu beachten, daß sowohl die Türken in Zen-tralasien als auch die Türken im osmanischen Reich nicht die Gesamtheit representierten, weil andere Nationen und andere Kulturen ein Teil der Gesellschaft bildeten. Die heutigen nationalen Staaten sind ja eine relativ neue Erfindung. Die Nationalität haben in der Geschichte keine grosse rolle gespielt.
In zentralasiatischen Türkischen Staaten haben die Ehefrauen der Herrscher beinahe die gleichen Rechte wie ihre Ehemänner gehabt. Die Erlasse der Könige wurden im Namen beider verkündet. Die verstorbenen Herrscher wurden in Inschriften nur Mann und Frau zusammen erwähnt.
In den epischen Werken und in der Mythologie wurden Frauen beschrieben, die in Nichts den Männern unterla-gen. Neben den männlichen Gottheiten gab es weibliche Gottheiten, die heute noch in irgendeiner Form sich in den Kulturpraktiken sichtbar machen. Insbesondere die Mütter genossen ein hohes Ansehen und hatten einen wirksamen gesellschaftlichen Status. Die Rechte der Mütter wurden machmal den Rechten der Götter gleich gesetzt. Die Erbrechte waren gleicher-maßen verteilt. Die Geburt eines Mädchens war keine Schande, wie es in manchen Kulturen heute der Fall ist. Gegebenenfalls wurden Töchter wie Söhne erzogen und im Waffeneinsatz trainiert.
In Schlachten, wenn es sein mußte, haben auch Ehe-frauen und Töchter teilgenommen und mitgekämpft. Die Waffenkenntnis und Kampferfahrung waren und heute noch sind eine Notwendigkeit für die Frauen der Nomaden, wie die Türken zum größten Teil in Zentrala-sien waren.
Die türkische Frau jener Zeit konnte reiten, mit Pfeil und Boden umgehen und Heldentaten hervorbringen. Reiten ist genauso in Anatolien auf dem Lande eine Fä-higkeit, auf die viele Frauen nicht verzichten können. Frau war in jeder Hinsicht ein Begleiter des Mannes und hat ihn unterstützt. In manchen Stämmen waren die Oberhäupte weiblich.
Auch als Richter und Mediator waren Frauen gefragte Instanzen. Und nicht zuletzt waren viele Schamanen weiblich. Damit waren sie die Vermittlerin zwischen dieser Welt und der Welt der Ahnen. Das war schon eine grosse Ehre.
Anders als im Islam konnten sich die Frauen in der vor-islamischen Gesellschaft frei und ungehüllt bewegen. Sie konnten an Festen teilnehmen und „Kimiz“ (alko-holisierte Stutenmilch) trinken. Sie konnte sogar selbst Feste feiern und Gäste dazu einladen. Die Frau war frei, ihren Bräutigam selbst auszuwählen. Wenn sie wollten, konnte sie sich ebenfalls frei vom Mann trennen. Die Polygamie war nur selten zu sehen. Die Monogamie war die Regel.
In den ersten Staaten, die von den Türken nach der Be-kehrung zum Islam gegründet wurden, hat die Frau ihre Stellung in der Gesellschaft verteidigt. Die liberalsten Moslems waren schon immer die Türken. Die Frauen haben wie immer mitregiert. Sie waren Gründer von Stiftungen. Sie haben Moscheen und Universitäten bauen lassen. Wenn es notwendig war, kämpften sie an der Seite von Männern gegen den Feind. Sie konnten Armeen aufstellen und ständige Truppen unterhalten. Oder sie waren in religiösen Orden tätig. Und nicht zuletzt haben sie beigetragen, das Handwerk und den Handel zu fördern.
Arabische Reisende im 10. Jahrhundert waren mit Er-staunen festgehalten, wie frei Frauen in der türkischen Gesellschaft waren.
Selbst Marco Polo hat beobachtet, wie eine türkische Armee von einer Frau befehligt worden war. In anatolischen Dörfern von heute die Stellung der Frau nicht geringer als die von damals. Die Geschlechter-trennung ist viel weniger streng als in der Stadt. Die Arbeitsbedingungen auf den Feldern erfordern ohnehin eine enge Zusammenarbeit mit Männern. Außerdem lebt in den Dörfern noch die Nomadentradi-tion weiter. Sogar die Kleider der Frauen haben sich in der Form und Farbauswahl wenig geändert. Der Einfluß der Regligion ist in diesen Schichten der Gesellschaft weniger zu spüren als in regionalen Zentren und Großstädten.
In dieser Hinsicht lebten moslemische Familien und Familien der christlichen oder jüdischen Bevölkerung unter der Herrschaft der Osmanen nicht sehr unter-schiedlich.
Eine Geschlechtertrennung im öffentlichen Leben war schließlich nicht nur eine moslemische Praxis. In christ-lichen Ländern war damals eine ähnliche Erscheinung nicht unüblich. Nicht nur im alten Byzanz gingen Frauen des Hofes oder der gehobenen Schicht nur verhüllt auf die Straße. Auch nicht moslemische Frauen im Osmani-schen Reich oder teilweise in arabischen Ländern gingen verhüllt auf die Straße.
Eine andere Form des sozialen Lebens der Frau und da-mit der Frau als Dichter war die der Sklavinnen. Sowohl in vor- und frühislamischen Gesellschaften als auch später im Osmanischen Reich gab es Sklavinnen. Von Dichterinnen aus Arabien, die Sklavinnen oder befreite Sklavinnen waren, wurde zum Teil mit Bewun-derung berichtet.
Schließlich war der Einfluß des Westens wurde mit der Zeit stärker spürbar, so daß Frauen wieder eine größere Freiheit zuerst im Denken und dann räumlich erlangten. Das hat selbstverständlich auch die Haltung und Sicht-weise der Dichterinnen beeinflußt. Allerdings ist dieser Einfluß auf das Leben in den größe-ren Städten beschränkt. Auf dem Lande, wo die Kultur der früheren Nomadenzeit der Türken noch ziemlich lebendig ist, herrschen andere Regeln. Daß Frauen sich mit Lyrik beschäftigen, liegt auf dem Lande sehr weit zurück. Es sind die Frauen, die in Fe-sten in Begleitung eines Musikinstruments oder alleine auftreten und „Mani“ singen. Das sind meistens Vier-zeiler, die aus dem Stand gedichtet werden oder aus einem Reservoir von Tausenden „Manis“ auswendig vorgetragen werden.
Wie bei arabischen Frauen ist es auch bei Türkinnen so, daß sie die Trauerlieder singen. Die anonyme Literatur ist voll von unschätzbaren Trauerliedern, die meistens von Frauen erschaffen worden sind. Ebenso die Schlaflieder sind eine Spezialität der Frau als Dichter. Hinzu kommen noch Märchen, die in Lyrikform von Frauen erzählt werden.
Der sogenannte „Aschek“ (wörtlich: Verliebte-r), der Volkssänger, ist heute genauso aktiv wie eh und je. Sie treten in unterschiedlichsten Anlässen auf und singen ihre Lyrik. Es gibt Wettbewerbe, in denen sie auftreten, und spontan Gedichte dichten. Obwohl sie hauptsäch-lich Männer sind, sind unter ihnen auch öfter Frauen zu sehen.
Dickinson Dickinson - Dichterin aus Amerika
This is my letter to the world,
That never wrote to me, --
The simple news that Nature told,
With tender majesty.
Her message is committed
To hands I cannot see;
For love of her, sweet countrymen,
Judge tenderly of me!
1830 hatte das Erbe der „Pilgrim Fathers“, das purita-nische Geist, bereits angefangen, sich in ein „amerika-nisches Geist“ zu verwandeln. Die Zehn-Gebote-Theo-kratie hatte das Individuum in eine Zelle von „weiß-gut und schwarz-böse“-Dichotomie gepfercht und setzte eigentlich auch zu jener Zeit die Isolation des Menschen als einen entscheidenden Status fest. Der Puritanismus war eigentlich ein Wandel des ur-sprünglichen Bibel-Geistes, wie dieses vom blitzäugi-gen weißbärtigen Moses installiert worden war, durch Kalvinismus hindurch. Zu jener Zeit hatte sich der Puritanismus weiter verwandelt in den Unitarismus und danach in den Transzendentalismus. Der französische Botschafter Tocqueville machte die folgende Bemerkung über diese Zeit des Wandels: „Each individual stands apart in solitary weakness: but society at large is active, provident and powerful …“.