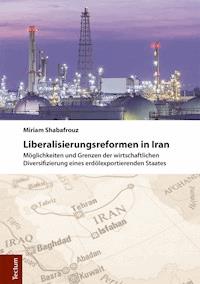
31,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum Wissenschaftsverlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum-Verlag
- Sprache: Deutsch
Eine kontroverse Debatte kreist um die Frage, weshalb rohstoff- und insbesondere erdölexportierende Länder wie Iran in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung oft weniger fortgeschritten sind als ressourcenimportierende Länder. Zwar gibt es eine Reihe von Vorschlägen, wie die einseitige Abhängigkeit vom Erdölexport zu überwinden wäre, doch immer wieder scheitern Politiker bei ihrer Umsetzung. Welche nationalen wie internationalen Hürden dem Erfolg von Reformmaßnahmen im Weg stehen, untersucht Miriam Shabafrouz am Beispiel Iran. Sechs Reformprogramme sollten dort die Privatwirtschaft jenseits des Erdöls stärken und die staatliche Abhängigkeit von Erdöleinnahmen reduzieren. Ihre Analyse im Zeitraum 1989-2015 ermöglicht es, das gleichzeitige Wirken interner und externer Bedingungen bei der Entscheidung für oder gegen Reformen zu erkennen. Gerade auch die internationalen Wirtschaftssanktionen gegen Iran – ihre jahrelange Verstärkung und die aktuelle Aussicht auf ihre Aufhebung – haben sich auf diese Entscheidungsprozesse ausgewirkt. Zudem zeigt Shabafrouz auf, inwieweit eine erfolgreiche wirtschaftliche Diversifizierung erdölexportierender Länder gewichtigen Interessen der internationalen Erdölwirtschaft entgegenlaufen könnte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 664
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
WISSENSCHAFTLICHEBEITRÄGEAUSDEMTECTUMVERLAG
Reihe Politikwissenschaften
Diese Arbeitwurde mit dem Titel „Liberalisierungsreformen in Iran. Möglichkeiten und Grenzender wirtschaftlichen Diversifizierung eines Erdöl exportierenden Staates“ vom Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Universität Duisburg-Essen als Dissertation zur Erlangung desDoktorgrades (Dr. rer. pol.) genehmigt.
Name der Gutachterinnen und Gutachter:
1. Prof. Dr. Tobias Debiel
2. Prof. Dr. Udo Steinbach
Tag der Disputation: 4.11.2015
WISSENSCHAFTLICHEBEITRÄGEAUSDEMTECTUMVERLAG
Reihe Politikwissenschaften
Band 68
Miriam Shabafrouz
Liberalisierungsreformen in Iran
Möglichkeitenund Grenzen der wirtschaftlichen Diversifizierung eines erdölexportierenden Staates
Tectum Verlag
Miriam Shabafrouz
Liberalisierungsreformen in Iran. Möglichkeiten und Grenzen derwirtschaftlichen Diversifizierung eines erdölexportierenden Staates
Wissenschaftliche Beiträge aus dem: Reihe: Politikwissenschaften; Bd. 68
© Miriam Shabafrouz, 2016
Zugl. Diss. an der Universität Duisburg-Essen 2016
ISBN: 978-3-8288-6543-3 (DieserTitel ist zugleich als gedrucktes Buch unter der ISBN 978-3-8288-3790-4 im Tectum Verlag erschienen.)
Umschlagabbildung:shutterstock.com© untitled; Chalalai Atcha
Alle Rechte vorbehalten
Besuchen Sie uns im Internetwww.tectum-verlag.de
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Executive Summary
A controversial debate concerns the question of why resource-exporting states – and especially oil-exporting ones – are often less advanced in their economic development than resource-importing states. Particularly thecontinuing dependencyon oil export revenues, with a concurrent weakness of the rest of their economies, poses a puzzle many researchers have tried to solve. Scholars have so far relied on different theories and scientific methods, and have deduced specific policy recommendations from their respective results. These have partly already been adopted and thus have an effect in the “real world”. Above all, thediversificationof oil-based economiesthrough market liberalizationseems to be a preferred strategy. However, national and international conditions can limit the implementation of this strategy. This can again be explained by theory and is the object of further policy recommendations, such as transparency initiatives, revenue governance schemes, sovereign wealth funds, tax reforms, privatization, etc.
This thesis presents different theoretical approaches to solve the puzzle and provides an empirical analysis of the stumbling blocks to diversification in the case of the Islamic Republic of Iran. A closer look will be devoted to six specific reform cases: the tax reform, the abolition of subsidies, the privatization programme, the liberalization of the banking sector, the unification of exchange rates and the opening of the economy to foreign direct investment in the time period of 1989 to 2015. All reform measures aim at changing the rentier character of the economy – that is the reliance on non-productive income – through its liberalization and are also of relevance to other country cases. It is of special interest to find out to what extent internal (national) and external (inter- and transnational) factors influence decisions and conditions for or against such reforms – and to what extent their respective combinations make a difference.
So far, studies on the topic of oil dependent economies mainly focus on the national level (the “resource curse” thesis, the “rentier state theory”, the concept of a “paradox of plenty”, the “state class” approach etc.) and see economic mechanisms, institutional factors, elite dynamics, human greed, the temptation for corruption etc. at the core of the observable phenomena. In some cases, international factors are also considered, with the theories ofdependenciaor International Political Economy having already pointed to structural dependency and exploitation. But these academic discourses coexist mostly without any connection, and despite a plethora of publications on this topic there remains the need to explainwhy the dependency on oil export income has not yet been successfully reduced in major oil exporting states in general and in Iran in particular. To do this, the separation between theoretical approaches (“either, or”) will be transformed in this thesis to a systematically justified configurative formula (“both, and” or “all, and”) that combines different levels of perception (national, inter- and transnational) and offers a systemic and integrative explanatory model for the country case Iran that ought to be applicable to other country cases as well. It is understood here that the nature of the good discussed, i.e. oil, is of such importance to the contemporary international political economy that only such an integrative view can offer satisfying explanations both of current international events and of domestic developments in all countries interacting on the oil market. Herein lies the gap in the mainstream academic discourse on the topic; and herein lies the relevance of this study and of the explanatory model it provides.
Danksagung
Eine Promotion ist wie eine Schatzsuche. Sie führt den Schreibenden durch Bibliotheken, Büros von Experten und Entscheidungsträgern, die unendlichen Weiten des Internets und natürlich die eigene Gedankenwelt. Zugleich ist sie eine anstrengende, langwierige Reifeprüfung, die jedem, der sich darauf einlässt, sehr viel abverlangt. Dies trifft beides umso mehr zu, wenn das Thema ein so anspruchsvolles und brisantes ist, wie das des Erdöls, und es sich bei dem zu untersuchenden Land um eines wie Iran handelt, dessen politische Führung und Zivilgesellschaft immer wieder für Überraschungen sorgen und auch die externen Faktoren sich ständig ändern. Auf diesem langen Weg haben mir viele kluge und hilfsbereite Menschen zur Seite gestanden, mir wertvolle Anregungen gegeben und mich darin bestärkt, diese Herausforderung zu meistern. Ich möchte mich bei jenen bedanken, ohne die es nie zu diesem Projekt und zu seinem Abschluss gekommen wäre.
An erster Stelle gilt mein Dank meinem Betreuer, Prof. Dr. Tobias Debiel, der trotz meiner gelegentlichen Umwege den Glauben an meine Fähigkeit zu promovieren behalten und mir mit seinen ausführlichen Rückmeldungen in den verschiedenen Etappen des Promotionsprozesses geholfen hat, mich auf das Ziel der Fertigstellung zuzubewegen. Prof. Dr. Udo Steinbach, der als Ratgeber zur Verfügung stand, hat ebenfalls einen Beitrag zur Fokussierung des Themas geleistet. Auch Dr. Jochen Hippler gilt mein Dank für seine konstruktiven Anmerkungen und seine Wertschätzung. Prof. Dr. Rahim Rahimzadeh-Oskui hat ebenfalls wertvolles Feedback gegeben. Die Dozenten und Teilnehmer des Promotionskollegs „Internationale Beziehungen/ Friedens- und Entwicklungsforschung“ der Universität Duisburg/Essen haben zudem zu Ideen beigetragen, die in die Methodik dieser Arbeit eingeflossen sind.
Mein ehemaliger Vorgesetzter am GIGA – German Institute of Global and Area Studies, Dr. Matthias Basedau und meine Kollegen innerhalb des DFG-geförderten Forschungsprojekts „Risikofaktor Ressourcenreichtum?“ sowie jene am Institute for Middle East Studies (IMES) haben mich inhaltlich überhaupt zu diesem Thema gebracht und mich in zahlreichen Gesprächen und Debatten zu einer kritischen, auf den externen Kontext bezogenen Fragestellung angeregt. Das Stipendium der FAZIT-Stiftung hat mir zwei Jahre lang ermöglicht, mich ohne größere finanzielle Sorgen auf die Forschung zu konzentrieren und mir dabei genügend Freiheiten gelassen, mich weiterzubilden und auf das Berufsleben vorzubereiten. Und schließlich haben mich meine Kollegen und Vorgesetzten am Forschungszentrum SAFE (Sustainable Architecture for Finance in Europe) an der Goethe Universität Frankfurt ermutigt, neben der Arbeit die letzte Meile bis zur Abgabe zu gehen.
Meine Gespräche mit Dr. Walter Posch und Dr. Ali Fathollah-Nejad haben meine Sichtweise auf das Thema immer wieder aufs Neue verfeinert. Sie haben mich zudem mit sehr interessanten Experten zusammengebracht und mir wertvolles Feedback gegeben. Meiner Freundin und Kollegin in dieser Promotionsphase, Anika Becher, gebührt unendlicher Dank für stets wertvolle Anregungen, Diskussionen und wirkungsvolles Coaching. Viele weitere Freunde in Berlin, Hamburg, Münster, Ostfriesland, Frankfurt, Paris und Teheran haben sich in dieser langen Zeit geduldig die Entwicklungen in der Welt des Erdöls und in Iran angehört, mich motiviert, weiterzumachen und mich zum Teil auch tatkräftig unterstützt. Und ohne den liebevollen Rückhalt meiner Familie und meines Freundes, David Dakouo, hätte ich möglicherweise längst einen anderen Weg eingeschlagen.
Jenen, die sich bereit erklärten, ein Interview mit mir zu führen, persönlich oder über moderne Kommunikationsmedien, danke ich für die Einblicke in ihre Sichtweise und ihre sehr gut verwertbaren Aussagen und Literaturhinweise. Meine Interviewpartner (siehe die Liste im Anhang) waren vor allem Wirtschafts- und Iranexperten aus Iran, Deutschland, den USA und Frankreich. So konnte ich viele Informationen aus erster Hand erhalten und eine aktuelle, relevante und den Forschungsdiskurs hoffentlich um eine neue Sichtweise bereichernde Studie durchführen.
Inhaltsverzeichnis
Executive Summary
Danksagung
Tabellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Einleitung
1Ein Rätsel und viele Erklärungen
1.1Das Rätsel: die fortbestehende Abhängigkeit vom Erdölexport und Reformresistenz
1.2Die volkswirtschaftlichen Probleme erdölexportierender Länder
a.Dominanz der „Rente“ als Einkommensform
b.Volatiles Wachstum
c.Unproduktive und importabhängige Wirtschaft
d.Kernproblem und Liberalisierung als Lösungsstrategie
1.3Verflechtung von Politik und Wirtschaft in Petrostaaten
a.Autoritäre Regime und Rentenabhängigkeit
b.Wirkungen institutioneller Arrangements auf die Wirtschaft
c.Eliten in Rentierstaaten
d.Kernpunkte und Demokratisierung als Reformvorschlag
1.4Weltwirtschaftliche Zusammenhänge im Erdölsektor
a.Analyseinstrumentarium der kritischen Internationalen Politischen Ökonomie
b.Weltbilder, Akteure, Interessen mit Blick auf Diversifizierung und Liberalisierung
c.Die vier Dimensionen des internationalen Systems und ihr Wandel
d.Die Wirkung externer Interventionen auf interne Bedingungen
e.Kernpunkte und Systemveränderung als Reformvorschlag
1.5Fazit zur Theorie
2Das Erklärungsmodell
2.1Outcome und Fragestellung
2.2Das Zusammenwirken interner und externer Bedingungen
2.3Modell und Hypothesen
2.4Operationalisierung und Erhebungsmethode
2.5Die Einordnung des Untersuchungsfalls
2.6Fallauswahl innerhalb des Falls: Sechs Reformprogramme
3Nationale, inter- und transnationale Bedingungen für oder gegen Reformen in Iran
3.1Literaturüberblick
3.2Reformbedarf – Probleme und Potenzial
a.Abhängigkeit vom Erdölexport und Volatilität des Wachstums
b.Das noch nicht ausgeschöpfte Entwicklungspotenzial
c.Die Gefahr der Sanktionierung des Erdölexports
3.3Lösungsversuche: Reformprogramme und Bezug zur Diversifizierung
a.Die wirtschaftspolitischen Schwerpunkte in den Untersuchungsphasen
b.Sechs Reformprogramme zur Diversifizierung und Liberalisierung der Wirtschaft
c.Diversifizierung und Liberalisierung als Policy-Strategie
3.4Theorem 2: Innenpolitische Bedingungen
a.Der Spielraum für Reformen im politischen System
b.Interessen und Weltbilder in der Wirtschaftspolitik
c.Diachroner Vergleich und Herausarbeitung von Bedingungen
3.5Theorem 1: Innerwirtschaftliche Bedingungen
a.Staatszentrierte Volkswirtschaft und reformresistente Wirtschaftskultur
b.Parallele Wirtschaftsstrukturen und ihr Machtzuwachs
c.Diachroner Vergleich und Herausarbeitung von Bedingungen
3.6Theorem 3: Internationale Bedingungen – die Sanktionen
a.Sanktionen gegen Iran als Dauererscheinung
b.Die Verschärfung der Sanktionen 2006-2014
c.Die Aussicht auf eine Lockerung der Sanktionen 2014-16
d.Diachroner Vergleich und Herausarbeitung von Bedingungen
3.7Theorem 4: Neudefinition des Rätsels durch Integration transnationaler Bedingungen
a.Produktions-, Konsum- und Handelsstrukturen auf dem Erdölweltmarkt
b.Das Finanz- und Währungssystem und die Rolle des Erdöls
c.Internationale Sicherheitsstrukturen in Bezug auf Erdöl
d.Macht über Ideen, Wissen und Technologien
e.Diachroner Vergleich und Herausarbeitung von Bedingungen
4Ergebnis und vergleichende Schlussfolgerungen
4.1Hypothesenüberprüfung
4.2Zusammenfassung und Ausblick
a.Zusammenfassung der Ergebnisse
b.Übertragungsmöglichkeiten auf andere Staaten
c.Reformmöglichkeiten
Literatur- und Dokumentenverzeichnis
1Wissenschaftliche Literatur (in englischer, deutscher und französischer Sprache)
2Wissenschaftliche Literatur (in Farsi)
3Offizielle Dokumente/ Reden von Entscheidungsträgern
4Datenbanken
5Internationale Presse
6Pressebeiträge in Farsi
7Filmbeiträge
Anhang
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1.1:Rentier-/ Allokationsstaaten versus Nicht-Rentier-/ Produktionsstaaten
Tabelle 1.2:Gegenüberstellung verschiedener Weltbilder in Bezug zur Diversifizierung
Tabelle 1.3:Bevorzugte Reformen aus Sicht verschiedener Weltbilder
Tabelle 2.1:Grundgesamtheit/Universum möglicher Untersuchungsfälle
Tabelle 2.2:Konfiguration von Bedingungen
Tabelle 2.3:Unterschiede zwischen den Phasen
Tabelle 3.1:Zusammenfassung des Ausgangsproblems
Tabelle 3.2:Übersicht über Verfassungsänderungen, Gesetze und Verordnungen (Zeitraum 1989-2015)
Tabelle 3.3:Zusammenfassung der politischen Bedingungen
Tabelle 3.4:Zusammenfassung der wirtschaftlichen Bedingungen
Tabelle 3.5:Zusammenfassung der Bestimmungen der vier UN-Resolutionen bezüglich des iranischen Nuklearprogramms (Resolutionen 1737, 1747, 1803, 1929).
Tabelle 3.6:Stärkere Sanktionierung und Angriffsdrohung ab 2006 bis Mitte 2013
Tabelle 3.7:Sanktionslockerungen in Aussicht ab Mitte 2013
Tabelle 3.8:Zusammenfassung der internationalen Bedingungen (v.a. Sanktionen)
Tabelle 3.9:Anteil der stärksten Währungen am globalen Währungshandel in Prozent
Tabelle 3.10:Zusammenfassung der transnationalen Bedingungen und Trends
Tabelle 3.11:Bedingungen im internationalen System und ihre Veränderung für oder gegen Reformen in Iran
Tabelle 4.1:Konfiguration der Hypothesen und Bedingungen
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1.1:Anteile des Exports von Erdöl und Mineralien an Gesamtexporten und der Erdöleinnahmen am BIP (2010)
Abbildung 1.2:Volatilität des Wirtschaftswachstums in ausgewählten erdölexportierenden Ländern 1979-2011
Abbildung 2.1:Analysemodell – systemische Policy-Analyse
Abbildung 3.1:Anteil von Erdöl an den Staats- und Exporteinnahmen sowie am BIP
Abbildung 3.2:Aufteilung der Regierungseinnahmen in Prozent (1979-2012)
Abbildung 3.3:Anteil der Nicht-Erdölexporte an den Gesamtexporten (1978-2015)
Abbildung 3.4:Beitrag der einzelnen Sektoren zum BIP in Prozent (konstante Preise von 1997/98)
Abbildung 3.5:BIP und Erdölpreis
Abbildung 3.6:Erdölpreisentwicklung 1978-2015
Abbildung 3.7:Durchschnittliche Inflationsrate in Prozent und offizieller Wechselkurs Rial zum US-Dollar, 1979-2015
Abbildung 3.8:Erdölproduktion und -konsum in Iran 1979-2014
Abbildung 3.9:Konfliktlinien in der iranischen (Wirtschafts-)Politik
Abbildung 3.10:Wechselkurs Rial-Dollar (1979-2013)
Abbildung 3.11:Einnahmen aus der Privatisierung 2001-2016
Abbildung 3.12:Ausländische Direktinvestitionen (Netto-Zufluss in US-Dollar)
Abbildung 3.13:Ausländische Direktinvestitionen (Netto-Zufluss in Prozent des iranischen BIP)
Abbildung 3.14:Die gewählten und nicht-gewählten Institutionen in der IRI
Abbildung 3.15:Schematischer Erdölhandels- und Petrodollar-Kreislauf
Abbildung 3.16:Nachgewiesene Erdölreserven (in Mrd. Barrel) – weltweit und in OPEC-Ländern (plus Iran)
Einleitung
Eine kontroverse wissenschaftliche Debatte kreist um die Frage, wieso rohstoff- und insbesondere erdölexportierende Länder in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung oftmals weniger fortgeschritten sind als ressourcenimportierende Länder. Vor allem die fortbestehende einseitige Ausrichtung auf einen starken, weltmarktorientierten Wirtschaftssektor bei gleichzeitiger Schwächung der restlichen Wirtschaft ist ein Rätsel, das viele Forscher mit unterschiedlichen Theorien und Methoden zu lösen versuchen. Aus ihren Ergebnissen wurden konkrete Policy-Maßnahmen abgeleitet, die Abhilfe schaffen sollen. Der Weg von der Lösungsidee zu bindenden Policy-Entscheidungen mit der expliziten Absicht, die Diversifizierung der Wirtschaft voran zu treiben und die wirtschaftliche Abhängigkeit vom Erdölsektor zu reduzieren, scheint aber durch nationale Hürden und Grenzen im internationalen System erschwert zu werden. Wie diese Hürden und Grenzen genau aussehen und sich in einem konkreten Länderfall manifestieren, soll durch diese Untersuchung aufgedeckt werden. Die Politikformulierungsprozesse, die an ihnen beteiligten interessengeleiteten Akteure sowie die Strukturen, in denen sich diese bewegen, werden in dieser Arbeit anhand des Fallbeispiels Iran untersucht. Dabei soll insbesondere die Bedeutung des gleichzeitigen Wirkens interner (nationaler) und externer (inter- und transnationaler) Bedingungen bei der Entscheidung für oder gegen Reformen herausgearbeitet werden.
Bisherige Untersuchungen konzentrieren sich erstrangig auf Zusammenhänge innerhalb von Nationalstaaten („Resource Curse“, „Rentierstaatstheorie“, „Paradox of Plenty“, „Staatsklassenansatz“ etc.) und entdecken wirtschaftliche Mechanismen, institutionelle Faktoren, Elitendynamiken, die menschliche Gier und die Neigung zur Korruption usw. hinter den beobachtbaren Problemen. Auch über internationale Faktoren, die diese ungünstige interne Entwicklung hervorrufen können, wurde bereits viel geschrieben. So haben Vertreter der Dependencia-Theorie und der kritischen Internationalen Politischen Ökonomie bereits auf internationale Abhängigkeitsbeziehungen hingewiesen. Oft handelt es sich jedoch um ein Entweder-Oder, um verschiedene Wissenschaftsdiskurse, die wenig aufeinander Bezug nehmen, vielleicht weil eine gleichzeitige Analyse schwer zu bewältigen scheint oder als nicht notwendig erachtet wird. Da es – trotz der vielen Publikationen zu diesem Thema – nach wie vor erklärungsbedürftig bleibt, wieso die Abhängigkeit von Erdölexporteinnahmen bisher nur selten erfolgreich reduziert wurde, wird dieses Entweder-Oder in dieser Arbeit zum systematisch begründeten Sowohl-Als-Auch.
Es wird hier ein integrativer, qualitativer Forschungspfad beschritten, auf dem die innergesellschaftliche mit der transnationalen Perspektive verbunden wird und jene Kausalmechanismen aufgedeckt werden, die ein Überwinden der vorhandenen wirtschaftlichen Abhängigkeit vom Ressourcensektor verhindern. Folglich werden nicht einzelne Ursachen, sondern das Zusammenwirken unterschiedlicher externer und interner Bedingungen als Voraussetzung für die fortbestehende Abhängigkeit vermutet. Die untersuchungsleitende These ist damit genannt. Die Frage bleibt, welche Bedingungen hier genau in welcher Kombination und durch welche Mechanismen wirken. Anhand des Fallbeispiels soll untersucht werden, wie konkrete wirtschaftspolitische Reformversuche vorgenommen wurden, wo genau sie bisher an ihre Grenzen stießen und, falls sie trotz der politischen Auseinandersetzungen über sie und der Berücksichtigung in Wirtschaftsplänen nicht früher durchgesetzt werden konnten, woran das lag.
- Theoriegeleitete Untersuchung -
Eine Reihe von plausiblen Bedingungen sowie mögliche Kausalmechanismen, durch die sie wirken, werden dabei aus mehreren, zum Teil konkurrierenden Theoriesträngen abgeleitet. Ein erster Theoriestrang geht von direkten wirtschaftlichen Auswirkungen von Erdöleinnahmen aus: So können hohe Deviseneinnahmen unter anderem durch den so genannten „Dutch Disease“-Effekt und die mit hohen Einnahmen einhergehende Möglichkeit der umfassenden Verteilungspolitik dazu führen, dass die Wirtschaft wenig diversifiziert und die Privatwirtschaft gegenüber dem Staat schwach ist und immer schwächer wird. Die Vertreter dieses ersten Theoriestrangs sehen in marktwirtschaftlichen Mechanismen und einem starken privatwirtschaftlichen Sektor in einer diversifizierten Wirtschaft die Grundlage für wirtschaftliche Entwicklung, die durch Renteneinnahmen behindert würde (→economics). Aus ihm leiten sich zahlreiche Reformvorschläge ab, wie beispielsweise die Einrichtung von Stabilisierungsfonds, mehr Transparenz usw. sowie Privatisierungs- und Liberalisierungsmaßnahmen (siehe Publikationen der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds/IWF etc.). Je höher die Einnahmen, desto geringer die Wahrscheinlichkeit von Reformen. Sinken die Einnahmen, steigt zwar die Notwendigkeit von Reformen – doch zugleich kann der gesellschaftliche Widerstand gegen Reformen, wie beispielsweise Subventionskürzungen, steigen.
Ein zweiter Theoriestrang geht von den Grenzen aus, die politische Strukturen den Möglichkeiten für Reformen setzen. Nimmt ein politisches System Beschwerden aus der Bevölkerung, neue Policy-Ideen oder technokratische Vorschläge kaum als handlungsrelevant wahr, weil dieses wenig responsiv bzw. stark zentralistisch und autoritär geprägt ist, könnten sich reformbefürwortende Kräfte kaum durchsetzen. Oder aber Reformen könnten sehr schnell top-down umgesetzt werden, je nach Zielsetzung des inneren Machtzirkels. In beiden Fällen wird die Bevölkerung nicht in die Entscheidungsfindung einbezogen. Das politische System kann aber auch als Outcome wirtschaftlicher Bedingungen aufgefasst werden, wie beispielsweise die Rentierstaatstheorie argumentiert. Sie besagt, dass die Einnahmestruktur – überwiegend auf Steuern oder Renteneinnahmen aufbauend – unterschiedliche politische Systeme zur Folge hat. In der vorliegenden Arbeit steht jedoch umgekehrt vor allem die Dauerhaftigkeit ebendieser wirtschaftlichen Bedingungen und ihre zum Teil politischen Ursachen im Vordergrund (→ polity). Eng damit verknüpft sind jene Theorien, die von den Selbstprivilegierungsinteressen der Elite ausgehen. Diese sei dazu veranlasst, Reformen zu verhindern bzw. in bestimmte Richtungen zu lenken, um ihre eigene Position innerhalb der politischen und wirtschaftlichen Strukturen zu sichern. Dieser Ansatz greift auf den Staatsklassenansatz sowie auf weitere Elitentheorien zurück, um Interessen und Handlungsstrategien zu modellieren (→politics).
Ein dritter Theoriestrang geht von dem Einfluss internationaler Akteure und Strukturen aus und interessiert sich für die Eingliederung bzw. Ausgrenzung des erdölexportierenden Landes von internationalen Märkten und politischen Foren. Hier wird vor allem aus Perspektive von realistischen Theorien Internationaler Beziehungen argumentiert. Gerade dieser Aspekt macht Iran zum interessanten Untersuchungsobjekt, da die in den letzten Jahren graduell immer weiter zugespitzte Sanktionierung das Land zum Extremfall macht und für die Untersuchung besonders vielversprechende Ergebnisse erwarten lässt. Aus dem Länderbeispiel lassen sich aber auch zum Teil widersprüchliche Annahmen zur Wirkung von Wirtschaftssanktionen und Angriffsdrohungen entwickeln – zum einen erschweren sie die Reformen, zum anderen erhöhen sie ihre Dringlichkeit.
Ein vierter Theoriestrang nimmt ebenfalls die internationale Perspektive ein, untersucht jedoch vor allem allgemeine Kontextbedingungen und von einzelnen Akteuren schwer beeinflussbare Trends und betrachtet damit den systemischen Zusammenhang aller Bedingungen miteinander. Dabei werden internationale Wirtschaftsbeziehungen und Marktentwicklungen mit in die Analyse von Reformschwierigkeiten einbezogen. Der Fokus liegt dabei erstrangig auf dem Erdölmarkt, aber auch Wirtschaftsbeziehungen in anderen Bereichen werden berücksichtigt, sofern diese mit dem Erdölmarkt und der Erdölpreisentwicklung verflochten sind. Mit dem vierten Theoriestrang wird nicht das Politikergebnis sondern vielmehr das Ausgangsproblem der geringen wirtschaftlichen Diversifizierung neu definiert.
Aus diesen vier Herangehensweisen, die zum Teil als konkurrierend oder, wie in dieser Arbeit, als komplementär aufgefasst werden, können Hypothesen über die kausalen Wirkungsmechanismen spezifischer Bedingungen abgeleitet werden. Es können sich auch Konfigurationen unterschiedlicher Bedingungen als besonders wirksam herausstellen. Die Fragestellung lautet: Wie können die Schwierigkeiten bei der Einführung von Liberalisierungsmaßnahmen zur Diversifizierung der iranischen Wirtschaft erklärt werden? Die Grundannahme ist, dass allein auf nationale Entwicklungen fokussierte Erklärungsansätze nicht ausreichen, um den Ablauf von Reformprozessen zu erklären. Am Schluss der Arbeit soll deutlich werden, ob und wie stark interne und externe Bedingungen zusammenwirken und welche davon das Outcome der weiter bestehenden Abhängigkeit alleine oder in welchen Kombinationen und durch welche Kausalmechanismen verantworten. Insbesondere transnationale Bedingungen werden in Analysen bisher meistens vernachlässigt und somit das Problem der Exportabhängigkeit unzureichend erklärt. Die Ergebnisse sind zunächst gültig für Iran, doch die herausgearbeiteten Hypothesen und das Modell sollten an anderen Staaten überprüft werden können.
- Iran als Fallbeispiel -
Iran wird als Fall unter mehreren möglichen Fällen ausgewählt. Insbesondere die revolutionäre Staatsgründung, die Bedeutung der Religion in der Politik, die internationale Isolierung und Sanktionierung sowie die Existenz eines starken semi-staatlichen Sektors unterscheiden das Land deutlich von anderen Ländern. Viele Befunde, die die iranische Wirtschaft betreffen, könnten aber auch für andere erdölexportierende Staaten gelten, wie die hohe Abhängigkeit von Erdöl sowie bestimmte soziale und wirtschaftliche Herausforderungen und das Vorhandensein klientelistischer Netzwerke. Deshalb wird Iran nicht selten als einer von mehreren „typischen“ Fällen beispielsweise für die Rentierstaatstheorie oder oben genannte Annahmen zu wirtschaftlichen Deformationserscheinungen gesehen (mehr dazu in den Abschnitten 1.2.a und 3.1.). In dieser Arbeit wird jedoch die Besonderheit Irans hervorgehoben und das Land in der Untersuchung entsprechend als Extremfall behandelt. Als geeignetes Untersuchungsobjekt wird er vor allem deswegen betrachtet, weil erstens einige Reformbemühungen zur Überwindung der Abhängigkeit bereits angegangen wurden (zum Teil ähnlich wie in anderen erdölexportierenden Staaten, zum Teil früher oder drastischer); zweitens einige andere Reformen lange Zeit nicht angegangen wurden und damit Vergleichsmöglichkeiten zwischen den Reformbaustellen entstehen; drittens politische Entscheidungen wenigstens teilweise über Wahlmechanismen zustande kommen (im Gegensatz zu mehreren anderen Staaten in der Region), über deren Ausgang zum Teil massive Konkurrenz zwischen verschiedenen politischen Fraktionen herrscht und viertens eine Untersuchung Irans besonders interessante Erkenntnisse darüber verspricht, wie sich einzelne Staaten in den Welterdölmarkt einfügen. Und nicht zuletzt war Iran, fünftens, der Ausgangspunkt für die Entwicklung des Rentierstaatsansatzes gewesen (Mahdavy 1970) und diente als Referenzpunkt für viele andere rentierstaatliche Untersuchungen.
Die graduelle Verstärkung der wirtschaftlichen Sanktionen gegen Iran, die ab 2012 auch den Erdölsektor betroffen haben, und ihre anschließende Lockerung, erlaubt es, bei der Untersuchung des externen Drucks einem Forschungsdesign zu folgen, das in einem Punkt starke Variabilität aufweist, während andere Rahmenbedingungen stabil bleiben. Dabei sollen nur am Rande Gründe und Begründung für Sanktionen diskutiert werden. Die wissenschaftliche, mediale und politische Diskussion um Iran drehte sich ohnehin lange sehr stark um das Nuklearprogramm, wodurch andere wichtige Konfliktgegenstände und interne Prozesse in den Hintergrund geraten sind. Relevant für die Fragestellung ist vor allem, die Wirkungen der Sanktionen auf die Reformprogramme und die sie beeinflussenden Bedingungen über einen längeren Zeitraum zu untersuchen. Der diachrone Vergleich der Amtsperioden dreier verschiedener Präsidenten (plus dem Anfang der Amtszeit Rohanis) erlaubt es darüber hinaus, zwischen den Einflussmöglichkeiten jeweils starker einflussreicher Gruppen (bzw. Elitensegmente) zu unterscheiden.
Der Untersuchungszeitraum der Fallanalyse beginnt ab 1989, nach Ende des Iran-Irak-Krieges und dem Tod Ayatollah Khomeinis, und erstreckt sich bis Mitte 2015 (nach dem Amtsantritt des neuen Präsidenten, Hassan Rohani). Auf diese Weise können die Zwänge der Kriegswirtschaft, die post-revolutionären Machtkonflikte, die Führerschaft Khomeinis und die Veränderungen in der Weltordnung Ende der 1980er Jahre ausgeklammert werden. Stattdessen kann der Fokus auf einige konstantere Bedingungen und erkennbare Veränderungen ab 1989 gelegt werden und es sind genügend weltwirtschaftliche Wendepunkte, wie beispielsweise die Weltfinanzkrise ab 2008 sowie innergesellschaftliche Prozesse, wie beispielsweise die Demonstrationen nach den Präsidentschaftswahlen 2009, innerhalb der Untersuchungsperiode vorhanden, anhand derer Kausalmechanismen erkennbar werden können. Die Periode davor (revolutionäre Gründung der IRI, Iran-Irak-Krieg etc.) sowie die Zeit der Lockerung der Sanktionen wird in Teilen, sofern erforderlich, berücksichtigt.
Seit 1989 haben sich mehrere wichtige politische Organe mit der nationalen Politik insgesamt und auch der Wirtschaftspolitik befasst: ein Revolutionsführer (Ayatollah Ali Khamene‘i), drei Präsidenten in jeweils zwei Regierungsperioden und ein neuer Präsident ab August 2013 sowie das Parlament (Majles) in sechs Legislaturperioden. Die jeweils doppelten Präsidentschaften Ali Akbar Hashemi-Rafsandjanis (1989-1997), die von Mohammad Khatami (1997-2005) und schließlich die Präsidentschaft Mahmud Ahmadinejads (August 2005 bis August 2013) weisen einen klar voneinander unterscheidbaren Kurs in der Wirtschaftspolitik auf und werden als Ausgangspunkt für eine vergleichende Analyse genommen. Auch Präsident Hassan Rohani (August 2013 bis heute) verfolgt einen eigenen Kurs.
Verschiedene politische Fraktionen1 waren jeweils dominant, mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten und konnten sich gegenüber anderen Teilen der politischen Elite durchsetzen – gelegentlich auch, indem sie bereits getätigte Reformschritte rückgängig machten. Grob werden derzeit drei Fraktionen innerhalb der inneriranischen Machtelite unterschieden: jene Politiker, die eine leichte wirtschaftliche und politische Öffnung anstreben, auch um die Stabilität der Islamischen Republik (IRI) zu gewährleisten, werden als „Pragmatiker“-Fraktion (kārgozarān) zusammengefasst; jene, die grundsätzlichere Veränderungen innerhalb des Systems anstreben werden als „Reformer“ (eslāh-talabān) bezeichnet. Sie wurden seit den Präsidentschaftswahlen 2009 zunehmend von dem inneren Machtzirkel verdrängt. Diejenigen schließlich, die den Status quo verteidigen oder sogar die Wiederbelebung revolutionärer Ideale befürworten, gelten als „Konservative“ (mohāfeze kārān) oder als „Hardliner“ und „Prinzipalisten“ (osulgarān), die seit 2005 und insbesondere 2009 deutlich an Macht gewonnen haben und zum Teil zusammenarbeiten.2 Seit 2013 waren die Pragmatiker wieder stärker präsent. Doch all diese Fraktionen sind in sich fragmentiert und stellen keine homogenen Blöcke dar.
Es wird angenommen, dass die Kräfteverhältnisse der Fraktionen durch Präsidentschafts- und auch Parlamentswahlen verändert werden können, aber auch durch die Positionen ihrer Vertreter in den nicht-gewählten theokratischen Organen bedingt sind. Denn dem Präsident und Parlament, die die republikanischen Säulen des Regimes bilden, stehen sehr einflussreiche Institutionen und Organe gegenüber, die ihre Legitimität von der religiösen Seite des Regimes ableiten. Diese werden teilweise von Vertretern anderer politischer Fraktionen dominiert, die durch ihre Funktion als Gegenspieler Reformversuche effektiv blockieren können. Hier tritt das Paradox der doppelten Legitimationsgrundlage des Regimes deutlich zutage: auf der einen Seite sind einige Institutionen vom Volk durch Wahlen legitimiert – auch wenn diese sehr stark durch Vorselektion eingeschränkt werden –, auf der anderen Seite haben Institutionen, deren Legitimität von Gott abgeleitet wird, meist das letzte Wort. Dieser Grundkonflikt zwischen zwei widersprüchlichen Herrschaftsvorstellungen ist bereits in der Bezeichnung „Islamische Republik“ enthalten und tritt auch in der Wirtschaftspolitik zutage (Kapitel 3.4).
Untersuchungen zu Reformen in Iran konzentrieren sich häufig auf Fortschritte bzw. Rückschritte in der Öffnung sozio-kultureller Einschränkungen (unter anderem Frauenrechte, Kleidungsvorschriften, die Erlaubnis kultureller Ausdrucksformen), auf die Stärkung politischer Rechte (unter anderem Kandidatenauswahl, Transparenz von Wahlen, Responsivität der Entscheidungsträger, zivilgesellschaftliches Engagement, den Diskurs über eine Neudefinition des Regimes) oder auf Bemühungen um die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen und die Lockerung der außenpolitischen Rhetorik („Dialog der Zivilisationen“). Diese werden in dieser Arbeit außen vor gelassen und einzig wirtschaftliche Reformen in den Blickpunkt genommen. Weiterhin können nicht alle wirtschaftspolitischen Maßnahmen berücksichtigt werden, weshalb der Fokus allein auf sechs Programme gelegt wird, die die Überwindung der Erdölexportabhängigkeit am stärksten verfolgen und zu den häufigsten Empfehlungen für erdölreiche Länder gehören. Als wichtige, über lange Jahre diskutierte Reformvorschläge in diesem Bereich wurden identifiziert: die Reform des Steuersystems, die Vereinheitlichung der Wechselkurse, der Abbau von Energie- und Nahrungsmittelsubventionen, die Privatisierung staatlicher Unternehmen, die Bankreform und die Öffnung für ausländische Direktinvestitionen. Diese sechs Reformprogramme – in den jeweiligen Phasen – werden als Fälle innerhalb des Länderfalls betrachtet. Für jedes gibt es einschlägige Dokumente und Debatten zu einzelnen Änderungsvorschlägen, die für die Untersuchung wichtige Informationen liefern. Interessant ist insbesondere die Frage, warum die sechs Reformmaßnahmen nicht unter dem wirtschaftsfreundlichen Präsidenten Rafsandjani (1989-1997) oder auch unter Khatami (1997-2005) erfolgreich in Gang gesetzt wurden, sondern durch den als radikal geltenden und nicht für wirtschaftliche Liberalisierung stehenden Ahmadinejad (2005-2013), der mit einer eher sozialpopulistischen Agenda angetreten war.
Die Schicksale der sechs Maßnahmenpakete werden jeweils im Zeitverlauf chronologisch untersucht und die Begründungen der Befürworter und Gegner in den jeweiligen Präsidentschafts- und Legislaturperioden verglichen. Wann ist eine Idee entstanden, wie wurde sie rezipiert, von wem wurde sie verteidigt und von wem verhindert? Da einige dieser Maßnahmen Teilerfolge verbuchen können, wird ein Vergleich möglich und hochinteressant. Mit „Teilerfolg“ ist hier gemeint, dass sie in die Tat umgesetzt bzw. in Gesetze gegossen wurden, weniger, dass sie ihre Ziele erreichen konnten. Eine Evaluierung der Maßnahmen kann und soll hier nicht vorgenommen werden, höchstens kann eine deskriptive Vorstellung der Effekte die Analyse illustrieren. Als „erfolgreiche Reform“ wird hier beispielsweise die weitgehende Abschaffung der Subventionen für Nahrungsmittel und Energie aufgefasst, die 2010 nach zwanzig Jahren Diskussion als Gesetz verabschiedet und wenige Monate später implementiert wurde. Und auch Privatisierungsmaßnahmen wurden längst ergriffen – kamen jedoch, wie die Untersuchung zeigen wird, vor allem den religiösen Stiftungen und den Revolutionsgarden zugute, die vom Staat zahlreiche Unternehmen abkauften und damit ihre Monopolstellung in der Wirtschaft noch weiter stärkten. Erfolg misst sich folglich hier nur an der Tatsache der Durchsetzung und nicht an den positiven oder negativen Auswirkungen.
- Aufbau der Arbeit -
Das erste Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen für die Analyse. Es beginnt mit einer genaueren Erfassung von Erklärungen des diskutierten „Rätsels“. Danach werden verschiedene Thesen aus der Literatur hergeleitet und theoretisch abgesichert. Da es um Policy-Maßnahmen geht, werden auch im Theoriekapitel die in der Literatur auffindbaren entsprechenden Lösungsempfehlungen genannt. Abschließend wird nach Anknüpfungspunkten zwischen den Theoremen gesucht.
Das zweite Kapitel ist das methodische Kapitel der Arbeit. Es stellt kurz das Forschungsdesign vor und entwickelt ein Erklärungsmodell, an dem sich die Untersuchung orientiert. Daraus werden Hypothesen abgeleitet und die in der Arbeit verwendeten Analysemethoden benannt. Schließlich wird eine systematische Einordnung des Falls durchgeführt, die Iran in eine Grundgesamtheit möglicher anderer Fälle einbettet und die Ergebnisse anschlussfähig für andere Falluntersuchungen hält. Zusätzlich wird hier die Eingrenzung und Unterteilung der Zeitperiode für den diachronen Vergleich begründet.
Das dritte Kapitel führt aus der Theorie, der Variablendefinition und der Modellentwicklung hinaus ins empirische Feld. Nach einer Überprüfung der theoretischen Erwartungen aus dem ersten Kapitel mittels der Kongruenzmethode wird direkt mit der Analyse der Reformbemühungen in den verschiedenen Phasen begonnen. Dabei werden jeweils die Dynamiken innerhalb der politischen Elite und der Fraktionen und ihrer Haltung zu den einzelnen Maßnahmen anhand eines diachronen Vergleichs ermittelt. Auch die schrittweise Verstärkung der Sanktionen wird in diesem Kapitel vorgestellt und untersucht, inwiefern sie die innerwirtschaftlichen Bedingungen in Iran verändert haben. Am Ende jedes Unterkapitels werden notwendige Bedingungen, ihre Kombinationen und die Kausalmechanismen, über die sie wirken, identifiziert. Da die Arbeit einen Beitrag dazu leisten will, die Fokussierung auf Nationalstaaten aufzulösen und den größeren Zusammenhang, in denen sie existieren, deutlicher zu machen, werden in diesem Kapitel auch die transnationalen Trends, die in der Untersuchungsphase zu beobachten waren, und ihre Wirkungen auf Iran wie auch auf andere Erdölexporteure und -importeure untersucht. Dies kann aufgrund der Fülle an Faktoren nur in groben Linien geschehen, so aber bereits zu einer Perspektivveränderung beitragen.
Es wird somit zweierlei geleistet. Erstens eine Prüfung gängiger, auf ressourcenexportierende Staaten zugeschnittenen Theorien, indem ihre Übersetzung in politische Maßnahmen im Fall Iran untersucht werden. Dieser Teil ist eine Policy-Analyse, wenn auch keine klassische, und stellt den empirisch-analytischen Beitrag dar. Zweitens wird eine Neudefinition des Problems versucht und damit eine Erweiterung der Theorien durch die Integration der transnationalen Ebene angestrebt. Dieser Teil ist der kritisch-dialektische Beitrag der Arbeit. Beide Teile sind aufeinander abgestimmt und gehören zusammen, was sich im Erklärungsmodell widerspiegelt.
Im Schlusskapitel werden schließlich die Bedingungen, die sich auf die Entscheidungsprozesse zu den verschiedenen Reformpaketen ausgewirkt haben, aus einem diachronen Vergleich herausgemeißelt. Dabei werden die drei verschiedenen Ebenen – national, inter- und transnational – miteinander verknüpft. Aufgrund der Fülle an Bedingungen wird ein mittlerer Abstraktionsgrad angestrebt und auf eine genaue Beschreibung jeder einzelnen Bedingung verzichtet, dafür aber umso mehr Wert auf die Analyse der Zusammenhänge gelegt.
Die verwendeten Materialen waren neben wissenschaftlichen Arbeiten und Artikeln vor allem Strategiepapiere und Gesetze, Regierungsberichte, Reden von Amtsträgern, Medienberichte und Experteninterviews.3 Zahlreiche iranische und internationale Datenbanken waren wertvolle Quellen, um Zusammenhänge festzustellen und Trends im Zeitverlauf zu erfassen. Für die Analyse des transnationalen Systems wurden bewusst neben gängigen Interpretationen auch heterodoxe, unkonventionelle Analysen herangezogen, denn das explizite Anliegen der Arbeit ist es, eine alternative Interpretation dieses Themas zu ermöglichen.
1Auch wenn die iranische Politik nicht von miteinander konkurrierenden Parteien, sondern von so genannten Fraktionen mitbestimmt wird, die teilweise auch mehrere Parteien umfassen, kann die Untersuchung der Kräfteverhältnisse dieser Fraktionen im Zeitverlauf sowie ihrer Strategien Schlussfolgerungen über ihre Zusammenarbeit bzw. Gegnerschaft in wirtschaftspolitischen Zielen erlauben.
2Opposition außerhalb dieser zum Regime gehörenden Gruppen wird dabei nicht berücksichtigt, da für sie innerhalb der formalen institutionellen Struktur der Islamischen Republik keinerlei Handlungsspielraum besteht.
3Für eine Liste der Interviewpartner siehe Anhang A; der semi-strukturierte Interviewleitfaden befindet sich im Anhang B.
1Ein Rätsel und viele Erklärungen
Dieses Kapitel dient der theoretischen Einordnung der Arbeit und der Aufarbeitung des Forschungsstandes. Im ersten Teilkapitel wird zunächst das Rätsel vorgestellt, das viele Wissenschaftler und Politiker beschäftigt: die wirtschaftlichen Entwicklungsprobleme von Ländern, die durch den Export natürlicher Ressourcen, unter anderem Erdöl, sehr hohe Einnahmen verzeichnen und dadurch eigentlich mehr Wohlstand, Wachstum und Fortschritt aufweisen könnten, als sie es tatsächlich tun. Für diese als Paradox erscheinenden Entwicklungsprobleme ressourcenreicher Länder sind in der wissenschaftlichen Literatur verschiedene Interpretationen und rivalisierende Erklärungen zu finden. Sie werden klangvoll bezeichnet als „Ressourcenfluch“ (Auty 1993, 2000, 2001; Sachs/Warner 1995, 2001) bzw. „Ölfluch“ (Ross 2012), „Paradox of Plenty“ (Karl 1997, 1999, Basedau/Lacher 2006), „wirtschaftliche Ironie“ (Looney 2006: 37), „zweischneidiges Schwert“ (Frankel 2012), „reversed Midas touch“ (Yergin 2011), um nur einige der vielen Metaphern zu nennen. Knapp zusammengefasst lautet der Tenor:
Resource-rich countries typically develop more slowly, are less diversified, more corrupt, less transparent, subject to greater economic volatility, more oppressive and more prone to internal conflict than nonendowed countries at similar income levels (Siegle 2009: 45).
Über die Gründe für diese Entwicklungen gibt es viele Überlegungen, die in Theoremen zusammengefasst werden können. Diese Grundannahmen dominieren in unterschiedlichen Diskursen über das Thema und werden häufig mit konkreten Verbesserungsvorschlägen und Lösungsstrategien verbunden.4 In dieser Arbeit ist vor allem eines der vielen möglichen Entwicklungsprobleme von Bedeutung: die fortbestehende Abhängigkeit der erdölexportierenden Ländern von den Einnahmen aus ebendiesem Export, die mit einer geringen Diversifizierung der restlichen Volkswirtschaft und den daraus erwachsenden Entwicklungsproblemen einhergeht. Es wird damit der Kausalzusammenhang, dem einige der Studien nachgehen, umgedreht, und nicht erstrangig nach den negativen Auswirkungen der hohen Exporteinnahmen geforscht. Stattdessen wird das Fortbestehen der Abhängigkeit zum Thema gemacht und der innenpolitische Umgang mit dieser Abhängigkeit in einer Falluntersuchung unter die Lupe genommen.
Die Ausgangsidee dieser Arbeit ist die kritische Feststellung, dass das benannte Rätsel in den meisten Fällen nur nationalstaatlich beobachtet und untersucht wird, gegebenenfalls in vergleichenden Small- oder Large-N Analysen, jedoch selten im transnationalen Zusammenhang. Damit bleibt eine Forschungslücke zu schließen, vor allem hinsichtlich der mangelnden Querbezüge zwischen den verschiedenen Perspektiven und Theorien. Eine offene Frage bleibt beispielsweise, wie das internationale System des Erdölhandels sich auf die erdölexportierenden Staaten auswirkt und Grenzen für ihre wirtschaftliche Entwicklung setzt.
Iran wird im Theoriekapitel als ein Fall von vielen behandelt, denn die Ergebnisse sollen auch anhand anderer Fälle diskutiert werden können. Dafür werden Daten zu den 21 bedeutendsten erdölexportierenden Ländern vorgestellt, die als Grundgesamtheit behandelt werden, in die sich Iran als Extremfall einordnen lässt. Das Gewicht auf dem Weltmarkt ist das wichtigste Auswahlkriterium für die Grundgesamtheit, da dem Weltmarkt und den Erdölhandelsbeziehungen in dieser Arbeit eine große Bedeutung für das Fortbestehen des Problems zugeschrieben wird. Es wird jedoch bewusst keine vergleichende Analyse vorgenommen, um eine Erklärung zu ermöglichen, die sich aus dem gesamten System ableitet und sich nicht allein an nationalen Strukturen orientiert.
Im ersten Teilkapitel (1.1.) wird das Forschungsrätsel klar benannt. Im zweiten und dritten Teilkapitel werden die volkswirtschaftlichen Probleme erdölexportierender Länder und ihre gängigen Interpretationen aus politökonomischer Sicht zusammengefasst. Dabei konzentriert sich 1.2. auf die wirtschaftlichen Mechanismen, die sich durch hohe Einnahmen in Form von so genannten „Erdölrenten“ ergeben, und 1.3. betrachtet die Erklärungen, die die engen Verflechtungen von Politik und Wirtschaft als Ursache betrachten, sei es durch institutionelle Rahmenbedingungen oder durch Konflikte zwischen Interessengruppen.
Im vierten Teilkapitel wird schließlich das eigentliche Erklärungsgerüst dieser Arbeit vorgestellt, das die beiden anderen integrieren, aber auch in einen größeren, systemischen Kontext setzen will: die kritische Internationale Politische Ökonomie (1.4.). Aus dieser Sicht sind Zweifel angebracht, dass die aus den aus den erstgenannten Theoremen abgeleiteten Reformstrategien wirklich etwas am grundlegenden Problem ändern können. In 1.5. werden die verschiedenen Ansätze und Ebenen zusammengefasst und miteinander verknüpft.
1.1Das Rätsel: die fortbestehende Abhängigkeit vom Erdölexport und Reformresistenz
Das Ausgangsproblem ist die mangelnde Diversifizierung der Volkswirtschaften erdölexportierender Länder (im Folgenden: OEL), die mit ihrer hohen Abhängigkeit von Erdöleinnahmen zusammenfällt. Zu Neige gehende Erdölreserven, die schwache innerwirtschaftliche Position und internationale Wettbewerbsfähigkeit anderer Sektoren (wie Landwirtschaft, Gewerbe, Industrie usw.) in den jeweiligen Volkswirtschaften macht die Relevanz des Problems deutlich. Gerade auch die Schwankungen der Erdölpreise und die daraus erwachsende Volatilität (d. h. Unbeständigkeit) der Einnahmen erdölexportierender Staaten verdeutlicht die Dringlichkeit von Wirtschaftsreformen immer wieder aufs Neue, weist sie doch auf eine Anfälligkeit für verschiedene Formen von Wirtschaftskrisen hin.
Ein wichtiger Bestandteil des vorliegenden Rätsels ist, dass es bereits seit Jahrzehnten wissenschaftlich und politisch als Problem betrachtet wird und daher schon zahlreiche Reformstrategien erarbeitet wurden. Einige dieser Reformansätze wurden von mehreren Ländern schon längst eingeführt (eine Übersicht ist in Anhang Z enthalten) und es wurden auch internationale Institutionen zur Förderung von Transparenz und Kooperation geschaffen (EITI, Publish What you Pay etc.). Bisher hat dies allerdings (noch) zu keinen entscheidenden Veränderungen geführt, denn die Abhängigkeit selbst bleibt in den meisten Fällen weiter bestehen und wurde höchstens leicht gesenkt.
Was verschiedene Denkschulen zu diesem Rätsel sagen, welchen Schwerpunkt davon sie analysieren und wie sie es jeweils lösen wollen, wird in den Abschnitten 1.2 – 1.4 erörtert. An dieser Stelle geht es darum, einen ersten Einblick in das Thema zu vermitteln und aufzuzeigen, dass es vielschichtige Problemlagen birgt, die unterschiedliche Interpretationen erlauben. Diese Arbeit will darauf hinweisen, dass die bisherigen Erklärungsansätze sich meist nur auf Teile des Problems konzentrieren. Aufgrund dieser Unvollständigkeit können die aus ihnen abgeleiteten Lösungsstrategien nicht wirklich erfolgreich sein. Den Zusammenhang herzustellen zwischen Policy-Maßnahme und dahinter liegender Interpretation des Problems ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit.
Eine geringe wirtschaftliche Diversifizierung bedeutet, dass die gesamte Wirtschaft hauptsächlich auf der Wertschöpfung in einem Sektor beruht (Bougrine 2006) und andere Sektoren neben der Erdölproduktion, wie beispielsweise die Landwirtschaft, die produktive Wirtschaft oder auch bestimmte Teile des Dienstleistungssektors, wenig entwickelt sind und sich nicht unabhängig von den an sie vermittelten Erdöleinnahmen entwickeln (können).5 Sie ist eines von mehreren Problemen, die mit dem Begriff „Ressourcenfluch“ zusammengefasst werden. So haben Forscher Korrelationen zwischen der Abhängigkeit von oder dem Reichtum an Ressourcen und einer ganzen Reihe negativer wirtschaftlicher und politischer Entwicklungen festgestellt (Moss 2011: 3): Einige stellten den Zusammenhang zwischen einem hohen Erdölexportanteil am Gesamtexport und einer geringen Wirtschaftsleistung fest (z. B. Gelb 1988; Auty 1993; Sachs/Warner 1995). Andere beobachteten in ressourcenexportierenden Ländern besonders hohe Armutsraten (z. B. Auty 2001). Auch Korruption scheint sich zu intensivieren, wenn der Ressourcenexport steigt (Leite/Weidmann 1999; Gylfason 2001; Sala-i-Martin/Subramanian 2003). Häufig untersucht wurde der Zusammenhang zwischen Ressourcenreichtum oder -abhängigkeit und Autoritarismus (z. B. Luciani 1987; Ross 2001; Smith 2004; Diamond 2008). Und ein Teil des Diskurses interessiert sich insbesondere für den Zusammenhang von Ressourcenreichtum und dem Ausbruch oder der Dauer von Gewaltkonflikten (z. B. Collier/Hoeffler 2004; De Soyza 2000; Le Billon 2001; Fearon/Laitin 2003; Humphreys 2005; Omeje 2008). In den letzten Jahren sind zunehmend auch Umweltaspekte in den Ressourcenfluchdiskurs miteingeflossen (z. B. Orihuela 2010). Diese Arbeit beschäftigt sich, wie bereits angekündigt, nur mit dem eingangs genannten Teilproblem der fortbestehenden Abhängigkeit von Einnahmen aus dem Erdölexport. Die anderen Aspekte werden jedoch berücksichtigt, und zwar dann, wenn es um politische Entscheidungsprozesse, Interessen und Weltbilder geht, die die Bevorzugung bestimmter Lösungsstrategien begründen. Zudem kann diese fortbestehende Abhängigkeit auch als Urproblem verstanden werden, das die anderen Erscheinungen erst hervorruft, bzw. in einem zusammenhängenden Kreislauf stärkt und durch sie verstärkt wird.
Der Begriff des „Ressourcenfluchs“ wurde erstmalig von Auty (1993) zur Beschreibung des Rätsels verwendet und kurz darauf von Sachs/Warner (1995) aufgegriffen, die mit ihrer ökonometrischen Untersuchung eine bis heute andauernde Diskussion anstießen. Einige Jahre, Berechnungen und Veröffentlichungen später kamen sie zu dem Schluss:
What the studies based on the post-war experience have argued is that the curse of natural resources is a demonstrable empirical fact, even after controlling for trends in commodity prices. (…) Almost without exception, the resource-abundant countries have stagnated in economic growth since the early 1970s, inspiring the term ‘curse of natural resources.’ Empirical studies have shown that this curse is a reasonably solid fact (Sachs/Warner 2001: 828, 837, Hervorhebungen hinzugefügt MS).
In der Tat gab es einige Regressionsanalysen, die dieses Ergebnis untermauert haben (vor allem jene von Sachs/Warner [1995, 2001] selbst). Zugleich wurden aber in anderen Studien Zweifel über die verwendeten Methoden und Daten laut (z. B. Brunnschweiler/Bulte 2006). Kritisiert wird unter anderem ihr alleiniger Fokus auf das Wirtschaftswachstum. Auch in dieser Arbeit wird Wachstum nicht als ausreichendes Kriterium gesehen, um über den Zustand einer Volkswirtschaft zu urteilen.6 Die oben zitierte Aussage wurde deshalb inzwischen von anderen Forschern bereits in Frage gestellt (z. B. Wright/Czelusta 2004).
Die Diversität der Exporte zeigt den strukturellen Zustand der Wirtschaft schon etwas besser auf. Verfügbare Indikatoren erlauben eine Einschätzung darüber, wie hoch die jeweiligen Anteile der Erdölexporte der Länder an ihren Gesamtexporten sind, und darüber, wie groß der Anteil der über diesen Erdölexport generierten Einnahmen am BIP und den Staatseinnahmen ist. Ein weiterer Indikator ist auch der damit nicht direkt zusammenhängende Anteil der Erdöleinnahmen am Budget der Regierung. Abb. 1.1 zeigt eine Auswahl erdölexportierender Länder (Kriterium: mehr als 1 % der Weltexportmenge) und es wird deutlich, dass die Stärke der Abhängigkeit sehr unterschiedlich ist.
Abbildung 1.1:Anteile des Exports von Erdöl und Mineralien an Gesamtexporten und der Erdöleinnahmen am BIP (2010)
Quellen: WTO, WDI, IWF, Revenue Watch, eigene Darstellung, WDI Daten für 2010, (für Iran, Kuwait, Libyen, Katar und Oman für 2009), kombinierte Daten für Export (Erdöl & Mineralien) hier verwendet, da nur so international vergleichbar; Reihenfolge nach Anteil an der Weltexportmenge von Erdöl im Jahr 2010; siehe auch die Tabelle, Anhang C für die genauen Zahlen und Durchschnittswerte.
Diese Indikatoren können einen ersten Eindruck darüber vermitteln, wie sehr die Volkswirtschaft von externen Devisen abhängig ist und erlauben Vermutungen darüber, was im Falle von Preisschwankungen passieren kann. Sowohl hohe Preise als auch niedrige können Probleme bereiten (siehe Abschnitt 1.2.b). Es ist deshalb plausibel, anzunehmen:
Je größer der Part, den das Erdöl bei den Staatseinnahmen, Ausfuhren und dem BIP einnimmt, umso anfälliger sind die Volkswirtschaften gegenüber volatilen Entwicklungen an den internationalen Ölmärkten (EZB 2007: 86).
Der Begriff „Petro-Staat“ oder Erdölexporteur umfasst eine Vielzahl von Ländern, die sehr große Unterschiede hinsichtlich ihres politischen Systems, ihrer Wirtschaftsform, ihrer gesellschaftlichen Organisation, Kultur, Religion und Bevölkerungsgröße aufweisen. Sie haben eigentlich wenig gemeinsam außer der Tatsache, dass sie alle Erdöl und Erdgas exportieren (Yergin 2011: 107). Sie stehen alle jedoch vor der gleichen Herausforderung, die Einnahmen aus dem Erdölsektor auf eine Weise für ihre wirtschaftliche Entwicklung zu nutzen, dass sie nicht aufgrund von wirtschaftlichen Deformationen und sich daraus ergebenden politischen und gesellschaftlichen Fehlentwicklungen verloren gehen (ebd.).
Derzeit wird von etwa 51 Ländern Erdöl exportiert (EIA 2012 für das Jahr 2010), allerdings mit sehr großen Mengenunterschieden. Die 21 Länder, die mehr als 1% des Weltmarktanteils exportieren sind in Abbildung 1.1 aufgeführt (und in der Tabelle Anhang C). Einige dieser Staaten zählen zu den Industrieländern (z. B. Kanada, Norwegen, Großbritannien), andere zu Entwicklungs- und Schwellenländern. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist, wie stark sie in ihren Gesamtausfuhren, ihrem Bruttoinlandsprodukt und ihren staatlichen Einnahmen vom Erdölsektor abhängen.7 Diese verschiedenen Indikatoren können als Proxies auf den Diversifizierungsgrad der Volkswirtschaft schließen lassen (je höher der Anteil der Erdöleinnahmen am BIP und Staatsbudget, desto geringer die wirtschaftliche Diversifizierung).8 Zusätzlich zu den Daten für das Jahr 2010 ist der Mittelwert für den Zeitraum 1990-2010 erfasst (Tabelle Anhang C), um das Merkmal der fortbestehenden Abhängigkeit hervorzuheben. Auch können die Werte der Abhängigkeit vom Export von 2010 zum Teil mit jenen von 2000 und 2005 verglichen werden. Ansonsten wird das Jahr 2010 als Stichjahr verwendet, um die Werte in der Tabelle synchron zu halten.
Der Diversifizierungsgrad könnte noch weiter verfeinert werden, indem die Stärke der anderen Sektoren und zahlreiche weitere Indikatoren, wie die genaue Struktur der Importe und Exporte, die Leistungsbilanzentwicklung, die Arbeitsmarktstruktur, die Entwicklung des Binnenmarktes usw. für einen Vergleich ermittelt werden, doch erfüllen bereits diese Indikatoren den Zweck, unterschiedliche strukturelle Abhängigkeiten von der Ressource Erdöl erkennbar zu machen. In die Tiefe wird erst die Einzelfallanalyse gehen. Zusätzlich zu den in der Grafik enthaltenen Informationen gibt die Tabelle (Anhang C) die derzeitige Bedeutung des Staates für den Welterdölmarkt wieder.
Aus den verschiedenen angegebenen Indikatoren wurden die Staaten der Grundgesamtheit qualitativ in „stark“, „mittel“ und „schwach“ vom Erdölexport abhängig unterschieden. Die Einteilung ergibt sich in Relation zu den anderen Staaten. Die geringe wirtschaftliche Diversifizierung der Länder, die strukturell von einem Exportgut abhängig sind, birgt die Gefahr von großen Schwankungen in den Staatseinnahmen. Zugleich kann sie auch bedeuten, dass viele Produkte, die im Inland nachgefragt und konsumiert werden, nicht im Land hergestellt werden und damit importiert werden müssen. Somit gelangt ein nicht unerheblicher Teil der über den Erdölexport ins Land geflossenen Devisen wieder nach außen, um die Importe zu finanzieren. Der „Petrodollarkreislauf“ führt die Devisen für das Erdöl folglich nicht nur in eine Richtung, „von außen ins Land“, sondern auch wieder hinaus, was für viele Länder, die höherwertige, weiterverarbeitete Güter (Technologie, Waffen, Fahrzeuge, Konsumgegenstände aller Art) wie auch Nahrungsmittel exportieren, wiederum einen „Segen“ darstellen kann. Trotz höherer Kosten durch höhere Energiepreise machen einige Sektoren demnach in Zeiten hoher Preise gute Exportgeschäfte, gerade weil die Erdölländer deutlich mehr für Importe ausgeben können (siehe 1.4.b.3). So wird gerade die geringe Absorptionsfähigkeit der Wirtschaften, die immer wieder in Erdölexportländern als Problem diagnostiziert werden, zum Erfolgsfaktor für Industrie- und Schwellenländer.
Die genauen Handelsstrukturen der vom „Ressourcenfluch“ betroffenen Länder werden in den meisten Studien nicht betrachtet, womit hier offensichtlich eine Forschungslücke besteht. Es gibt bereits einige Versuche, diese Staaten in unterschiedliche Gruppen zu kategorisieren.9 Doch geht die Analyse selten weiter. In dem Kerndiskurs des Ressourcenfluchs wird auf die globalen Zusammenhänge, bei denen Erdöl eine wichtige Rolle sowohl als Motor der Globalisierung als auch als Konfliktgegenstand zwischen Staaten und Gruppen spielt, kaum eingegangen und stattdessen hartnäckig der Fokus auf den Nationalstaat aufrechterhalten. Entsprechend konzentrieren sich die Verbesserungsvorschläge sowohl für ökonomische als auch für politische Instrumente auf die nationale Ebene. Einige Analysten sprechen in diesem Sinne von einer doppelten Herausforderung, vor denen erdölexportierende Volkswirtschaften stehen:
first, transforming the rentier economy into a diversified economy through encouraging expansion in the non-oil private sector areas of activity and, second, implementing the political reforms necessary for establishing institutions and governance structures capable of creating an environment conducive to enabling non-oil activities to operate on a sustained basis (Looney 2006: 39, Hervorhebungen hinzugefügt MS).10
Dabei gibt es keineswegs einen Konsens darüber, wie der „Ressourcenfluch” bzw. das „Rentierstaatssyndrom“ überwunden werden könnten (Looney 2006: 38). Einige Ansätze konzentrieren sich auf die Stärkung marktwirtschaftlicher Mechanismen, andere wiederum schlagen konkrete Interventionsmaßnahmen durch den Staat vor. Für viele Experten liegt die Lösung im mikroökonomischen, (neo-)liberalen Ansatz, mit einer verstärkten Konkurrenz, Privatisierung und höheren Anreizen für Risikobereitschaft (z. B.: Sachs 2000). Andere wiederum betonen die Bedeutung von makroökonomischen Institutionen, wie einer unabhängigen Zentralbank, einem stabilen Finanzsystem, einem effizienten und fairen Steuersystem (z. B. Rodrik et. al 2002, Rodrik/Subramanian 2003, Rodrik 2011). Wieder andere heben die Wichtigkeit gezielter und rechtzeitiger fiskaler und monetärer Interventionen (steuer-, geld- und währungspolitische Maßnahmen) hervor (siehe hierzu z. B. Publikationen keynesianisch orientierter Ökonomen). Und schließlich betonen auch viele die Bedeutung von Good Governance, im Sinne einer Überwindung von politischen Strukturen, die Korruption und dadurch bedingte ökonomische Fehlentwicklungen begünstigen (Looney 2006: 38). In den Tabellen im Anhang (I-M) werden die dokumentierten Reformmaßnahmen einander gegenübergestellt.
Einige Wissenschaftler sehen die Schlussfolgerungen der „Ressourcenfluch“-Literatur und ihrer Empfehlungen allerdings als höchst problematisch:
What is at stake in this debate? The resource-curse hypothesis seems anomalous as development economics, since on the surface it has no clear policy implication but stands as a wistful prophecy: Countries afflicted with the “original sin” of resource endowments have poor growth prospects. The danger of such ostensibly neutral ruminations, however, is that in practice they may influence sectoral policies. (…) Minerals are not a curse at all in the sense of inevitability; the curse, where it exists, is self-fulfilling (Wright/Czelusta 2004: 36).
Dieses Zitat weist auf einen wichtigen Punkt hin, der zu dieser Arbeit motiviert hat: die Erklärung des Problems impliziert auch die Richtung, in der nach Lösungen gesucht wird. Da sie bereits Eingang in Policy-Empfehlungen hat und darauf aufbauende Maßnahmen auch schon eingeführt wurden, hat sie Einfluss in der „realen Welt“. In den letzten Jahren hat sich der Diskurs zu ändern begonnen, unter anderem, weil die Erdölstaaten international an Bedeutung gewonnen haben. So wird in einem Aufsatz der Europäischen Zentralbank hervorgehoben:
Die ökonomische Entwicklung in den Erdölausfuhrstaaten und das Recycling der „Petrodollars“ über den Handels- und Finanzkanal sind von zunehmender weltwirtschaftlicher Bedeutung, und so spielen diese Länder auch als Handelspartner und Investoren seit Beginn der Ölpreishausse im Jahr 2003 eine größere Rolle (EZB 2007: 85).
Viele der Artikel, die in den 1990er Jahren entstanden sind, vor allem die von Sachs & Warner (1995, 1999, 2001), sind nicht mehr tragfähig, da die Wachstumsraten erdölexportierender Länder seit Anfang des neuen Jahrtausends zum Teil massiv in die Höhe geschnellt sind. Dennoch werden sie in vielen Aufsätzen noch unkritisch zitiert. In anderen wurden bereits Mängel identifiziert (z. B. Wright/Czelusta 2004). Aus diesen verschiedenen Gedanken und Kritikpunkten lässt sich erahnen, dass noch genügend Diskussionsbedarf besteht, um andere Sichtweisen auszuprobieren. Denn auch wenn schon viel über das Thema geschrieben wurde, bedeutet das keineswegs, dass es schon erschlossen wäre:
In the process, we are convinced that we know less than what we thought we knew, especially from reading the existing literature. (…) we do know that there might be substantial international heterogeneity in the effects of other determinants of growth, and there is certainly cross-country heterogeneity intercept. (…) Similarly, much remains to be learned from historical case studies and perhaps from cross-country statistical analysis of the interaction between natural resources and institutions, in spite of the unreliable existing evidence concerning the curse-through-politics hypothesis (Lederman/Maloney 2008: 20).
Es gibt bereits einige qualitative Länderstudien oder Small-N-Vergleichsstudien, beispielsweise zu Venezuela (Karl 1997), oder eine vergleichende Studie zu Algerien, Iran, Venezuela und Nigeria (Basedau/Mähler/Shabafrouz 2011). Es dominieren jedoch nach wie vor quantitative Large-N Studien, die häufig mit ähnlichen Datensätzen (WDI, IWF, Economist Intelligence Unit, BP, OPEC sowie Konfliktdatenbanken) arbeiten und nur leichte Veränderungen in den Berechnungen vornehmen.11 Diese Studie strebt an, die Debatte um eine systematische qualitative und kritische Studie zu bereichern und das Rätsel anders zu definieren. Dabei sind sowohl wirtschaftliche, als auch politische Prozesse auf nationaler und transnationaler Ebene zu berücksichtigen.
1.2Die volkswirtschaftlichen Probleme erdölexportierender Länder
Viele Erklärungen für das beobachtbare Problem konzentrieren sich auf volkswirtschaftliche Mechanismen. Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der theoretischen Diskussion über die Frage, wie die wirtschaftlichen Probleme im Zusammenhang mit hohen Ressourcenexporteinnahmen erklärt werden. Damit werden die bereits eingangs zusammengefassten Phänomene vertieft untersucht und die angenommenen Kausalmechanismen herausgearbeitet. Es wird dabei nicht nur die Entstehung des Problems betrachtet, sondern vor allem sein Fortbestehen trotz Bemühungen zu seiner Überwindung.
In der wissenschaftlichen Diskussion werden insbesondere drei Phänomene identifiziert, die den erdölexportierenden Staat krisenanfällig machen und ihn in seiner Entwicklung behindern: Erstens seine Abhängigkeit von Einnahmen, die nicht durch produktive Leistungen erzeugt wurden („Renten“) (a.). Zweitens die damit zusammenhängende hohe Abhängigkeit von Entwicklungen auf dem Weltmarkt, die sich doppelt auf Exporteinnahmen und Ausgaben für Importe auswirkt (b.). Aufgrund negativer monetärer Effekte kann dies auch in Zeiten hoher Preise ein Problem sein und die häufig geringe Diversifizierung der Volkswirtschaft noch vertiefen (volatiles Wachstum). Und drittens haben die geringe Produktivität und die hohe Importrate Wirkungen auf die gesamte Wirtschaft, die schwer zu überwinden sind (c.). All diese Mechanismen verstärken sich gegenseitig und bilden einen zusammenhängenden Kreislauf, der der geringen Diversifizierung entspringt und diese wiederum verstärkt (d.).
a.Dominanz der „Rente“ als Einkommensform
Der Aspekt des Übergewichts von Einnahmen aus dem Erdölsektor, sowohl hinsichtlich des Gesamtexports, als auch des BIP oder des Staatsbudgets, macht die strukturelle Abhängigkeit deutlich. Zur Erklärung der fortbestehenden Abhängigkeit wird häufig der Rentierstaatsansatz herangezogen, der die politische Entwicklung in Staaten auf ökonomische Grundlagen und vor allem die Einkommensform des Staates zurückführt. Im Kern geht der Ansatz davon aus, dass Staaten mit hohen „Renteneinnahmen“12 einerseits zu einer ineffizienten, auf den Ressourcensektor konzentrierten Wirtschaft und andererseits zu autoritären politischen Strukturen neigen (Elsenhans 1981, Schmid 1991, 1997, Chaudry 1994, 1997, Beck 2007: 45). Wenn nun die autoritären Strukturen zunächst ausgeklammert werden – sie gewinnen an anderer Stelle wieder an Bedeutung – bietet der Ansatz einige interessante Antworten auf die Frage, wieso es Staaten mit hohen externen Einnahmen einfach nicht gelingt, ihre Wirtschaft von diesem Übergewicht externer Einnahmen zu befreien:
In fact, a rapidly growing body of literature suggests that resource wealth itself, especially where it accounts for the bulk of government revenues, as in the case of the so-called rentier states, may harm a country’s prospects for development (Looney 2006: 37).
Die Form der externen Einnahmen könnte somit die Hauptursache für wirtschaftliche Probleme sein. Denn Rentierstaaten haben das Glück, über natürliche Ressourcen zu verfügen, die allein durch ihre Knappheit sehr wertvoll sind. Ihre Verkaufserlöse fließen von außen ins Land13 und können häufig direkt von den Regierungen abgeschöpft werden. Eine Eigenschaft der Rente ist, dass diese im Unterschied zu Profiten, nicht reinvestiert werden muss, um künftige Einnahmen zu sichern (Elsenhans 1981, Beck 2007: 44). Es wird davon ausgegangen, dass der fehlende Zwang, Einnahmen zu reinvestieren, eine Entwicklung und Diversifizierung wirtschaftlicher Aktivitäten bremst (Chatelus/Schemeil 1984: 255, Beck 2007: 44). In diesem Punkt unterscheiden sich erdölexportierende Staaten, laut Theorie, von steuerbasierten Produktionsstaaten, in denen der Staat ein genuines Interesse daran hat, die Einkommensverteilung in der Bevölkerung zu erhöhen, um auf diese Weise mehr Steuern generieren zu können (Luciani 1987: 73). Das zu starke Stützen auf Erdöleinnahmen bewirke, dass auch die restliche Wirtschaft finanziell von diesen Einnahmen abhängig wird.14 Den wissenschaftlichen Befunden nach sind die Auswirkungen der Rente sehr weitreichend:
So long as ‘prosperity’ of the rentier states derives from external rent, technological and organizational improvements will remain undeveloped and real economic development illusory (Yates 1996: 31).
Für diese pessimistischen Annahmen zur sozioökonomischen Entwicklung aufgrund der Einnahmestruktur – die hier zugespitzt formuliert sind – lassen sich in der Realität zahlreiche Belege finden, was die Rentierstaatstheorie zum beliebten Anhaltspunkt bei Länderanalysen macht. Insbesondere für erdölexportierende Länder des Nahen und Mittleren Ostens, Afrikas und Lateinamerikas scheint die Theorie plausible Erklärungen und klare Voraussagen zu ermöglichen. Vor allem auf Länder wie die arabischen Erdölexportstaaten (Saudi-Arabien, Kuwait, Libyen, Irak…) und Iran (Mahdavy 1970, Najmabadi 1987, Beck 2007), sowie auf lateinamerikanische Erdölexporteure (vor allem Venezuela) wurde dieser Ansatz mit einem schwer zu verleugnenden Erklärungswert angewandt und „weder die arabischen Länder noch Iran weichen von den Prognosen des Rentierstaats-Ansatzes ab“ (Beck 2007: 45).15
Obwohl das Kerntheorem von einigen der Vertreter der Rentierstaatstheorie vorsichtig formuliert werden (Schmidt 1997, Boekh/Pawelka 1997 etc.) und die Existenz von Ausnahmen bzw. abweichenden Fällen eingeräumt wird, ist der „Rentierstaats-Ansatz seinem Anspruch nach universell“ (Beck 2007: 42). Die weiter bestehenden autoritären Herrschaftssysteme und die nach wie vor wirtschaftlich ineffizienten Strukturen in Rentierstaaten scheinen den Ansatz auch in Zeiten sinkender Erdöleinnahmen zu bestätigen.
Sowohl die Rentierstaatstheorie als auch die „Ressourcenfluch“-These können als gängige Theoreme betrachtet werden, die viel zitiert und angewendet werden, und häufig auch die plausibelsten Antworten auf die Frage der Unterentwicklung sowie wirtschaftlichen und politischen Fehlentwicklungen in erdöl- und andere ressourcenexportierende Länder zu liefern scheinen. Die Kritiker der Rentierstaatstheorie bemängeln allerdings die stark ökonomistische Auslegung (Herb 2005) oder die ausgeblendeten internationalen Zusammenhänge (Neelsen 1997).
So gibt es auch Beispiele von Ländern, denen trotz sehr hoher externer Einnahmen diese negativen Effekte erspart blieben. Ein gerne genanntes Beispiel unter den Erdölländern ist dabei Norwegen (Larsen 2004, Harks 2007). Dies legt nahe, nach intervenierenden Faktoren zu suchen, wie beispielsweise die politische Kultur oder den Stand der politischen Entwicklung zum Zeitpunkt der Erdölfunde („Context Matters“, Basedau 2008; Karl 1999: 38). Außerdem gibt es zahlreiche historische Hinweise dafür, dass Ressourcen für die technologische und wirtschaftliche Entwicklung einiger Länder unabdingbar waren (USA, Kanada…).So betrachten Autoren wie De Ferranti et al. (2002: 6) es als “impossible to argue that Australia, Canada, Finland, Sweden and the United States did not base their development on their natural resources”.Wright und Czelusta (2004) zeigen die Dynamik der Erdölindustrie und der OEL auf und belegen, wie wichtig gerade die Erdölproduktion für die wirtschaftliche Entwicklung der USA war. Sie heben die Bedeutung von Wissen und passender Politikgestaltung für die landesspezifische Entwicklung hervor:
Many other resource-based economies have performed poorly, not because they have overemphasized minerals but because they have failed to develop their mineral potential through appropriate policies (Wright/Czelusta 2004: 8).
Sie unterstreichen die Bedeutung von Lerneffekten und historischen Umständen, die für die wirtschaftliche Entwicklung entscheidend sein können (Wright/Czelusta 2004: 36). Einige Autoren stellen zudem die Validität der Argumente und der Methodologie in Frage (unter anderem Stijns 2005; Wright/Czelusta 2004; Lederman/Maloney 2002, 2008, 2012). Damit ist der Rentierstaatsansatz für die wirtschaftliche Entwicklung nur begrenzt erklärungskräftig.
b.Volatiles Wachstum
Wie bereits erwähnt wird häufig angenommen, dass der „Ressourcenfluch“ dazu führe, dass Länder mit großem Ressourcenreichtum zu einem geringeren Wirtschaftswachstum neigen als ressourcenarme Länder (Sachs/Warner 2001: 827). In quantitativen Large-N-Studien wurden in der Tat starke Korrelationen zwischen geringerem Wirtschaftswachstum und dem Vorhandensein von natürlichen Ressourcen gefunden (z. B. Auty 1993, 2001, Sachs/Warner 1995, 1997, 2001, Gylfason et al. 1999; Mehlum et al. 2006; Boschini et al. 2007, van der Ploeg/Poehlhekke 2009). Den Autoren zufolge könnten andere Variablen die schwachen Wachstumsraten kaum erklären und vor allem der Ressourcenreichtum (genauer: die Abhängigkeit von den Ressourcenexporteinnahmen) wäre ausschlaggebend. Dabei werden diverse natürliche Ressourcen in die Kalkulation einbezogen (Mineralien, Diamanten und weitere Edelsteine, Erdöl und Erdgas). Andere Studien berechnen explizit die Effekte von Erdöl und entdecken hier einen spezifischen „Ölfluch“ bzw. „Oil curse“, der ebenfalls die wirtschaftliche Entwicklung stark einschränkt (Kaldor et al. 2007, Sala-i-Martin/Subramanian 2003, Smith 2004). Neben den quantitativen Cross-Country Analysen bestätigen auch einige Länderanalysen die wirtschaftlichen Aspekte der Ressourcenfluch-These (beispielsweise Venezuela, siehe Karl 1997).
In anderen Studien wurde der Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Reichtum an natürlichen Ressourcen dagegen in Frage gestellt und die Skepsis an den eingangs genannten Studien ebenfalls mit (deutlich robusteren) quantitativen Ergebnissen untermauert (Wright/Czelusta 2004, Stijns 2005, Herb 2005, Brunnschweiler/Bulte 2006, Alexeev/Conrad 2009a, 2009b, Lederman/Maloney 2007, 2008, 2012). Sie ziehen die zuvor erbrachten statistischen Beweise für den „Resource Curse“ stark in Zweifel (siehe auch Di John 2007) und kritisieren sowohl die Indikatoren, mit denen die Korrelationen errechnet wurden, als auch die Schlussfolgerungen. Sie gehen so weit, die ursprüngliche Ressourcenfluch-These als „Red Herring“, d. h. als „falsche Fährte“, zu bezeichnen (Brunnschweiger/Bulte 2006). Dennoch stünde die Ressourcenfluch-These laut Ledermann/Maloney (2008: 1) zäh „wie Graf Drakula“, immer wieder neu auf und erhalte viel mehr Aufmerksamkeit, als ihr eigentlich zustünde.Sie kommen zu dem Schluss:
Clearly the resource curse remains elusive. The cross-country econometric evidence remains weak, with results changing depending on the empirical proxies used to represent relative endowments (Lederman/Maloney 2008: 7).
So wird oft fälschlicherweise von Ressourcenreichtum gesprochen, wenn Indikatoren für den Exportanteil des Erdöls verwendet werden, was nicht valide ist. Diese Indikatoren sagen viel mehr über die Einkommensstruktur und die Abhängigkeit von den Einnahmen aus dem Ressourcensektor aus, als über tatsächlichen Reichtum (Brunnschweiler 2006). Deshalb bieten Brunnschweiler und Bulte (2006) andere Indikatoren an und kommen mit ihnen auch zu anderen Ergebnissen als die ursprünglichen Ressourcenfluch-Theoretiker.
Aus der Abhängigkeit vom Export wiederum lässt sich nicht geringes Wirtschaftswachstum, sondern vielmehr die Volatilität des Wachstums erklären, was möglicherweise das eigentliche Problem ist:
In fact, a standard measure of volatility, the coefficient of variation, shows that resource-rich countries experience 60 per cent greater volatility in their growth than the global norm (Siegle 2009: 47)
Seit der Veröffentlichung der ersten Artikel Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre und des oben zitierten Artikels von Sachs/Warner (2001) hat sich viel getan, und mit den steigenden Preisen sind auch die Einnahmen und die Wachstumsraten wieder angestiegen. Einige der Forscher, formulieren ihre Annahmen jetzt vorsichtiger,16und andere, die zuvor Beiträge zur Bestätigung des Ressourcenfluchs im Sinne von Sachs und Warner 2001 geleistet haben (z. B. Ross 2001, 2003, 2006), sind später zurückgerudert und sehen die Dinge heute differenzierter (Ross 2012).17So beobachten auch Vertreter des Ressourcenfluchs, dass
[t]he run-up in prices of certain natural resource commodities in recent years, particularly oil, has provided a substantial boost to growth rates (and government revenues) in resource rich states (Siegle 2009: 46-7).
Stijns (2005) kommt zu dem Schluss, dass vor allem Lernprozesse dafür entscheidend seien, ob die positiven oder die negativen Auswirkungen von Reichtum an natürlichen Ressourcen auf Wirtschaftswachstum überwiegen. Das folgende Schaubild (Abb. 1.2) zeigt das Wirtschaftswachstum ausgewählter erdölexportierender Länder in dem Zeitraum 1979-2010. Es springt sofort ins Auge, dass das Wachstum in den erdölexportierenden Ländern zu manchen Zeiten durchaus stark war und sogar Zahlen über 10 oder gar 20 Prozent Zuwachs gegenüber dem Vorjahres-BIP erreichten. Damit darf bzw. muss zumindest das Kriterium der Höhe des gesamtwirtschaftlichen Wachstums zur Messung wirtschaftlicher Performanz in ressourcenexportierenden Staaten in Frage gestellt werden. Während man in den 1980er und 1990er Jahren viele geringe und im Minus stehende Wachstumsraten entdecken kann – also in der Phase, als die ersten Artikel über den Ressourcenfluch erschienen – sanken die Raten zwischen 2000 und 2008 nicht mehr so tief und wiesen sogar weitgehend positive Werte auf.18 Es fällt allerdings auch auf, dass die Wachstumsraten sehr unterschiedlich waren und damit von weiteren Faktoren und nicht nur dem Erdölpreis oder der –nachfrage beeinflusst wurden, die sich für alle ähnlich gestalteten.
Abbildung 1.2:Volatilität des Wirtschaftswachstums in ausgewählten erdölexportierenden Ländern 1979-2011





























