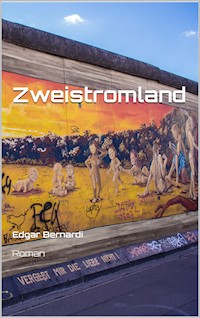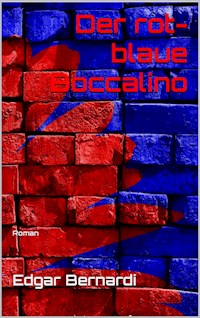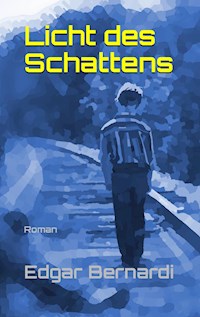
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ab edition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Coming of Age, das oft so beginnt. Eine Geschichte, die man nachempfindet. Nur dass Erich schon früh als Trennungskind auf sich alleingestellt ist, ohne den Vater erwachsen werden muss und ständig nach Nähe und Wärme sucht. Für eine kurze Zeit findet er sie in seiner ersten großen Liebe in dem noch fast unberührten Griechenland, doch gesellschaftliche Normen verhindern, dass diese Liebe bestehen darf. Er verliert seinen Stiefvater und später seinen älteren Bruder, der ihm Vaterersatz war. Von fast allen Freunden getrennt, lebt er zurückgezogen, nachdenklich in der Reflektion über Zufall oder Bestimmung, im Bewusstwerden der Familienketten, in die man über Generationen gelegt wird. Und dann sucht er nach 34 Jahren der Entbehrung seinen Vater. Licht des Schattens erzählt vom Erwachsenwerden, von der immerwährenden Suche nach den Wurzeln und der Sehnsucht – und von der Frage nach Zufall oder Bestimmung im Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
Ein Coming of Age, das oft so beginnt. Eine Geschichte, die man nachempfindet. Nur dass Erich schon früh als Trennungskind auf sich alleingestellt ist, ohne den Vater erwachsen werden muss und ständig nach Nähe und Wärme sucht. Für eine kurze Zeit findet er sie in seiner ersten großen Liebe in dem noch fast unberührten Griechenland, doch gesellschaftliche Normen verhindern, dass diese Liebe bestehen darf. Er verliert seinen Stiefvater und später seinen älteren Bruder, der ihm Vaterersatz war. Von fast allen Freunden getrennt, lebt er zurückgezogen, nachdenklich in der Reflektion über Zufall oder Bestimmung, im Bewusstwerden der Familienketten, in die man über Generationen gelegt wird. Und dann sucht er nach 34 Jahren der Entbehrung seinen Vater.
Licht des Schattens erzählt vom Erwachsenwerden, von der immerwährenden Suche nach den Wurzeln und der Sehnsucht – und von der Frage nach Zufall oder Bestimmung im Leben.
Der Autor
Edgar Bernardi, beobachtender Physiker, würde sich eher als emotionalen statt kopf-gesteuerten Naturwissenschaftler sehen. Denn er will nicht nur verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält, sondern auch die Menschen und sich selbst im Spiegelbild dazu. Sein Debütroman Licht des Schattens ist eine Coming-of-Age-Erzählung, ein biografisch-philosophischer Versuch einer Selbstfindung. Dazu befragt, warum er schreibt: Schreiben ist für mich ähnlich einem Traum, das Erlebte verarbeiten.
Licht des schattens
Edgar Bernardi
Roman
1. Auflage
Juni 2020
Copyright © 2020: alle Rechte beim Verlag ab edition
Umschlag-Design: Auszug ‚Greyerbaby‘ | Lisa Runnels | Pixabay(freeware)
Verlag ab edition
avant ag
Via Righetti 3
CH-6982 Agno
Schweiz
www.ab-edition.ch
Lektorin: Katja Völkel, Dresden
e-Book
auch erschienen als Taschenbuch
ISBN 979-8-664-35482-9
www.ab-edition.ch/Licht-des-Schattens
… an meinen Vater:
inhalt
KAPITEL 1
Die erste Wahrheit ist der Tod
KAPITEL 2
Ich wollte ja nichts als zu leben versuchen, was von selber aus mir heraus wollte.Warum war das so schwer?
KAPITEL 3
Und zuerst würde er Schatten am leichtesten erkennen, hernach die Bilder der Menschen und der andern Dinge im Wasser, und dann erst sie selbst.
KAPITEL 4
Das Träumen, besteht das nicht darin, wenn jemand, es sei nun im Schlaf oder auch wachend, etwas einem Ähnliches nicht für ähnlich, sondern für jenes selbst hält, dem es gleicht?
KAPITEL 5
Ich bin Techniker und gewohnt, die Dinge zu sehen, wie sie sind.
KAPITEL 6
Ein Körper verhält sich zum Raume wie ein Sichtbares zum Lichte.
KAPITEL 7
Die Frauen schinden, um den Mann zu treffen.
KAPITEL 8
Sie haben mich oft bedrängt von Jugend auf, aber sie haben mich nicht überwältigt.
KAPITEL 9
Also wenn die Messkunst uns nötigt, das Sein anzuschauen, so nützt sie; wenn das Werden, so nützt sie nicht.Δx·Δp ~ ћ
KAPITEL 10
Man muss unterscheiden, aber man darf nicht trennen, sonst wird beides steril.
KAPITEL 11
Mein Gott, wieviel Blau verschwendest Du, damit wir Dich nicht sehen!
KAPITEL 12
Ich erhoffe nichts. Ich fürchte nichts. Ich bin frei.
prolog
♫
Heart over mind, yes I’m my father’s son.I live my life, just like my father’s doneIf he’d told me, one dayThat somebody’d have my heart in chainsWould I believe it, no way.
Made up my mind I’d never fall that way.
But tell me whyEvery time I try, to tell you it’s GoodbyeI can’t seem to let goIn my heart I know I want to stay, What I am trying to say…I just can’t seem to let goIn my heart, I know I want to stay, never run away
My Father’s Son, Joe Cocker
♫
How can I try to explain, when I do he turns away againIt’s always been the same, same old storyFrom the moment I could talk I was ordered to listenNow there’s a way and I know that I have to go awayI know I have to go
All the times that I cried, keeping all the things I knew inside,It's hard, but it's harder to ignore itIf they were right, I'd agree, but it's them you know not meNow there’s a way and I know that I have to go awayI know I have to go
Father and Son, Cat Stevens
♫
Somewhere down the road, you’re gonna find a placeIt seems so far, but it never isYou won’t need to stay, but you might lose your strengthOn the wayDon’t be shy, even when it hurts to sayRemember, you’re gonna get hurt someday, anywayThen you must lift your head, keep it thereRemember what I saidI’ll always be with you, don’t forgetJust look over your shoulder I’ll be thereIf you look behind you, I will be there
Father to son, Phil Collins
Kapitel 1
Ή πρώτη ἀλήϑεια εἶναι ὁϑὰνατος
– Die erste Wahrheit ist der Tod –
Odysseas Elytis
L
eblos, als es zur Welt kam! Bei seinen früheren Kindern war es anders. Karl-Heinz versuchte sich zu erinnern und spürte sogleich, dass etwas nicht stimmte. Hilflos und verloren stand er da, in dem kleinen Schlafzimmer ihrer 2-Zimmer-Wohnung, oben im Speicher der Häuserreihe der Arbeitersiedlung, seine Frau betrachtend, die – noch von Schmerz und Erschöpfung gezeichnet – mit gespreizten Beinen halb auf dem Bett ausgestreckt und mit ihren Unterleib über der Schüssel mit heißem Wasser hing, die vor dem Bett stand. Hier, wo bisher alle anderen Geburten stattgefunden haben, normal, ohne Probleme, trotz dieser Umstände, heute war es ganz anders. Etwas stimmte nicht, das spürte er auch als – körperlich nicht an der Geburt beteiligter – Mann.
Warum sagte die Hebamme nichts, warum tat sie so, als sei alles normal? Karl-Heinz schaute sie fragend an, aber sie erwiderte nicht mal seinen Blick. Er fühlte sein Herz klopfen, heftig, bis oben hin, bis zum Hals.
„Verlassen Sie bitte das Zimmer“, sagte sie, als er leise zu weinen begann, „gehen Sie, bitte, die Mutter kann jetzt keine weitere Aufregung mehr gebrauchen.“
„Mein Kind, mein Kind, meine erste Tochter, was kann ich nur tun?“, schluchzte er im Hinausgehen.
Nicht einmal richtig anschauen durfte er es, als ob er schuld wäre an seinem Zustand. Endlich ein Mädchen? Auch das hatte er nicht richtig erkennen dürfen.
Nun war Karl-Heinz allein, zum wiederholten Mal allein, mit sich, mit dem inneren Schmerz, mit der dumpfen Verzweiflung; und wieder ohne einen Trost, niemand stand ihm bei, denn er fühlte sich schuldig, erneut schuldig. Bilder und Gedanken aus Vergangenem wirbelten, immer stärker werdend, in seinem Kopf, vermischten sich mit dem Gegenwärtigen, mit Ungewissheit, Verzweiflung und dann – doch wieder – Hoffnung!
Seine eigene Kindheit kam ihm dabei bruchstückhaft in Erinnerung: Krieg, Überleben, Gewalt, das älteste von vier Kindern, einer, der früh erwachsen werden und eine Lehre als Handformer in der Gießerei beginnen musste. Seine Mutter: keine Zeit! Sein Vater: Prügel! Seine spätere Frau: mehr der sichere Hafen als die Zuneigung, weg, bloß weg vom Elternhaus.
Das deutsche Wirtschaftswunder ging an ihm vorbei. Es gab zwar Arbeit für ihn als Handformer in der Concordia-Hütte, fürs Reichwerden fehlte ihm jedoch das elterliche Sprungbrett. Stattdessen brachte seine Frau ihm jeden Mittag sein Ess-Kachelchen vorbei, zwei durch ein Blechband verbundene Töpfe, in denen sich getrennt auf der einen Seite die Kartoffeln und auf der anderen Seite das Gemüse befanden. Für Fleisch reichte der Lohn nicht.
Die Arbeitersiedlung, in der sie nach ihrer Heirat im Speicher ganz oben in zwei Zimmern wohnten, bevor sie später in eine etwas größere Wohnung ein Stockwerk tiefer umzogen, war eine Kolonie von zwölf Häusern, liebevoll 12 Apostel genannt, welche die Concordia-Hütte für ihre einfachsten Arbeiter errichtet hatte, nicht weit von der Gießerei entfernt. Die Vorderseiten der Häuserreihe waren unverkleidet, lediglich eine graue Fassade aus Rauputz, unterbrochen von kleinen Fenstern auf beiden Etagen. Auf der Rückseite hatte man schmale Holzbalkone an die Wand »gehängt«, jedoch nur in den oberen Etagen. Hinter den Häusern, die in sechs Zweier-Blöcken an der Längsseite aufgereiht nebeneinander standen und dazwischen den Zugang zum Hinterhof freigaben, floss ein schmaler Bach in einem erhöhten künstlichen Bett, in dem die Frauen ihre schmutzige Wäsche und auch die vollgeschissenen Kinderwindeln waschen mussten. Das Trinkwasser zapfte man an einer zentralen gemeinsamen Wasserstelle, eine Wasserversorgung in den Häusern gab es nicht. Die wöchentliche Miete für diese spärliche Wohnung war für Karl-Heinz als Handformer gerade bezahlbar und wurde ihm direkt von seinem Wochenlohn abgezogen. Den Rest gab es in der Lohntüte in bar.
„Welch’ hübsches Kind …“, murmelte Karl-Heinz mit tränengefüllten Augen, als er wieder in das Zimmer durfte und das leblose Kind betrachtete. Plötzlich war er wieder in der Wirklichkeit zurück, die er gar nicht wahrhaben wollte, die er verwünschte, ja, die er verfluchte. „… aber wie schrecklich, dieser Anblick, so in der aufgeplatzten Fruchtblase!“, brummelte er zaghaft vor sich hin, indessen ihm die Szene unmissverständlich die Realität reflektierte.
Die Hebamme half ihm dabei, den kleinen leblosen Körper in den Karton zu legen, den er in der Zwischenzeit aus dem Keller hochgeholt hatte. Karl-Heinz nahm ihn an sich, seine Knie wurden weich, er schwankte, sie legte ihm ihre Hand auf seine Schulter.
„Ich wünsche Ihnen viel Kraft“, sagte sie und schob ihn mit sanftem Druck, den Karton fest unter seinem Arm, zur Tür hinaus.
Mechanisch, ein Schritt gleich dem anderen, stieg er Stufe um Stufe die Treppe hinab, langsam und bemüht gleichmäßig, aber zittrig, stellte den Karton vor der Haustür ab, überquerte den Hof, öffnete die Holztür des Schuppens, nahm sein Fahrrad, lenkte es nach draußen und zurück zur Haustür, fuhr mit dem rechten Fuß den Seitenständer aus, nahm den Karton vom Boden und klemmte ihn, etwas unbeholfen, auf den Gepäckträger.
Nicht allzu stabil, dachte er, während er vorsichtig und mit einem Schaudern den Sitz des Kartons prüfte. Wird schon gehen, bis zum Friedhof ...
Es war Sommer und heiß an diesem Tag, selbst jetzt noch, obwohl die Nacht schon längst angebrochen war. Den Dynamo hatte er nicht angeschaltet, bloß kein Licht jetzt! Er wollte von niemandem gesehen werden, niemandem begegnen.
Ist sie wirklich tot, zweifelte er erneut. Sie ist doch so hübsch. Ihr kleines Gesichtchen sah er noch immer vor sich. Schrecklich, der Anblick, wie eine verhüllte Maske unter einem Seidentuch, vielleicht lebt sie doch noch, vielleicht ist sie nur krank. Aber Karl-Heinz traute sich nicht, abzusteigen und den Karton zu öffnen. Vielleicht atmet sie noch, vielleicht nur irgendeine Schwäche, angeboren, wer weiß, versuchte er sich gedanklich an den letzten Funken Hoffnung zu klammern.
Warum nur, und wodurch? Der Arzt, den die Hebamme rief, hatte nur die Herztöne versucht zu hören, und danach stumm den Totenschein ausgefüllt. Kein Wort, keine Erklärung, ob er etwas weiß, es aber verheimlicht? Karl-Heinz wünschte sich, dass man in einigen Jahren in der Forschung weiter sein würde. Medizinisch wäre dann alles zu behandeln, aber heute, heute muss sie noch sterben, meine Tochter. Eine gute Kinderklinik, Überwachung von Puls, Herz, Atmung– das wird in Zukunft vielleicht möglich sein, würde man ihr dann helfen können?
Er trampelte fester, fuhr schneller, bekam Angst, die Kontrolle zu verlieren, da er noch immer ohne Licht fuhr und außer ein paar schemenhaften Silhouetten von Bäumen und Häusern, die in immer kürzeren Zeitabständen an ihm vorbeihuschten, kaum etwas sehen konnte. Er vergaß nahezu den Karton hinter sich, der fast vom Gepäckträger zu rutschen drohte.
Noch bis zum Ende der Straße, die Anhöhe hoch, danach rechts abbiegen, dann den Friedhofswärter raus klingeln, ob er schläft oder nicht. Seine Tränen liefen ihm in den Mundwinkel, er schluchzte.
Warum ich, warum traf es mich, warum ausgerechnet mich?
Es war die Nabelschnur, hoffte er die Hebamme sagen, um den Hals geschnürt, wahrscheinlich beim Drehen im Mutterleib.
Und der Arzt? Die Diagnose des Arztes? Davor hatte er Angst.
Nein, es ist wahr, mein Kind ist tot, nach 8 Monaten, einfach tot! Seine Gedanken drehten sich zwischen Hoffen und Gewissheit.
3 Tage hatte es bereits tot im Bauch gelegen, es gab keine Herztöne mehr von sich, mit Rizinusöl und Chinin hat die Hebamme die Geburt einleiten müssen. Kein medizinischer Fortschritt hätte hier noch helfen können.
Plötzlich kamen ihm erneute Zweifel. Woher nur die Sicherheit, mit der die Hebamme und der Arzt reagierte, keine Fragen, keine Vermutung, nichts.
Wussten sie etwa, was vorgefallen war, und suchten dafür eine plausible Erklärung? Wollten sie meine Frau nur beruhigen? Wollten sie mir die Schuld nehmen? Warum mir, warum traf mich die Schuld, warum mich, wieso mich allein?
Ich liebe meine Frau, normal, ganz normal, so wie man als Ehemann und Vater seine Frau und seine Kinder liebt, liefen seine Gedanken weiter, während er mit seinem Fahrrad und dem ungewöhnlichen Gepäck durch die leeren Straßen fuhr.
Nicht übertrieben, abgöttisch, nein – normal, ganz normal. Und sie? Ich weiß es nicht, ich weiß noch nicht einmal, wann wir uns zuletzt gegenseitig Ich liebe dich gesagt haben, versuchte er sich seiner und ihrer Gefühle zu erinnern.
Und nun – das zweite Kind, vielleicht in weniger Liebe gezeugt als das erste. Und weniger Liebe, heißt das dann auch, weniger Leben, also leblos, nahezu tot?
„Sie entschuldigen, dass ich Sie noch so spät störe, aber ich …“
Verärgert schaute ihn der Friedhofswärter an, begriff aber gleich, dass er um keinen Aufschub bitten konnte.
„Ihr Kind?“, fragte er mitleidig und spürte, wie sein Gegenüber heftig zu schluchzen begann.
Er nickte nur, und dachte: Ja, MEIN Kind, meine einzige Tochter!
„Heute Nacht?“
Karl-Heinz nickte stumm.
Dann ging der Wärter zurück ins Haus, nahm Taschenlampe, Schlüssel und Jacke, zog beim Herausgehen die Haustür hinter sich zu und lief stumm voraus, die Straße entlang, auf der sein unangemeldeter Gast gekommen war, bog irgendwann ab, in Richtung Friedhof. Er öffnete das Friedhofstor, wies den nächtlichen Besucher samt Fahrrad hinein, schloss es wieder hinter sich, ging auf die Kapelle zu, nahm aus dem Seitenschuppen Spitzhacke und Schaufel und sagte: „Beten können Sie am Grab. Welches soll’s denn sein?“
„Das meiner Mutter“, erwiderte er und zeigte in die Richtung.
Der Wärter stapfte los, zwischen den Gräbern entlang, Karl-Heinz folgte ihm, mit dem Karton noch immer auf dem Fahrrad, seine Knie wurden wieder weich, seine Beine begannen zu zittern. Noch einmal sehen, noch einmal, wenn auch verschleiert, aber: unschuldig verschleiert, wie eine Braut, un-schuldig, ohne Schuld, nach so wenig Leben ...
„Hier?“, fragte der Wärter nur.
Er nickte wieder.
Und während der Friedhofswärter mit dem Ausschaufeln des Grabes begann, stellte er das Fahrrad ab, nahm den Karton vorsichtig vom Gepäckträger und legte ihn auf den nächtlich kalten Boden, öffnete am ganzen Körper schlotternd den Deckel, knipste die Taschenlampe an und schaute es an, das kleine Wesen, verhüllt, in seinem natürlichen Schleier: das kleine Näschen stak hervor, die zarten Pausbäckchen, die winzigen Äuglein, die Händchen, Füßchen, wie süß sie doch da lag, in ihrem weißen Himmelbettchen.
Er spürte den Griff des Friedhofswärters an seinem Arm.
„Kommen Sie“, sagte der Mann und deutete auf das kleine Loch, das er in der Zwischenzeit ausgegraben hatte. Karl-Heinz schloss den Deckel, vorsichtig hob er den Karton vom Boden, der Friedhofswärter half ihm dabei, den kleinen Papp-Sarg waagerecht in dem ausgegrabenen Loch zu versenken.
„Hat es einen Namen, Ihr Kind?“, fragte der Friedhofswärter. „Ein kleines Schild?“
„Äh …“, stammelte Karl-Heinz, „es ging alles so schnell, wir hatten keine Zeit, uns dazu Gedanken zu machen.“
Er überlegte kurz, dann schrieb er JKH auf das kleine Stück Karton, das er abgerissen hatte, J für Johanna und KH für Karl-Heinz, und steckte das Stück Pappe in den kleinen Sandhügel am Kopf des Grabes.
Nie wieder sehen, mein Kind, es nie wieder sehen. Und das Kind, es muss bereits jetzt den Vater entbehren, das kurze Leben lang, dachte er. So wie er, seine Entbehrung vom Vater, bis heute, fast sein ganzes Leben lang ...
Und wenn man dennoch, so schweiften seine Gedanken ab, die Chance hat zu leben, aufwächst, aber auf sich allein gestellt ist, ohne Vater, sich sozusagen selbst erzieht, und man den Spiegel sucht, das reflektierte Bild von sich selbst, und dann das Vor-Bild vermisst, an dem man sich orientieren kann, nur sein eigenes Bild wahrnimmt – welchen Schatten wirft dann noch das wenige Licht, wenn klare Konturen fehlen, wenn das wenige Licht nicht geformt werden kann an dem Gegenstand, der den Schatten werfen soll, sondern es ohne den Gegenstand sich selbst formen muss?
Dann erahnt man nur den Gegenstand – und darauffolgend das wenige Licht, erkennt schrittweise für sich selbst seine eigenen Konturen – und später vielleicht dennoch die Form, an dem das helle Licht den scharfen Schatten hätte erzeugen sollen. Dann war ZUERST das Kind – und DANACH erst kam der Vater …
Jetzt bist du allein, mein Kind; Karl-Heinz starrte wie gebannt auf den weißen Deckel und betete still. Er stellte sich vor, wie seine Kleine es umgekehrt empfinden musste, dort unten, im Karton, von innen nach außen, genauso wie bisher im Mutterleib.
Dich habe ich mir so gewünscht, habe so gehofft, du wärst am Leben, ob krank oder gesund, fuhr er in seinem stillen Gebet fort, in seinem unerfüllten Hoffen, obwohl ihn kurzzeitig Zweifel durchdrangen: Gewünscht? Von mir? Von uns? War es ein Wunsch, und dazu noch ein gemeinsamer? War es noch Liebe, und wenn ja, von beiden Seiten?
Es tut mir leid, dass ich dir nicht mehr an Liebe, an Kraft von mir geben konnte, versuchte er sich zu ent-schuldigen, wohl wissend, dass man sich selbst nicht von Schuld freisprechen kann. Du hättest meine Liebe, meine Kraft so sehr gebraucht.
Nein, ich hatte eine Pflicht, eine gottverdammte Pflicht, dir LEBEN zu schenken, Leben, unversehrtes Leben, nicht krank, nicht tot, nein, LEBEN! Ein Vater schenkt seinem Kind zuallererst das Leben, gibt ihm die Kraft, ist stark, entzieht sich nicht, ist der Gegenstand im Licht, der klare Konturen formt, aus denen Schatten geworfen werden können. Nein, ich habe es nicht geschafft, es tut mir leid, es tut mir so unsagbar leid, beendete er sein einfaches Gebet.
Im Weggehen hörte er das Trommeln der Erdklumpen, wie sie auf dem Karton aufschlugen, nochmals ein hoffnungsvoller Zweifel, ob es vielleicht eher ein lautes Klopfen von innen ist? Nein, es ist zu spät, es ist einfach zu spät, man kann nichts ungeschehen machen.
Dennoch versuchte er, den Moment der Zeugung wieder in sein Gedächtnis zu holen, das Zeugen eines Lebens, die damaligen Gefühle zu reanimieren.
War unser Kind das Ergebnis unserer Zuneigung, unserer Liebe, hat es irgendeine Innigkeit, irgendeine Anziehung spüren können oder war es nur die Lust, der man sich hingab, für einen kurzen Moment von Sinnen, ohne zu wissen, was man tut, was dabei rauskommt? Er fühlte den nüchternen Moment danach, jeder schnell wieder für sich, das Gefühl der innigen Vereinigung – es fehlte, mit jedem Mal mehr.
War es seine Aufgabe als Vater, Liebe und Gefühle weiterzugeben, oder nur seine Art zu erhalten im Zeugungsakt, war es das Eindringen einer einzigen von Millionen von Samenzellen in die Eizelle, so wie er als Mann in die Frau eindrang, seinem Trieb folgend, oder eine Umarmung voller Gefühle, die mit der Vereinigung endete?
Nein, es war wie immer, Mann und Frau, aber im Akt der Zeugung nur: Vater und Mutter. Sie werden nie eins …
So auch jetzt: Frauen gebären, Männer beerdigen.
Er spürte, wie in seinem Schmerz auch der Hass wieder in ihm aufstieg, eine Wut und eine Ohnmacht, die wie Messerstiche wirkten.
Ich muss zurück, ich muss mit ihr reden, so versuchte er, sich zu ermutigen – und war doch der Verzweiflung nahe.
K
lärchen war erst 16 Jahre alt, als man sie mit der Polizei abholen ließ. Es war ein kalter Winter, sie fror, trotz Mantel, den sie sich übergeworfen hatte, dazu eine Tasche in der Hand mit den wenigen Sachen, die sie brauchte. Ihren Eltern traute man die Erziehung der eigenen Tochter wohl nicht mehr zu, erst recht nicht dem pubertären Kind, das nun selbst kurz vor einer solchen Aufgabe stand. Man steckte sie in ein katholisches Waisenhaus, weitab von ihrer Heimat, wo sie ihr erstes Kind gebar – und das zu einer Zeit, in der uneheliche Kinder alleine schon Fluch und Verdammung bedeuteten, erst recht das Mutterwerden im Kindesalter. Irgendein Kellner soll sie verführt haben – ‘ne Kölsche Luftikus, erzählte man damals hinter vorgehaltener Hand in der Familie.
Einsam und mit schweren Gewissensbissen belastet hatte Klärchen ihre Tochter dort zur Welt gebracht, die Schwestern im Waisenhaus haben das Kind als Teufelswerk verflucht. Aber auch das Leben des Teufels ist des Lebens wert, also hat man sie als Kindesmutter betreut, ihr geholfen, Gottes Werk daraus gemacht. Auf den Namen Johanna wurde die Tochter getauft, sicherlich nicht heilig unter diesen Umständen, so aber doch versucht, das Kind damit vom Makel zu befreien, den ihr ihre Mutter mitgeboren hatte. Der Vater? Niemand kannte ihn, außer Klärchen, doch sie schwieg, die ganze Familie schwieg.
Alle in der Familie haben später nur Oma Klärchen zu ihr gesagt, ihre eigenen Kinder und auch ihre Enkelkinder, ein Opa Irgendwer wurde nie erwähnt, vermutlich eine geschickte Tarnung, sich in der Familie eine heile Welt vorzugaukeln, ohne zu offenbaren, dass wohl der richtige Vater von Johanna und gleichzeitig der Opa ihrer späteren Kinder in der Familie von Anfang an ausgeklammert war.
Auch über Oma Klärchens Vater wusste in der Familie niemand etwas, ebenso wenig über den Vater ihrer Schwester. Alle kannten nur Bapp, mit dem Omas Mutter Theresia später zusammenzog und der wohl – so erzählte man – geduldig alle Eskapaden von Thresje erduldete.
„Noch em Wochebett, noh minger Jeburt jing et Thresje im Köllsche Fastelowend zom Maskeball, hät jedanz und sesch schwär amüsiert!“, erzählte Oma ihre eigene Geschichte im Köllsche Dialekt, meist Sonntagnachmittags beim Kaffee. Währenddessen begann man in der Familie stets zu spekulieren, wer am meisten Uromas draufgängerische Art geerbt hatte. „Und stellt euch vor: ihr eigener Vater saß an der Kasse und hat sie nicht erkannt, erst bei der Demaskierung um Mitternacht, worauf er sie sofort nach Hause jagte, konnte damit aber den Rückschlag nach der Geburt, der somit unvermeidbar war, nicht mehr verhindern.
Später“, so Oma weiter, „ich war noch Säugling, brach sie mir beim Baden den Arm – meine eigene Mutter. Sie war eher Lebe-Frau statt Liebe-Mutter, zum Muttersein einfach nicht gemacht.
Ich wuchs bei ihren Eltern auf, bei meinen Großeltern also, ihnen blieben von ihren sechs Söhnen, die alle früh verstarben oder in den Schlachten des Ersten Weltkrieges fielen, nur noch die eine Tochter und später ich als Enkelin“, erinnerte sich Oma weiter.
„Damit hatte ich es gut“, fuhr sie fort, „wurde zwar nicht verwöhnt, aber gut erzogen, lernte Klavier, hatte viele Freiheiten, dennoch habe ich mich stets nach meinem richtigen Vater gesehnt, habe ihn immer gesucht.“ Dann schwieg sie, die Zeit mit 16 und danach hat man nie aus ihrem Munde erzählt bekommen.
Omas Schweigen machte Johannas Neugierde jedoch nur noch größer. Irgendein Tabu muss es geben, spürte sie, irgendetwas wird vertuscht. Und beginnt von da an, in ihrer eigenen Vergangenheit zu wühlen.
Ich wurde von meinem Vater adoptiert, findet Johanna schließlich heraus, als sie noch ein Kind war und ohne zu verstehen, was adoptieren wirklich bedeutet. Auch sie hatte Mühe, ihr Geheimnis zu offenbaren, musste sich aber irgendwann von dieser Last erleichtern und erzählte es später, viel später ihren eigenen Kindern.
„Was heißt adoptiert?“, fragte sie damals, zuerst ihre Mutter, dann ihren Vater. Beide blieben ihr jedoch eine Antwort schuldig. Und Johanna nahm zunächst gar nicht wahr, dass sie ihren Vater intuitiv nur Josef nannte anstatt Papa oder Vater. Vorgegeben hatten es wohl ihre Eltern selbst, nicht Papa oder dein Vater zu sagen, wenn man über ihn in der dritten Person sprach, sondern stets sagte man nur Josef.
Erst mit 19 Jahren, das wusste Johanna noch ganz genau, hat mir Omas Schwester dann gesteckt, dass Josef nicht mein Vater ist. Keine Blutsverwandtschaft also, nur eine nachträglich legalisierte, adoptierte, geduldete – nicht wirklich geliebte … Entsetzt und fassungslos fragte sie ihre Mutter. Sie jedoch schwieg.
Stattdessen spürte Oma Klärchen, wie ihre Erinnerungen sie würgten, keine Luft, keinen Ton aus ihr ließen – mit 16 verdammt aus dem Elternhaus, mit der Polizei ins Waisenhaus, ein uneheliches Kind. Wie hätte sie es ihrer Tochter auch sagen sollen?
Und auch sonst erfährt Johanna recht wenig über ihren Stiefvater Josef. Er war in Frankreich, im Zweiten Weltkrieg, als Feldjäger eingesetzt. Während des Truppenurlaubs, so konnte sich Johanna dann selbst zusammenreimen‚ wurden wohl ihre beiden Halbschwestern Theresa und Gerda gezeugt.
Einmal, so erinnert sie sich anlässlich eines Kaffeekränzchens in der Familie, während eines kurzen Truppenurlaubs, fand Mutter ein Bild in seinem Portemonnaie, eine hübsche Französin, die wohl angeblich nur seine Putzfrau war …
Ihre eigene Liebschaft jedoch mit einem deutschen Soldaten, der in Köln kurz vor Kriegsende einquartiert war, hatte ihre Mutter ihm stattdessen leichtfertig offenbart – und sich dies später in so manchem Streit, den Johanna miterlebte, immer wieder vorhalten lassen müssen.
Er war ein überzeugter Nazi, wofür sie sich oft schämte, wenngleich er nur ihr Stiefvater war. In seinem nach dem Krieg handgeschriebenen Lebenslauf las Johanna später, dass er seit 1931 Mitglied der SA und Mitglied der NSDAP war. Selbst nach dem Krieg musste er das noch immer ausführlich erwähnen, zumindest nach seiner Aussage. Er schien wohl noch immer stolz darauf zu sein, so wie er während der Nazizeit seine Naziüberzeugung offen und ohne Scham zur Schau stellte. Sogar ein Hakenkreuz hing jedes Jahr im Weihnachtsbaum, so Johannas Erinnerung.
Oma Klärchen dagegen, naiv und unbedacht, ging oft in einen kleinen Laden einkaufen, in dem Juden hinter der Theke standen. Eines Tages – Johanna kann die damalige Aufregung zu Hause noch nahezu hautnah nachempfinden, als sie über diese Begebenheit erzählt – wird sie dabei erkannt, worauf fast ihre Verbannung aus der Stadt und Josefs Entlassung als Hauptwachtmeister drohten.
Während des Krieges, so erinnert sich Johanna weiter, noch immer im Glauben, er sei ihr richtiger Vater, habe sie ihn sehr vermisst. Keine schützende Hand, kein Trost in ihren jungen Jahren, die nur von Gewalt und Zerstörung geprägt waren und währenddessen sie nur Angst, nichts anderes als Angst kannte.
Und von dem Tag, an dem sie erfuhr, dass er nicht ihr leiblicher, nicht ihr richtiger Vater ist, begann für sie eine dauerwährende Suche, begleitet von den quälenden Fragen: Warum? Warum hat mich mein Vater verlassen? Wo ist mein Vater? Warum hat er nicht einmal den Kontakt zu mir gesucht?
Erst einige Jahre nach dem Krieg kehrte ihr Stiefvater Josef endlich heim, entlassen aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft, worauf er wie so viele einem sinn- und erfolglosen Entnazifizierungsprogramm unterworfen wurde.
Somit war die ganze Familie während des Krieges ohne Josef auf sich allein gestellt. Als Bomben zum dritten Mal das Haus von Omas Eltern trafen, flohen sie endgültig aus Köln. Oma Klärchen nahm sie selbstverständlich auf, in ihrer Wohnung, in Engers, einer kleinen Stadt am Rhein. War die Wohnung ohnehin schon zu klein für die eigene Familie, kamen nun noch die Eltern und später auch noch die Schwester mit ihren drei Kindern dazu.
Während dieser Zeit wurde Johanna erwachsen, als erste und uneheliche Tochter, ohne ihren unbekannten leiblichen Vater, der irgendwo in Köln zurückgeblieben ist, und ohne ihren Adoptivvater, der irgendwo in Frankreich bleiben musste.
Vaterlos, mit zwei Halbschwestern, die Johanna seit dem Wissen über ihre eigene Adoption mit etwas distanzierten Augen sah, vertraute sie sich Rebekka an, ihrer besten Freundin, eine warmherzige und schon eher wirkliche Schwester, die trotz der rauen und feindlichen Zeit stets fröhlich und mutig war. Johanna ging bei ihr zu Hause ein und aus, versuchte, das Fröhliche und Mutige von ihr aufzunehmen, war unbedacht, nahezu naiv – denn Rebekka war Jüdin.
Das kümmerte Johanna nicht allzu sehr, sie hatte ohnehin nur eine vage Vorstellung, was genau das hieß. Ihr wurde zu Hause nur eingeschärft, dass Kontakte zu Juden nicht ungefährlich, ja, nahezu verboten waren, den Grund nannte man ihr aber nicht. Ihr Stiefvater wusste Gott sei Dank nichts davon und durfte es auch nicht erfahren, sonst hätte er – das wusste Johanna – ihr den Kontakt zu Rebekka sofort verboten. An das Risiko, einmal zusammen mit Rebekka gesehen zu werden, dachte sie nicht oder nahm es – von Rebekkas Mut beflügelt – schlicht in Kauf.
In ihrer Freundschaft verstanden sie sowieso den Rassenhass der Nazis auf die Juden nicht. Hin und wieder sprachen sie darüber, fanden in ihren jungen und naiven Jahren keine Erklärung, warum ausgerechnet Juden schlechtere Menschen sein sollten als alle anderen. Rebekka wusste nur, dass sie verfolgt würden, die Juden, und dass auch ihre Eltern darüber nachdachten, Deutschland zu verlassen. Wann, wohin und wie, das wusste sie jedoch nicht.
Eines Abends standen sie beide vor Rebekkas Haustür und wollten sich verabschieden, als mit einem polternden Lärm in hohem Bogen Möbel aus dem Fenster von Rebekkas Wohnung flogen. Schnurstracks und mutig wie immer rannte Rebekka die Treppe hoch, Johanna konnte sie vor lauter eigenem Entsetzen gar nicht mehr daran hindern. Sie sah nur die fliegenden Möbel und die Gestapo-Uniformen, schrie noch verzweifelt „Rebekka! Rebekka!“, aber nachdem sie keine Antwort mehr erhielt, rannte Johanna voller Angst nach Hause.
„Die Bilder aus diesen Zeiten, während des Krieges“, so erinnerte sie sich, als wäre es gerade passiert, während ihre Kinder im Zuhören vergeblich versuchten, diese Erinnerungen in ihre Vorstellung zu übertragen, „ich werde sie wohl nie mehr los. Auch wie entsetzt ich damals war. Meiner Mutter habe ich nichts von dem Abend mit Rebekka erzählt, sie hätte es mir wahrscheinlich ohnehin nicht erklären können, hätte eher meinen Stiefvater während des Truppenurlaubs danach gefragt – und davor hatte ich am meisten Angst. Ja, ich hatte große Angst, dass er irgendetwas davon erfährt.
Verstanden habe ich all das nicht, warum, weshalb, ich empfand nur Ungerechtigkeit, stellte mir vor, wie mein Hab und Gut aus dem Fenster fliegt, meine Wohnung, wie sie mit Gewalt geräumt wird ... “
„Und Rebekka“, fragten ihre Kinder, die ihr gespannt zuhörten, als sie vom Krieg erzählte, „was wurde aus Rebekka?“
„Ich habe sie seither nie wieder gesehen“, antwortete Johanna fast unhörbar.
„… und tags darauf“, fuhr sie nach einer ganzen Weile fort, „Großalarme und Luftangriffe, ohne Pause, aufgereiht wie eine Perlenkette kamen sie angeflogen, die Bomber, immer wieder mussten wir in nahegelegene Bunker und Stollen flüchten. Als ich in der Stadt unterwegs war, wurde ich einmal vom Angriff auf die Koblenzer Festhalle überrascht. Das Bild ist bis heute nicht aus meinem Kopf verschwunden: die brennenden Stühle, auf denen vorher noch Zuschauer saßen, und der stockdunkle Tag, mittags um 3 Uhr, vom Rauch der Phosphorbomben, die nur noch Schutt und Asche hinterließen.“
Johanna schwieg, es schien, als müssten sich wie damals Schutt und Asche erst wieder legen, bevor sie weiterreden konnte, so als wären soeben die Phosphorbomben gefallen.
Die Fliegeralarme häuften sich, inzwischen war man dem eigenen Keller entflohen und in den sicheren Bunker in der Nähe ausgewichen, der sich rasch mit weiteren Einwohnern der Stadt füllte. Als man den beengten und nach Menschen stinkenden Bunker kaum mehr verlassen konnte, entschloss sich die ganze Familie, nach Pietenfeld in Bayern zu Josefs Verwandten zu fliehen, während Josef noch immer seinen Kriegsdienst in Frankreich absolvierte.
Bapp hatte trotz Sirenengeheul keine Eile, packte die Koffer in einer ihm eigenen Ruhe, dazu verstaute er ein paar weitere Sachen, die er für wichtig hielt, in ein paar Kisten, lud alles auf einen alten Leiterwagen und zurrte es fest.
Noch ein letztes Mal kontrollierte er die verlassene Wohnung, nahm das Hitler-Bild von der Wand, stellte es auf die zurückgelassene Kommode und legte einen handgeschriebenen Zettel dazu: „Und sehen wir uns nicht in dieser Welt, so treffen wir uns in Pietenfeld.“
„Du kannst doch nicht den Leiterwagen alleine ziehen, Bapp“, rief Johanna, als sich der ganze Familientross in Bewegung setzte und keiner außer ihr Anstalten machte, ihm zu helfen. Weder Thresje mit ihren Kindern Hugo und et Jöngelsche noch Oma Klärchens Schwester Trudi mit ihren Kindern Hela und Lilo noch Oma Klärchen selbst und ihre beiden Töchtern Theresa und Gerda halfen mit, den Leiterwagen zu bewegen, nur Johanna, die älteste Tochter, schob ihn mal von hinten oder zog ihn von vorne zusammen mit Bapp am Handgriff – alle in Richtung Bahnhof, um einen der letzten Personenzüge in Richtung Süden zu erwischen.
Sie kamen nur wenige hundert Meter weit, als das kräftige Ziehen plötzlich erheblich leichter wurde: mit einem großen Krrrrach war die Deichsel des alten Leiterwagens gebrochen, wahrscheinlich durch das Gewicht der vielen Koffer und Kisten, und sie hatten nur noch den abgerissenen Griff in der Hand. Bapp begann sogleich, an der Deichsel rumzuhantieren und wollte sie reparieren, während um ihn herum weiterhin die Sirenen heulten. Die Familie wurde ungeduldig, schob Bapp nach einer Weile ein wenig barsch zur Seite, nahm die Koffer, die man nun den restlichen Weg selbst schleppen musste, während man schweren Herzens und gegen Bapps Widerstand die in Kisten verpackten Sachen am Straßenrand zurücklassen musste.
Johanna war die Mutigste, sie kommandierte die Flucht in den Graben, als unterwegs in der Nähe von Idstein tieffliegende amerikanische Streitkräfte den Zug beschossen, während Oma und ihren beiden jüngeren Töchter vor Angst fast in die Hosen machten. Johanna kommandierte auch später, nach Ende des Krieges, die Rückfahrt – oben auf dem Waggon des Güterzuges, keine Sitze, ohne Türen, nur noch Gleise, unter denen teilweise die Brücken fehlten.
Das kleine Dorf in Bayern wurde von Amerikanern beherrscht, die hier gegen Ende des Krieges einmarschiert waren und nun in der Wohnung hausten, die vorher Oma und ihre Töchter bewohnten. Beim Einmarsch der Amis versteckten sich Johanna und Theresa vor Angst auf dem Dach, denn sie wussten schon, dass Soldaten Frauen vergewaltigen würden. Nur Gerda als Jüngste spielte weiter ahnungslos auf der Straße.
Erst Wochen später – an die Amis als Besatzungsmacht hatte man sich längst gewöhnt – traute sich Johanna, mit einem von ihnen im militärgrünen Jeep zum Tanzen nach Nürnberg zu fahren. Obwohl nur ein Tanzabend und eine kurze Liebschaft: den Amerikaner mit seinem Jeep im Military-Look und dem Bekenntnis Ick lebbe disch sollte Johanna wohl nie wieder vergessen. Eine Frau vergisst wohl den ersten Mann nie, bei dem sie ihre Unschuld verlor.
Trudi war anders als ihre Schwester Klärchen: unbedarfter, mutiger, draufgängerischer. Sie ließ sich mit einem einquartierten Soldaten ein, einem WienerSchlawiner, wie man ihn in der Familie nannte. Prompt wurde sie von ihm schwanger, während der Schlawiner längst das Weite gesucht hatte und somit auch seine Tochter Ulla ihren Vater nie kennenlernen sollte, erst recht nicht mehr, nachdem man das Flüchtlingsquartier in Bayern wieder verlassen hatte. Damit begann auch für Ulla die lebenslange Suche nach ihrem Vater, nach dem einzigen Menschen, der neben ihrer Mutter Anteil an ihrem Dasein hatte.
Schließlich stieg auch bei der sonst ängstlichen Theresa das Vertrauen in die amerikanische Besatzungsmacht. Während man im Kuhstall einen russischen Soldaten versteckte, der aus dem Gefängnis ausgebrochen war und der trotz Omas guter Pflege – nur auf Stroh gebettet – im Stall verstarb, lernte Theresa das Akkordeonspielen von einem amerikanischen Soldaten. Er nannte das Instrument Little Wonder und verzückte Theresa derart, dass sie den liebevollen Kosenamen für das Akkordeon auch auf sich bezog, permanent und misstrauisch von Tante Walburga, Josefs Mutter und der Frau im Haus, beäugt.
Oma und ihre Töchter pflegten so etwas wie Zweckverhältnisse mit den Amerikanern – und auch mit dem Dorfmetzger, Herrn Hofbeck, mit Nähen, Stopfen sowie ab und an ein Küsschen, dafür gab es dann Holz, Fleisch und Lebensmittel – bei neidischer Verachtung durch die Dorfbewohner.
Johanna kam gerade aus der Dorfschule, als sie Tante Walburga weinend und schreiend zu Hause antraf. „Mein Lamm, mein unschuldiges Lamm“, schrie sie in einem fort. Ein paar Nachbarn waren vergeblich dabei, sie zu beruhigen und zu trösten. Ihr zehnjähriger Sohn Rudi, sonst auch um diese Zeit von der Schule zurück, war nirgends zu sehen.
„Was ist denn passiert?“, fragte Johanna aufgeregt, aber niemand antwortete ihr. Auch ihre beiden Halbschwestern Theresa und Gerda, inzwischen auch aus der Schule zurück, konnten der hysterisch schreienden Tante Walburga und den um sie stehenden Nachbarn nicht entnehmen, was vorgefallen war.
Johanna konnte die schrecklichen Schreie nicht mehr ertragen, trat vor die Tür, schaute auf das Feld, in dem sie so oft Tante Walburga arbeiten sah. Es lag nun brach, es war Winter, die grau-grünen Stummel der abgeschnittenen Kohl- und Wirsingköpfe waren noch zu sehen. Dazwischen der restliche Schnee, weiß-braun, vermischt mit Schlamm und Erde.
Weiter hinten erblickte sie auf dem nahegelegenen Feld ein paar Dorfbewohner, die sich gemeinsam um etwas auf dem Boden bemühten. In schlimmer Ahnung lief sie über das Feld, auf die Gruppe zu, drückte sich durch die Menge, welche sie zurückzuhalten versuchte, erreichte die Stelle, an der zwei leblose Körper im Schlamm lagen – blutüberströmt, zerrissen, einige Körperteile auf dem Feld verstreut. Beide Jungs hatten mit einem Fundstück gespielt, das plötzlich als Handgranate losging. Und wurden davon zerfetzt.
Einer von beiden, soweit konnte Johanna es noch erkennen, war Rudi, Tante Walburgas zehnjähriger Sohn.
D
er Krieg war zu Ende, erste Güterzüge fuhren wieder, mit Briketts beladen, auf denen man lag, bis man schwarz und verdreckt endlich wieder zu Hause ankam. Gute zwei Jahre waren inzwischen vergangen. Die alte Wohnung in einem Haus mit roter Backsteinfassade, weiß gefassten Fensterbögen und Balkonen mit geschwungenen Schmiedeeisen war besetzt: Herr Felsing, ein stadtbekannter alter Kommunist und späterer Bürgermeister, trug Josefs Schlafanzug, als man an der eigenen Haustür klingelte und er öffnete. Mit einem weißen Betttuch soll er, Kommunist hin oder her, den einmarschierenden Amerikanern entgegengelaufen sein.
„Ihre Möbel sind eingelagert“, erklärte ihnen der Besetzer und neue selbst ernannte Besitzer ihrer eigenen Wohnung, ohne sie eintreten zu lassen.
Oma Klärchen und Johanna gingen also zu dem Lager, um ihre Betten, Matratzen und sonstigen Sachen zu suchen. Oma erkannte kaum etwas wieder, traute sich auch nicht, in der Not das, was sie brauchte, spontan und eigennützig einfach zu ihrem Eigen zu erklären, und so nahm sie nur ihre Nähmaschine mit zurück, die sie ohne Zweifel als die ihrige identifiziert hatte. Die Kinder schimpften und weinten, als sie nur mit der Nähmaschine bepackt in ihrem neuen provisorischen Zuhause ankam, denn mangels Bett und Matratzen mussten sie weiterhin auf dem Boden schlafen.
Auch Franzosen, die Besatzungsmacht am Rhein, hatten Häuser besetzt, hielten sich Hausangestellte, die regelmäßig untersucht werden mussten, weil – so die vorverurteilende Meinung – frivole Franzosen stets Geschlechtskrankheiten verbreiteten.
„Da gehst du nicht mehr hin“, befahl Johannas Chef, Monsieur Polé, bei dem auch sie als Hausangestellte untergekommen war, und bewirkte beim Gesundheitsamt, dass sie an diesen regelmäßigen und unangenehmen Untersuchungen nicht mehr teilnehmen brauchte.
Irgendwann kam Josef aus seiner Gefangenschaft zurück, der Krieg war schon lange zu Ende, zerbrochen, zermürbt, aber noch immer davon besessen, zu beherrschen, Macht auszuüben, seine Autorität zur Schau zu stellen.
Aus einem ausgedienten Betttuch hatte Johanna sich ein Kleid genäht, zu offen im Ausschnitt und im Schritt, befand ihr Stiefvater. Eines Tages kam sie damit, inzwischen deutlich geschlossener, zur Arbeit – darunter dennoch blau-rote Striemen deutlich sichtbar.
„Was ist passiert, mon cœur?“, fragte Monsieur Polé besorgt.
„Mein Vater fand mein Kleid zu offen, zu freizügig“, gestand ihm Johanna unter heftigen Tränen.
Monsieur Polé brauchte keine weitere Erklärung, stattdessen machte er sich spontan auf den Weg zur Wohnung des Stiefvaters seiner ihm anvertrauten Hausangestellten. Kaum dort angekommen, musste sich der bisher alleinherrschende Josef als Feldjäger und Hauptwachmeister erstmals von Herrn Polé lautstark seine Grenzen aufzeigen lassen. „Nie wieder wirst du sie so misshandeln!“, drohte Monsieur Polé. „Nie wieder, hast du mich verstanden?“, denn inzwischen hatte Josef ihm gestanden, dass er seine Stieftochter mit einer Klopfpeitsche für das zu offen getragene Kleid bestraft hatte.
Die Besatzungszeit ging zu Ende, die Franzosen zogen sich langsam wieder in ihre Heimat zurück. Mit der ihm eigenen Resolutheit sagte Monsieur Polé zu Johanna: „Mon cœur, tu retournes avec moi!“ Voller Freude und entschlossen, mit Monsieur Polé nach Frankreich zu gehen, kam sie nach Hause und bat ihre Eltern um Erlaubnis, doch Josef, ihr Adoptivvater, war dagegen. Franzosen sind Deutschhasser, so Josefs knappe Erklärung. War es nur Verantwortung? Oder wieder einmal die Demonstration seiner Macht, die trotz Entnazifizierung noch immer seinen Charakter prägte?
Enttäuscht und trotzig blieb Johanna somit in Engers, der Provinzstadt am Rhein, in die sie nach Kriegsende unter abenteuerlichen Umständen zurück-gekehrt waren, lernte beim Tanzen ihren künftigen Mann Karl-Heinz kennen – und wurde mit 22 Jahren schwanger.
„Du hast dich mit ihm hingelegt, du musst ihn jetzt auch heiraten“, waren Josefs unmissverständliche Begleitworte, mit denen er seine Adoptivtochter Johanna auf den Weg in eine unglückliche Zukunft stieß.
Und nur dank dieses Machtwortes seines Stiefopas wurde Wolfram zumindest nicht unehelich geboren.
Anfangs schien es, als seien Karl-Heinz und Johanna nicht ganz so unglücklich mit dem Start in ihre ungewollte Ehe. Man erfreute sich an dem ersten gemeinsamen Kind – und glaubte, es bringe auch irgendwann einmal das noch fehlende Glück zwischen beiden Eltern.
Das achtzigste Geburtsjahr von Konrad Adenauer brach an, und gleichzeitig das Geburtsjahr der Bundeswehr in der BRD sowie der Nationalen Volksarmee in der DDR. Deutschland war wieder wer, diesseits und jenseits der Zonengrenze, nachdem Adolf Hitler vom Amtsgericht Berchtesgaden amtlich für tot erklärt wurde.
Nierentische schmückten deutsche Wohnzimmer, in England wurde das erste Kernkraftwerk in Betrieb genommen. Der Rhein war zwischen Bingen und Oberwesel völlig zugefroren, im kältesten Winter seit 200 Jahren.
Im Radio sang Freddy Quinn Schön, so schön war die Zeit, als Erich in dieser kalten Jahreszeit gezeugt wurde, inzwischen das vierte Kind dieser unglücklichen Muss-Ehe zwischen Johanna und Karl-Heinz.
Keine Freude, keine Tränen, Karl-Heinz drehte sich um und verließ wortlos das Zimmer, als er sah, dass ihm ein Junge geboren wurde.
Dazu kam, dass es ein Unfall war, der Hausarzt sollte es abtreiben, aber er weigerte sich konsequent als überzeugter Katholik.
Also versuchte Johanna es selbst, mit Stricknadeln bewaffnet, unter höllischen Schmerzen. Vergeblich. Und so begann Erich sein Leben. Ein ungeliebtes Leben, das eigentlich schon endete, bevor es überhaupt begonnen hatte.
Und an diesem Tag, mit dem missglückten Versuch der schmerzlichen Trennung von diesem ungewollten Kind, entschloss sich Erichs Mutter im Stillen, sie war erst 28 Jahre alt, sich auch von ihrem noch nie geliebten Mann zu trennen, und den Vater ihrer vier Kinder für immer zu verlassen.
„W
ann darf ich endlich zu ihr?“, fragte seine Frau aufgeregt und ungeduldig, als Erich zurückkam, „ich muss sofort zu meiner Tochter, sie braucht mich, ich muss sie sehen.“
„Du musst erst wieder zu Kräften kommen“, antwortete er besorgt. „Du darfst so schnell noch nicht wieder aufstehen. Es geht ihr gut, die Ärzte kümmern sich um sie“, beschrieb Erich seiner Frau vereinfachend den Zustand ihres gerade geborenen Töchterchens, das auf der Intensivstation der Kinderklinik lag, um sie nicht weiter zu beunruhigen.
Es war nur ungewöhnlich, dass es sich kaum bewegte, ganz anders, als er es von seinen beiden anderen Babys kannte. So kurz nach der Geburt, es sollte sich doch Leben zeigen, ein Schreien, Zappeln – nichts dergleichen. Nur ganz bedächtig, ruhig, fast wie in Zeitlupe, hatte er seine zarten Bewegungen beobachtet.
„Das ist doch nicht normal“, entfuhr es Erich, während er zu dem Arzt aufschaute, der plötzlich neben ihm stand.