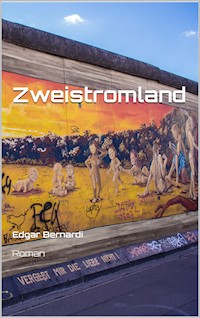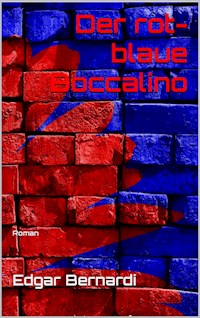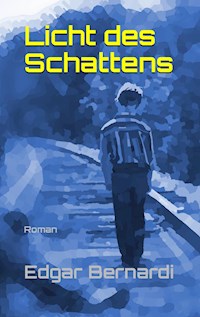6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ab edition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sein Arzt spricht etwas nebulös von wenigen Tagen. Genauer kann er es nicht sagen. Doch in der Diagnose ist er sich sicher, todsicher. Konrad Bleuer bezweifelt den Befund. Wahrheit gegen Hoffnung. Er ist einsam, lebt als theoretischer Physiker in einer virtuellen Welt. Einbildung und Wirklichkeit kann Konrad oft nicht voneinander trennen. Stets denkt und rechnet er in Modellen. Sollte die Prognose wirklich stimmen, dann braucht er es präziser: Wie viele Tage noch? Er entwickelt eine Zeitformel. Das Resultat: 10 Tage! Dann kommt der Tod. Sein Lebensabschnitt auf dem Weltzeitstrahl soll dann enden. Konrad klammert sich an seine Theorie. Erst verzögert er den Parameter Zeit. Danach ändert er das Vorzeichen, invertiert die Zeitrichtung. Wie ein rückwärtslaufender Film. Wiedererleben, was er bereits erlebt hat. Wiedersehen, was in seinem Gedächtnis abgespeichert ist. So will er seinem Tod entgehen. Sein ehemaliger Kommilitone Beppo, den er zufällig wiedertrifft, begleitet ihn auf dieser virtuellen Flucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
1. AuflageAugust 2025
Copyright © 2025: alle Rechte beim Verlag ab editionUmschlagfoto: Ri-Ya(Pixabay | freeware)
Impressum
Edgar Bernardi
Verlag ab edition
avant ag
Via Righetti 3
CH-6982 Agno
Schweiz
www.ab-edition.ch
Satzbaum
Lektorat Tamara Haschke
www.satzbaum.de
Taschenbuchausgabe tolino media
ISBN 978-3-819-42065-8
auch erschienen als e-Book
www.ab-edition.ch/Zeitumkehr
Das Buch
Sein Arzt spricht etwas nebulös von wenigen Tagen. Genauer kann er es nicht sagen. Doch in der Diagnose ist er sich sicher, todsicher. Konrad Bleuer bezweifelt den Befund. Wahrheit gegen Hoffnung. Er ist einsam, lebt als theoretischer Physiker in einer virtuellen Welt. Einbildung und Wirklichkeit kann Konrad oft nicht voneinander trennen. Stets denkt und rechnet er in Modellen. Sollte die Prognose wirklich stimmen, dann braucht er es präziser: Wie viele Tage noch? Er entwickelt eine Zeitformel. Das Resultat: 10 Tage! Dann kommt der Tod. Sein Lebensabschnitt auf dem Weltzeitstrahl soll dann enden. Konrad klammert sich an seine Theorie. Erst verzögert er den Parameter Zeit. Danach ändert er das Vorzeichen, invertiert die Zeitrichtung. Wie ein rückwärtslaufender Film. Wiedererleben, was er bereits erlebt hat. Wiedersehen, was in seinem Gedächtnis abgespeichert ist. So will er seinem Tod entgehen. Sein ehemaliger Kommilitone Beppo, den er zufällig wiedertrifft, begleitet ihn auf dieser virtuellen Flucht.
Zeitumkehr erzählt von dem Bewusstwerden über die Zeit, die endlos erscheint. Eine kurze Lebensepoche, ein Zeitstrahl, der irgendwann beginnt – und endet. Nicht umgekehrt. Die Zeit kennt nur die eine, nicht umkehrbare Richtung. Man kann sich der Vergangenheit nur erinnern. In seiner eigenen Vorstellung. Man kann sie nicht nochmal erleben. Und die Zukunft lässt sich nicht beobachten. Vergangenheit ist Fakt, Zukunft nur wahrscheinlich.
Der Autor
Edgar Bernardi, beobachtender Physiker, versteht sich als emotionaler statt kopfgesteuerter Naturwissenschaftler. Seinem Debütroman Licht des Schattens, einer Coming-of-Age-Geschichte, folgte Der rot-blaue Boccalino über polarisierende Menschen in einem kleinen Tessiner Dorf. In Zweistromland erzählt er vom Identitätsverlust der Ostdeutschen, die sich in einem wiedervereinten Deutschland noch immer wie Bürger zweiter Klasse fühlen. Mit Was die Welt im Innersten zusammenhält möchte er Kindern die faszinierende Welt der Physik näherbringen. Nun kehrt er mit dem vorliegenden Roman Zeitumkehr, der von der Hoffnung der Umkehrbarkeit der Zeit lebt, wieder in die Belletristik zurück.
Zeitumkehr
Edgar Bernardi
Roman
Die Ewigkeit dauert lange, besonders gegen Ende.
[Woody Allen]
Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal vergangen. Wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd.
[Christa Wolf]
inhalt
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
PROLOG
Kein Wesen kann zu Nichts zerfallen!
Das Ewige regt sich fort in allen,
Am Sein erhalte dich beglückt!
Das Sein ist ewig, denn Gesetze
Bewahren die lebendigen Schätze,
Aus welchen sich das All geschmückt.
Erste Gedichtstrophe aus Vermächtnis
von Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)
I
ch läse das Buch zu gerne rückwärts. Das letzte Kapitel zuerst. Dann wüsste ich schon gleich zu Beginn, wie die Geschichte ausgeht. Ohne das erste Kapitel gelesen zu haben. Dann kennte ich zwar den Anfang nicht. Aber schon das Ende. Mit etwas Geduld käme ich ohnehin noch zum Auftakt.
Jedoch, es entginge mir der übliche Verlauf einer Erzählung: von der Eröffnung hin zum Dramatischen. Also doch komplett lesen und mit der Einleitung beginnen!
Rückwärtslesen? Was nützte das? Ich bräuchte genauso viel Zeit, das Buch von hinten nach vorne zu lesen wie von vorne nach hinten. Oder sogar länger: rhekmutieZ. Und ich könnte die Geschichte sowieso nicht mehr ändern.
Aber ich käme vom tragischen Ausgang des Dramas zum unbeschwerten Anfang. Das wäre es vielleicht doch wert.
Es hilft nichts. Am Ende des Buches ist alles geschehen. Die Zeit läuft nicht rückwärts.
Wahrheit gegen Hoffnung
E
s riecht steril. Kurz halte ich die Luft an. Meine Nase und Lunge gewöhnen sich langsam an das neue Gemisch aus Desinfektionsmittel und menschlicher Ausdünstung. Während ich hinter mir die Tür des Wartezimmers schließe, schaue ich in einen Kreis von Patienten, die mich aufblickend mustern, als beträte ein Außerirdischer den zivilisierten Raum. Das irritiert mich. Ich kann mich nicht für einen Platz entscheiden. Also steuere ich dieselbe Ecke an wie bei meinen letzten Besuchen. Eigentlich setze ich mich ungern zwischen zwei Patienten. In der gewohnten Sitzreihe ist jedoch nur noch ein Platz frei. Die Frau links der Lücke verfolgt mich mit suchendem Blick, bis ich sitze. Er lässt befürchten, dass sie mich gleich in ein Gespräch verwickeln wird. Ich vermeide es, tief einzuatmen und meine beiden Nachbarn anzuschauen. Dennoch, der Geruch meiner Rasierseife dringt in meine Nase. Für diesen Termin habe ich mich geduscht und ein frisches Flanellhemd angezogen. Buntkariert, die Einheitsgarderobe der Physiker, wie Huberta das nennt. Ich weiß ja nicht, was der Arzt mit mir vorhat. Ich fixiere den Boden vor mir und bilde mir ein, damit einer Infektion und vor allem einem Gespräch entgehen zu können.
Nervös schaue ich auf die Uhr – zum wiederholten Male – obwohl ich den Termin ja einhalte und stets pünktlich bin. Nichts hasse ich mehr, als unpünktlich zu sein. Fünf vor zehn. Um mich zu beruhigen, ziehe ich den Terminzettel, den mir die Assistentin beim letzten Mal mitgegeben hat, aus der Tasche. Mo., 2. Mai 2016. 10:00 Uhr. Alles in Ordnung. Außer, dass ich nicht weiß, warum ich herkommen sollte. Der Arzt hat mich bestellt, oder genauer gesagt, seine Sprechstundenhilfe. Einen Grund hat sie mir nicht nennen können. Ich rätsle: Routine oder Ernsthaftes?
Das Wartezimmer gleicht denen aller anderen Arztpraxen, die ich kenne. Weiße Wände, verziert mit einer Serie von Kunstdrucken. Eine Stuhlreihe ringsherum, an einer Ecke unterbrochen durch eine halbhohe Monstera. Die Standardpflanze einer jeden Arztpraxis. Etwas unterversorgt, wie man an ihren teils vertrockneten gelb-braunen Blättern erkennt. In der Mitte des Wartezimmers steht ein einfacher Holztisch, auf dem ungeordnet abgegriffene Zeitschriften liegen. Ich sträube mich, in diesen verkeimten Heften zu blättern. Reingehustet, mit Spucke die Seiten griffig gemacht oder sonst wie einen Abdruck der Krankheit hinterlassen, die man hier behandelt haben will.
Um mich abzulenken und die Distanz zu meinen Nachbarn zu erhöhen, beuge ich mich nach vorne und mustere den Stuhl, auf dem ich sitze. Nicht eine einzige markante Stelle an dem abgewetzten Polsterrand oder an den Stuhlbeinen verrät mir, dass es derselbe Stuhl ist, auf dem ich damals gesessen habe. Obwohl ich den hölzernen Lehnstuhl beim letzten Mal genauso gelangweilt inspiziert habe. Ich bin mir sicher, dass ich ihn an irgendeiner Macke wiedererkannt hätte. Bestimmt sind die Stühle seit dem letzten Termin durch das Putzen ein paar Mal durcheinandergewürfelt worden. Ansonsten ist hier alles gleich, wie vor sechs Monaten. Selbst die wartenden Patienten sehen so aus, als hätten sie alle schon beim letzten Mal mit mir hier gesessen. Zumindest die Frau rechts neben mir. Ich kann kaum unterscheiden, ob ich erneut hier bin oder noch immer warte. Manchmal bin ich unsicher, ob ich mich gerade erlebe oder nur erinnere.
Meine Nervosität steigt. Erneut schaue ich auf die Uhr. Stimmt das Datum? In dem Moment spricht meine Nachbarin mich an. Ich hatte es befürchtet. Und mime den Ausländer. Nix verstehen. Bitte nicht stören – in meinem momentanen gedanklichen Bestreben, Vergangenes von Gegenwärtigem zu unterscheiden.
Eine Fahne Menschenduft verwirbelt die klinisch reine Luft, wenn wieder mal jemand das Wartezimmer betritt. Ein seit jeher bekannter Mief, der mich stets erreicht, wenn ich Menschen nahe bin. Der Geruch nimmt allmählich ab. So, wie auch die Wahrnehmung des neu Angekommenen langsam schwindet. Diesen markanten Duft habe ich aber noch immer – oder schon wieder? – in der Nase. Mein Gedächtnis speichert ihn. Wie die Hintergrundgeräusche. Wie damals. Alles abgespeichert, sofort wieder präsent.
Nichts ist also wirklich vergangen. In manchen Augenblicken ist etwas längst Vergessenes plötzlich wieder da, noch immer vorhanden, war nie wirklich weg. Ich könnte heute im Damals sitzen und damals im Heute gesessen haben. Nur weil die Zeit vergeht, nach vorne läuft, heißt das noch lange nicht, dass Ereignisse vergehen.
Im Grunde genommen ist Konrad ein komischer Kauz. Zumindest wird er von den wenigen Menschen, die ihn kennen, so wahrgenommen. Abwesend, schusselig, vergeistigt. Oft müssen sie ihn zweimal ansprechen. Das erste Mal, damit er seine Antennen auf Empfang schaltet, und das zweite Mal, um endlich mit ihm kommunizieren zu können.
„So?“, antwortet er dann mit anhebender Stimme, wenn man ihn leicht verärgert auf die erste Ansprache hinweist. Aber wenn man beim zweiten Mal alles wiederholt, was man ihm zu Beginn schon mitgeteilt hatte, hört er aufmerksam zu und beschäftigt sich fortan konzentriert mit dem Gesagten.
Immer in Gedanken, den Kopf nie ausgeschaltet, mischen sich theoretische Abhandlungen seiner Forschungen mit Erinnerungen. Als ob er wach träumt, tauchen vor ihm Bilder auf. Sein Heimatdorf, die Holzgemeinde Ostermundigen, in der Nähe von Bern. Die Sandsteinbrüche, in denen er mit seinem besten Freund Peter rumkletterte. Der sonntägliche Familienausflug im Sommer zur Aare, in deren kalt-blauem Wasser er, eingeklemmt in einen alten Autoreifenschlauch, mit seiner Schwester badete. Ein kurzer Moment des Freiseins, ohne die ständigen Maßregelungen seines Vaters. Am Ortsrand von Ostermundigen sein Elternhaus, das er nach dem Tod seiner Eltern nicht wieder aufgesucht hat. Ein wenig bereut er es, das Nest seiner Kindheit einem unbekannten Schicksal überlassen zu haben, nachdem seine Schwester und er das Erbe ausgeschlagen haben.
Wann habe ich im Leben zum ersten Mal etwas wahrgenommen? Und was davon ist in meinem Gedächtnis hängengeblieben? Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, natürlich. Darin mein Kinderzimmer, in das ich mich so oft zurückgezogen habe, um ungestört zu sein.
„Lass’ mich in Ruhe“, habe ich unwirsch die stets gleiche Frage retourniert.
„Was machst du denn schon wieder so ganz alleine?“
Immer hat meine Mutter nach mir geschaut, mein Vater nie. Das erste Bild von meinen Eltern rufe ich auf. Später nehme ich sie als erzkonservativ wahr. Ein stinkbürgerlicher Gemeinschaftsgeist umhüllt unser Familienleben wie Nebel, durch den nicht ein einziger Sonnenstrahl dringt. Nur Freunde der Bourgeoisie gehen hier ein und aus, wobei die Freunde in Wirklichkeit nur Bekannte aus beruflichen oder politischen Beziehungen meines Vaters sind. Echte Freunde? Ich nehme kaum Herzlichkeit wahr. Mein Vater wird mit Oberst angesprochen, der Titel hat sich bei mir eingeprägt, obwohl ich bis heute nicht weiß, womit sich ein Oberst den ganzen Tag lang beschäftigt. Wahrscheinlich Befehle erteilen, daran erinnere ich mich noch, auch zu Hause. Die Ängste, verursacht durch seine autoritäre und strenge Erziehung, hallen bis heute in mir nach. Als hätten sie seinerzeit irgendein Gen bei mir mutiert. Noch immer zucke ich bei einem scharfen Ton oder allzu zackigen Auftreten meines Gegenübers zusammen, begleitet von dem völlig unbegründeten Gedanken, irgendetwas falsch gemacht zu haben.
Vor dem Hintergrund der dunkelbraunen Holztür mit den schwarzen Eisenbeschlägen steht meine Mutter. Sie weint. Ihr Schmerz über den Abschied steigt auch in mir auf. Sie tut mir so leid. Ein Patriarch von einem Mann. Mutter immer darauf bedacht, das für ihre Kinder auszugleichen.
„Pass’ gut auf dich auf! Und mach’ nichts falsch!“, sagt sie, als ich nach der Matura endlich mein Heimatdorf verlasse, um nach Zürich an die Universität zu gehen. Warum erlebe ich das gerade? Sie lebt doch nicht mehr. Vielleicht, weil es ihre letzten Worte waren. Die klingen nach wie ein Ohrwurm, der nicht aus dem Kopf geht. Das letzte Bild, das ich von ihr habe, auch das für immer in meinem Gedächtnis.
Nur wegen Albert Einstein wähle ich die Universität Zürich und Theoretische Physik. Zu gerne wäre ich hier noch in seine Vorlesung gegangen. Wenn ich den Kalender nur nochmal auf 1909 stellen könnte.
Theoretische Physik, die ganz harte Nummer. Das passt zu dir, so das motivationserstickende Urteil meines Vaters. Zu deinem auffällig großen Kopf und deiner hohen Denkerstirn. Er hat zu Lebzeiten nicht verstanden, dass ich unter beidem eher leide. Denn es verleitet andere unwillkürlich dazu, sich mir distanziert und mit respektvoller Vorsicht zu nähern. Ich spüre, wie unnahbar ich bin. Es isoliert mich.
Glücklicherweise hat Konrad diese fröhliche Melodie in seiner schweizerdeutschen Aussprache. Besonders seine nichtschweizerischen Kommilitonen mögen sie. Es macht ihn wieder etwas einnehmender und sympathisch. Konrad kommt es vor, als könne er seine gefühlte Isolation verbal ein wenig überbrücken. Dennoch, er verkennt, dass es seine selbstherrliche Art ist, die die Distanz zu seinen Mitmenschen vergrößert. Auf der anderen Seite ist da die fast schon zur Übertreibung neigende Zuvorkommenheit. Sie verleiht ihm etwas liebevoll Großväterliches, das so gar nicht zu seinem Kauzsein passt.
Ich versuche, mich im Stuhl zurückzulehnen. Es gelingt mir nicht. Die Frau neben mir verfolgt mich immer noch mit ihrem Blick, aber sie gibt Ruhe. Ich werde dennoch unsicher, schaue an mir herunter. Dann schließe ich meine Augen. Nach einer Weile erscheint hinter meinen Lidern ein Arzt mit grüner Maske und Haube, kurz bevor ich vor meiner ersten Operation – der entzündete Blinddarm – narkotisiert in die Welt der Bewusstlosigkeit gleite. Warum mir gerade das nun einfällt? Mit elf ist das gewesen und ich hatte Angst. Die Ungewissheit damals, vor dem Eingriff. Und die zeitliche Desorientierung nach dem Aufwachen. Wie beim Herausfahren aus einem langen Tunnel. Davor: zeitlos, zumindest für mich – kein Erinnern an das, was dazwischen passiert ist, kein Gefühl für die Zeit, die stehengeblieben oder wirklich vergangen ist.
Gleich werde ich aufgerufen und mein Arzt wird in seinem Sprechzimmer auf mich warten. Wozu? Was wird er diagnostizieren? Noch weiß ich es nicht. Er hat um den Termin gebeten. Wenn ich da wieder raus bin, blicke ich zurück. Dann weiß ich es. Ein erleichterndes Gefühl, wenn die Ungewissheit vorbei ist.
Zwischendurch öffne ich kurz meine Augen, nur einen Augenblick. Wie die Iris einer Kamera beim Knipsen. Dieser blitzartige Moment genügt, um das Vergangene scharf vom Künftigen zu trennen. Mich wieder mit der Gegenwart zu konfrontieren. Abrupt verschwinden meine Kopfbilder. Dafür erblicke ich einen einfachen Kunstdruck im billigen Rahmen an der Wand gegenüber. Hat er beim letzten Mal auch schon hier gehangen? Eigentlich ein auffälliger Farbtupfer in dem ansonsten weiß-sterilen Wartezimmer. Hätte mir in Erinnerung bleiben müssen. Paul Klee, Tunis-Reise. Unzählige Kopien davon hängen irgendwo in der Welt. Oder sind in Lesebücher eingebunden. Und werden auch noch künftig dort oder woanders hängen. Manches ist einfach zeitlos.
Wieder schließe ich meine Augen. Nach einem erneuten vergeblichen Versuch zu entspannen, öffnen sie sich von ganz alleine. Nun halte ich nicht mehr dagegen, sie bleiben deutlich länger auf als bisher, die Vergangenheit dehnt sich wie Gummi in die Zukunft aus. Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nur, was gewesen ist.
In dem Bild an der Wand sehe ich uns zu dritt – Helmut, Karl und mich – auf unserer Tunis-Reise. Wir haben sie nur nachgeahmt, nicht ganz so spektakulär wie die von Paul Klee. Ein wenig anmaßend und der Zeit hinterherhinkend hatten auch wir das Ziel, die Faszination der Farben, Formen und des Lichts nachzuvollziehen, welche die Künstler zu ihrer Zeit so inspiriert hat. Bemerkenswert, der kurze Blick reicht, um manche Assoziationen nach so langer Zeit plötzlich wieder so klar in mir zu wecken. Und das, obwohl die Kunst doch eher verklärt. Oder ist es mehr der tragische Ausgang der Reise, der mir sofort wieder ins Gedächtnis sticht, nachdem wir seinerzeit nur zu zweit zurückkehrten?
„Dr. Bleuer“, quäkt Konrads Name über den kleinen Lautsprecher im Wartezimmer.
Als er aufspringt, greift seine Nachbarin ihn am Arm. „Ich bin vor Ihnen dran gewesen“, ruft sie.
„Triage“, antwortet die herbeigerufene Sprechstundenhilfe, um sich Respekt zu verschaffen und beendet durch ihren Auftritt das entstandene Handgemenge. „Wir entscheiden hier nach medizinsicher Dringlichkeit“, erklärt sie der aufgeregten Frau gegen ihren Gesichtsausdruck des Unverständnisses.
Konrad gestikuliert entschuldigend für seine bevorzugte Behandlung. Die Verständnislosigkeit im Gesicht seiner Nachbarin wird überlagert von einem grimmigen Blick.
Heute ist es ein anderes Sprechzimmer. 3 steht außen in schwarzer Schrift auf der Tür. Links oberhalb der Türklinke. Damals war es die 1. Jetzt also schon zwei Türen weiter. Zeitläufte? Oder meinem Krankheitsfortschritt geschuldet?
Wie geht es Ihnen heute, Herr Bleuer?
Dr. Thöben zieht mich sichtlich gehetzt während des Händeschüttelns ins Sprechzimmer. Schnell lässt er meine Hand wieder los und schließt die Tür. Diesmal kommt er mir noch dürrer vor als bei meinem letzten Besuch. Ein hochgewachsener Mann, dem der weiße Kittel wie zum Trocknen auf der Leine etwas zu weit um die Schultern hängt. Darüber, im auffälligen Kontrast, seine tiefschwarzen, etwas ungepflegten, leicht fettigen Haarsträhnen.
Er umkreist im Halbbogen mit drei eiligen Schritten seinen Schreibtisch. Während er dahinter Platz nimmt, deutet er mit einem Wink auf den leeren Stuhl vor sich. Meine Antwort geht in der Hektik unter. Noch habe ich mich nicht gesetzt, da hat der Arzt schon meine Patientenmappe aufgeklappt. Ich spinkse kurz auf die Kopfzeilen der Mappen dahinter und lese ein paar Namen. Seine Sprechstundenhilfe hat sie ihm sicher in der Reihenfolge der angemeldeten Patienten laut Terminkalender bereitgelegt. Inzwischen ist meine Akte, die obenauf liegt, zu ungefähr drei Zentimetern angeschwollen. Ich liebe eine solche Ordnung. Diese Systematik. Eine Mappe hinter die nächste geschoben. Genau in der Zeitfolge der Patiententermine. Rechts und links bündig. So würde ich es auch machen. Und wenn ein Ordner mal verrutscht: Jedes Mal wieder mit beiden Handballen rechts und links in eine Linie schieben.