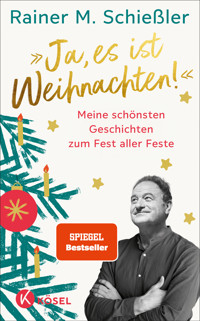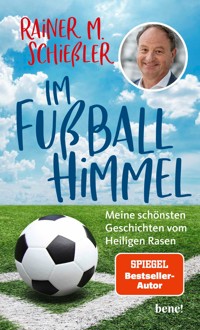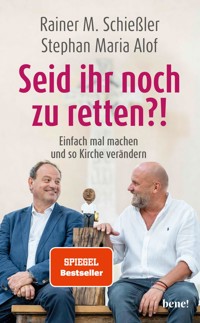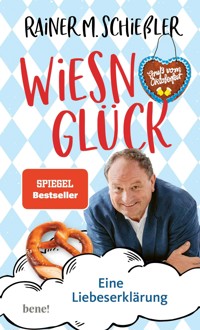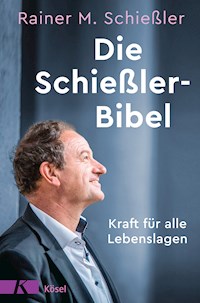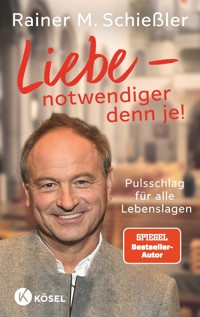
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Rainer M. Schießler
- Sprache: Deutsch
...doch am größten unter ihnen ist die Liebe!
»Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei«, heißt es bei Paulus, »doch am größten unter ihnen ist die Liebe«. Und sie ist wohl notwendiger denn je, immerhin sehen wir aktuell alles andere als liebevolles Miteinander in der Welt. In seinem dritten und finalen Teil, in dem er die Bibel auf ihre Lebenstauglichkeit befragt, schaut Rainer Maria Schießler auf diese Urkraft, die im Menschen so facettenreich wirkt. Warum ist die Liebe größer als Hoffnung oder Glaube? Was tun wir alles aus Liebe? Wie funktioniert die Liebe? Kennt sie Wenn-Dann-Sätze? Wie soll das gehen mit der Feindesliebe, wo uns doch manchmal schon der oder die Liebste den letzten Nerv raubt?
Rainer Schießler, dessen unkonventionelle Art, Glaube zu leben inzwischen deutschlandweit bekannt ist, begibt sich in diesem Buch erneut auf biblische Erkundungstour, was wir vom Buch aller Bücher für unser modernes Leben lernen können. Ein Streifzug durch das schillerndste Gefühl des Menschseins, eine Spurensuche nach dem Pulsschlag für alle Lebenslagen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
»… doch am größten unter ihnen ist die Liebe!«
»Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei«, heißt es bei Paulus, »doch am größten unter ihnen ist die Liebe«. Und sie ist wohl notwendiger denn je, immerhin sehen wir aktuell alles andere als liebevolles Miteinander in der Welt. In seinem dritten und finalen Teil, in dem er die Bibel auf ihre Lebenstauglichkeit befragt, schaut Rainer Maria Schießler auf diese Urkraft, die im Menschen so facettenreich wirkt. Warum ist die Liebe größer als Hoffnung oder Glaube? Was tun wir alles aus Liebe? Wie funktioniert die Liebe? Kennt sie Wenn-dann-Sätze? Wie soll das gehen mit der Feindesliebe, wo uns doch manchmal schon der oder die Liebste den letzten Nerv raubt?
Rainer Schießler, dessen unkonventionelle Art, Glaube zu leben, inzwischen deutschlandweit bekannt ist, begibt sich in diesem Buch erneut auf biblische Erkundungstour, was wir vom Buch aller Bücher für unser modernes Leben lernen können. Ein Streifzug durch das schillerndste Gefühl des Menschseins, eine Spurensuche nach dem Pulsschlag für alle Lebenslagen.
Rainer Maria Schießler
Liebe –notwendiger denn je!
Pulsschlag für alle Lebenslagen
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit konnte eine gendergerechte Schreibweise nicht durchgängig eingehalten werden. Bei der Verwendung entsprechender geschlechtsspezifischer Begriffe sind im Sinne der Gleichbehandlung jedoch ausdrücklich alle Geschlechter angesprochen.
Copyright © 2025 Kösel-Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR.)
Umschlag: zero-media.net, München
Umschlagmotiv: © Goran Nitschke unter freundlicher Genehmigung von Christian Reinisch, carpe artem GmbH
Redaktion: Marlene Fritsch
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-32795-8V002
www.koesel.de
הַכֹּל
hakol
Hebräisch: ALLES
Inhalt
Vorwort
Gemeinsame Zeit
Bibelkreis oder Brot?
Verloren – gefunden
Zeit für Zweifelnde und Suchende
Glaube – ein haltbarer Faden
»Du bist, was du isst«
Der schlafende Jesus
Zwei sind viele
Erfüllte Zeit
Kommt und seht
Offen sein
Bleiben oder gehen?
Geschuldete Liebe?
Nichts als Streit?!
Freut euch!
Uns gleich bis in den Tod
Intimität
Wähle das Leben!
Eingeladen
Freiheit gibt es nicht umsonst
Was kommt danach?
Öffne dich!
Sei ein Mensch!
Einfachheit
Jeden Tag: Auferstehung
Zwei Seiten einer Medaille
Wenn die Saat wächst
Gott will es
Brot, das nach Liebe duftet
Liebe! Das genügt
Wer ist Familie?
Handfester Glaube
Ein Paket von Gott
Gott – ganz unten
Scheitern lernen
Hilfsbereitschaft
Mitleiden statt Vertrösten
Wachsam bleiben
Wahre Gerechte
Was einen guten Hirten ausmacht
Glaube braucht Unvernunft
Aufgeweckt bleiben
Heilige Zeichen
Von Weinbergarbeit und außergewöhnlichen Rebsorten
Was man zum Leben braucht
Ich bin die Tür
Vertrauen – über den Tod hinaus
Gott im anderen entdecken
Alles ist schon gerichtet
Worte der Anerkennung
Eine Kirche für alle
Der Maßstab Gottes
Wahrheit kann man nicht pachten
Gottesfurcht
Vom Annehmen und Loslassen
Das Heilige in den Dingen
Abgestempelt
Das Geheimnis des Weizenkorns
Heilsames Aufschauen
Über den Berg sein
Befreit!
Vertrauensvorschuss
Dem Willen Jesu folgen
Spatzen predigen lassen
Aufschlussreich
Ein Rezept für kranke Herzen
Entfeinden
Leben als Heilige
Leise lieben
Das original Christliche
Berg-Erfahrungen
Geschenke
Mut zum Dienen
Das Loslassen üben
Bitte und Danke
Nichts als leere Hände
Gott hinter den Dingen
Von der Gott-losigkeit der Welt
Vom Beten
Der wahre Schatz der Kirche
Umsonst, aber nicht vergeblich
Drangeben
Heilsames Unkraut
Hoffnung sucht Glück
Kann man Vergebung zählen?
Gott kann man sich nicht verdienen
Dankbar annehmen
Salzig sein
Mut zum Aufbruch
Epilog und Dank
Bibelstellen
Vorwort
Genau betrachtet war der Apostel Paulus ein Getriebener, ständig unterwegs und auf Reisen, von einer Gemeinde zur anderen. Nie beschreibt er Menschen, Landschaften oder Situationen näher. Paulus hat keine Zeit dafür! Die Sorge um seine Gemeinden hält ihn ständig auf Trab. In Korinth muss er Konflikte innerhalb der Gemeinde lösen, woanders theologische Fragen, wie die nach dem Schicksal der Verstorbenen oder dem baldigen Kommen Christi, beantworten, und dann betreibt er noch intensiv »Mitgliederbetreuung«, empfiehlt seine Mitarbeiter den Gemeinden und motiviert zu größtmöglichem Einsatz.
Plötzlich aber schert Paulus aus. Wie ein in Gedanken versunkenes Kind, das, fröhlich ein Lied singend, entlangschlendert, schenkt er seiner Gemeinde in Korinth ein Bekenntnis, das sich auf ewig in die Herzen der Menschen einbrennt: »Die Liebe trägt alles, sie hofft alles, sie glaubt alles!« Das Hohelied der Liebe im 13. Kapitel des Korintherbriefes ist ein einziges Geschenk an uns. In unzähligen Trauungsgottesdiensten lassen sich bis heute die Brautpaare vor ihrem Eheversprechen und der öffentlichen Bekundung dieses ungeheuren Wagnisses der Liebe dieses einzigartige Liebeslied vortragen. Sie wollen ganz bewusst an diesen Versen Maß nehmen, wollen sich gegenseitig eine Liebe versprechen und schenken, die ausnahmslos gibt und voller Demut empfängt, die wirklich alles trägt und sich in jeder Lebenslage tragen lässt. Mit ihrem gemeinsamen Leben wollen sie Gott selbst in dieser Welt sichtbar werden lassen.
»Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; doch am größten unter ihnen ist die Liebe« (1 Kor 13,13). So endet sein fast schon verträumtes und mit jedem einzelnen Bild anmutendes Lied. Keiner kann sich seiner Wirkung entziehen. In einem Trauungsgottesdienst habe ich einmal das Brautpaar – während ich den Paulustext darlegte – mit drei Bändern in den Farben Blau, Grün und Rot – also den Farben für den Glauben, die Hoffnung und die Liebe – einen Zopf flechten lassen. Dann haben wir gemeinsam der Hochzeitsgemeinde dieses untrennbare Band präsentiert, das jeder Zugkraft standhalten wird: So wie dieser unzerstörbare »Zopf« der Liebe, so steht das neue Ehepaar nun vor der Gemeinde, bereit, sich zu verschenken.
Für den Apostel Paulus sind Glaube und Hoffnung innerweltliche Eigenschaften, die vergänglich sind. Wenn all das eintritt, woran wir glauben und worauf wir hoffen, muss nicht mehr geglaubt und gehofft werden. Die Liebe aber ist, so der Apostel, die stärkste unter diesen drei Kennzeichen und unverkennbares Merkmal des gläubigen Christen. Sie ist wie eine Brücke: Sie überwindet alles. Vor allem bleibt sie für immer bestehen, sogar über den Tod hinaus. Daher ist sie die größte. Jesus Christus hat diese unverbrüchliche und vollkommene Liebe bis zuletzt gelebt. Er ist für Paulus die Liebe Gottes in Person, die wir nachahmen dürfen, nicht als bloßes Idol oder Vorbild, sondern als Kraftquelle, die sich unentwegt an uns verschenkt und uns ohne jegliche Vorbedingungen liebt. Dadurch wird jede menschliche Liebe zugleich zum Hinweis auf diese eine alles tragende und begründende, unvorstellbare, göttliche Liebe. Es ist die Erfahrung dieser göttlichen Liebe, die den Menschen überhaupt erst befähigt, selbst ein Leben lang in Liebe füreinander da zu sein: Der Mensch liebt nicht, um von Gott geliebt zu werden; er liebt, weil er von Gott zuvor geliebt wird.
Nach Glauben und Hoffnung ist die Liebe der krönende Abschluss, die eigentliche Vollendung. Ohne diese Liebe wäre alles nichts. »Die Liebe ist die stärkste Kraft, sie lässt sich nicht zwingen, aber sie zwingt alles«, drückt es auch die große Mystikerin Hildegard von Bingen aus. Aber was ist jetzt eigentlich Liebe? Ist sie nur ein Gefühl? Eine Entscheidung? Eine Tugend? Die Bibel ist da ziemlich eindeutig: »Gott ist Liebe« (1. Joh 4,16b). Punkt. Weil das stimmt, dürfen wir uns anschauen, wie Gott eigentlich liebt.
Obwohl sich jeder Mensch nach Liebe sehnt, fühlt er sich immer wieder auch nicht geliebt, auch wenn sich sein Gegenüber doch alle Mühe gibt. Warum reden wir aneinander vorbei, selbst wenn wir uns lieben? Diesem Phänomen hat sich der amerikanische Pastor und Paarberater Gary Chapman gewidmet. In seiner jahrelangen Arbeit mit Paaren fiel ihm dabei auf: Missverständnisse in der Liebe entstehen oft nicht aus mangelnder Zuneigung, sondern weil wir unterschiedliche »Sprachen der Liebe« sprechen. So wie Menschen verschiedene Muttersprachen haben, so haben sie auch unterschiedliche Wege, Liebe zu geben und zu empfangen. Die fünf Sprachen der Liebe nach Chapman sind die folgenden:
1. Gemeinsam Zeit verbringen
Die intensivste Währung der Liebe ist Zeit. Nicht nebenbei, nicht zwischen Tür und Angel, sondern bewusst und mit voller Aufmerksamkeit. Ein Gespräch, ein gemeinsamer Spaziergang – für Menschen, die diese Sprache sprechen, zählt nichts mehr als echte, ungeteilte Zeit miteinander.
2. Körperliche Zuwendung
Eine Umarmung, eine sanfte Berührung, eine Hand auf der Schulter – Nähe ist für manche der direkteste Ausdruck von Liebe. Sie fühlen sich dann am meisten geliebt, wenn sie im wahrsten Sinne spüren, gehalten zu werden.
3. Hilfsbereitschaft
Liebe zeigt sich in Taten. Den Müll rausbringen, das Auto volltanken, die Wäsche falten – für manche ist das nichts als eine Pflicht. Doch für andere ist es ein Ausdruck tiefer Verbundenheit: »Ich sehe dich, ich helfe dir.«
4. Lob und Anerkennung
Worte haben Macht. Manche Menschen brauchen keine großen Gesten, sondern nur ein ehrliches »Deine gute Laune ist ansteckend«. Oder: »Ich bewundere, wie geduldig du mit anderen bist.« Wenn diese Sprache ihre Hauptsprache ist, fühlen sie sich geliebt, weil sie darin Bestätigung und aufrichtige Wertschätzung hören.
5. Geschenke, die von Herzen kommen
Es geht nicht um den materiellen Wert, sondern um die Geste. Eine unerwartete kleine Aufmerksamkeit, ein Brief, eine Blume – das zeigt: »Ich habe an dich gedacht.« Für manche Menschen sind solche Zeichen der Liebe der stärkste Ausdruck von Zuneigung.
Jeder Mensch hat eine oder zwei Sprachen, die er besonders gut spricht und/oder versteht – und andere, die ihm fremd sind. Das Problem: Wenn zwei Menschen in einer Paar- oder Freundschaftsbeziehung oder gar innerhalb der Familie unterschiedliche Liebessprachen sprechen, kann es passieren, dass sich einer nicht gesehen oder geliebt fühlt – obwohl der andere genau das versucht: Ein Mann bringt seiner Frau Blumen, doch sie sehnt sich nach gemeinsamen Gesprächen. Eine Mutter sagt ihrem Kind jeden Tag, wie stolz sie ist, doch das Kind wünscht sich einfach, dass sie mit ihm spielt.
Die Bibel ist ein einziges Zeugnis dafür, dass Gott alle diese Sprachen beherrscht. Wir finden in der Bibel jede dieser fünf Sprachen der Liebe – nicht nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen Gott und uns. Manche Menschen erleben Gottes Liebe vor allem in der Schönheit der Schöpfung, andere in der Stille des Gebets, wieder andere in der Begegnung mit anderen Menschen. Für die einen ist die Geschichte des barmherzigen Samariters der Inbegriff göttlicher Liebe, für die anderen das Gleichnis vom verlorenen Sohn, für wieder andere der Moment, in dem Jesus heilt, tröstet, berührt.
Nach der Schießler-Bibel, die die biblischen Sonntagstexte, die jeden Sonntag in unseren Kirchen vorgetragen und verkündigt werden, unter besonderer Berücksichtigung des Glaubens und der Hingabe des Menschen betrachtet hat, und Hoffnung – gerade jetzt!, in dem ich ganz speziell die Zeugnisse der Heiligen Schrift unter dem Aspekt der Hoffnung betrachtet habe, will ich mit diesem dritten Band über die Liebe nun den Abschluss und Höhepunkt zugleich beschreiben. Wie in den beiden vorherigen Büchern sind die Bibeltexte einzeln aufgeführt und diesmal nach der Einteilung der fünf Liebessprachen nach Chapman in fünf Kapitel eingeordnet. In gewohnter Manier liefere ich zu den Bibelstellen persönliche Interpretationen. Der allen biblischen Texten zugrunde liegende Tenor ist die tiefe und reiche Erkenntnis, wie sehr uns Gott liebt und wie wir deshalb fähig sind, einander lieben zu können.
Die Liebe ist eben doch nicht nur ein Gefühl. Sie ist die Sprache Gottes und jeder liebende Mensch ist ein Liebesbrief Gottes an diese Welt. Sie ist die Sprache, die wir in dieser Welt so dringend brauchen. Sie allein hilft uns, einzutauchen in die geheimnisvolle Gemeinschaft mit einem liebenden Gott, zu staunen über die gewaltige Kraft liebenden Tuns und vielleicht selbst ein bisschen mehr von dieser Liebe in die Welt zu bringen.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern viel Freude beim Lesen, Erkennen und Geliebtfühlen!
Pfarrer Rainer Maria Schießler
Gemeinsame Zeit
Die Zeit ist wohl das wertvollste Gut der Liebe, weil man sie nie mehr zurückholen kann.
Bibelkreis oder Brot?
Als sie weiterzogen, kam er in ein Dorf. Eine Frau namens Marta nahm ihn gastlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Marta aber war ganz davon in Anspruch genommen zu dienen. Sie kam zu ihm und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen! Der Herr antwortete: Marta, Marta, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat den guten Teil gewählt, der wird ihr nicht genommen werden.
(Lk 10,38–42)
Manche erschrecken, wie Jesus mit Marta umgeht. Er ist Gast in ihrem Haus und sie hat alle Hände voll zu tun, das uralte Gesetz der Gastfreundschaft zu erfüllen. Den Wortwechsel zwischen Jesus und Marta zu Bethanien sofort auf eine höhere Ebene zu schieben, das Spirituelle uneingeschränkt für wichtiger zu erklären als das Irdische, kann aber dem Anliegen des Evangeliums nicht gerecht werden. Maria hat sich für das Spirituelle entschieden und sie will uns sagen: Das Wort von Gott aus dem Mund Jesu ist entscheidend, der Hunger kann warten. Meine Zeit schenke ich Jesus.
Dennoch, die Erfahrung belegt es: Erst kommt der Reis oder der Mais und dann das Evangelium. Nicht nur Missionare weltweit bezeugen dies – auch Jesus selbst hat so gehandelt angesichts der hungernden Menschen, die zu seiner Predigt zusammengekommen waren: Zuerst gab es Brote und Fische, dann die Predigt.
Maria, deren Name übersetzt »Seherin« heißt, steht hier für den Evangelisten für das Spirituelle in der Gemeinde und dafür wendet sie ihre Zeit auf. Als zuhörende Frau nimmt sie die Stellung einer Rabbinerschülerin ein, die es so gar nicht gab. Eine klare Positionierung des Evangelisten der Frauen überhaupt gegenüber.
Marta bezeichnet die »Herrin, Gebieterin«. Sie ist die Aktive und steht für das Praktische, ihre Zeit verantwortet sie dem Zupacken in der Gemeinde.
Der Evangelist will aber eben keine plumpe Gegenüberstellung vornehmen und wendet sich so gegen ein tendenziöses, selbst gemaltes Jesusbild, um einer Religiosität den Rücken zu stärken, die am Ende einfach passen muss. Menschen können nun mal kein absolut sicheres Sprachrohr Gottes sein, auch wenn das die Kirche lange genug von sich behauptete.
Das Wort von Gott ist nicht einfach wichtiger als das Brot und die Predigt am Sonntag in der Kirche ist nicht einfach wichtiger als die Sorge um den täglichen Lebensunterhalt. Jesus sagt an anderer Stelle von sich: »Ich bin das Brot des Lebens«, und zum Beweis dafür nimmt er richtiges Brot in die Hand, um es mit den Hungrigen zu teilen. Auf die Fastenanfrage der Pharisäer antwortet er: »Können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist?« (Mk 2,19). Weil wir darauf vertrauen, dass er mitten unter uns ist, brauchen wir nicht zu fasten.
Marta zeigte später anlässlich des Todes ihres Bruders Lazarus durchaus auch ihre spirituelle Seite bis hin zu dem klaren Bekenntnis: »Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll.« (Joh 11,27)
Wann und wie wir Jesus unsere Zeit schenken, kann unterschiedlich aussehen, die eine hört zu, die andere bereitet die Gaben. Jesus liebt beide gleichermaßen.
Verloren – gefunden
Weiter sagte Jesus: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater: Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht! Da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er begann Not zu leiden. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf; der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen; aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein; mach mich zu einem deiner Tagelöhner! Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zu ihm: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt; ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten: Holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße! Bringt das Mastkalb her und schlachtet es; wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder; er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein Fest zu feiern.
(Lk 15,11–24)
Jesus beschwört nicht die Idylle, er hat es nicht so sehr mit den Gerechten, besser gesagt mit Menschen, die sich selbstgerecht gebärden. Er lenkt seinen Blick auf die Sünder, dorthin, wo sie zu finden sind, beugt sich zu ihnen herab, nimmt sie auf die Schulter und trägt sie heim. Er steht nicht, wie die Religionsstifter vor und nach ihm, auf der Seite der Untadeligen, sondern hatte ein echtes Faible für die, die Fehler machen. So wahr diese Feststellung ist, so ungern wird sie von denen gehört, die den Platz der Gerechtigkeit für sich besetzt halten.
Nach wie vor ist es häufig üblich, Mitchristen in die zwei Kategorien »würdig – unwürdig« einzuteilen. Als gäbe es dieses eindringliche Gleichnis nicht! Und es bleibt nicht das einzige: An den »verlorenen Sohn« schließen sich noch die Geschichten vom »verlorenen Schaf« und von der »verlorenen Drachme« an. Dreifach wollte Jesus betonen, dass vor Gott andere Gesichtspunkte gelten. Doch damals wie heute lädt er offensichtlich vergeblich dazu ein, die eigene verhärtete Position aufzugeben und auf den Standpunkt der Barmherzigkeit Gottes zu wechseln. »Geschieht ihm ganz recht«, hätte der Vater auch denken können. Aber nicht in der Logik Jesu. Der Sohn ist heimgekehrt, der Vater hat das Wertvollste wiedergewonnen: gemeinsame Zeit. Und wie? Durch Barmherzigkeit.
Aber mit der Barmherzigkeit ist es eben so eine Sache. »Alles, was recht ist«, heißt es bei uns. Barmherzigkeit erinnert dann doch zu sehr an Schwäche, Hilflosigkeit und Bedürftigkeit. Wer möchte sich da gern einordnen lassen? Da sind einem Positionen, in denen man nicht auf andere angewiesen ist und die man selbst in der Hand haben will, viel lieber.
Solche Positionen der Stärke sind kopfgesteuert. Wenn aber bei einem Menschen der Schwerpunkt im Kopf sitzt, kann er leichter zu Fall gebracht werden, als wenn der Schwerpunkt tiefer sitzt. Die Barmherzigkeit ist eine Sache des Herzens. Für den Hebräer hat sie ihr Zuhause – nach dem ursprünglichen Wortsinn des Erbarmens und wie Jesus den Begriff verwendet – sogar noch tiefer, nämlich im Mutterschoß. Dort, wo wir geborgen sind und einem nichts etwas anhaben kann.
Jesus nennt Gott seinen Vater. Aber mütterlicher und zärtlicher lässt er sich nicht beschreiben als mit Mutterschoß, Barmherzigkeit. Mütter denken und handeln mit dem Herzen. Von außen betrachtet ist das oft genug unvernünftig. Und Gott geht darüber sogar noch hinaus. Nach Jesaja verspricht Gott: »Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde: ich vergesse dich nicht« (49,15).
Wie wollte dann Jesus anderes lehren, anders handeln als der Vater? Auch wenn es menschlich gesehen noch so unvernünftig wäre? Es ist nicht leicht, diese Augenhöhe Jesu zu erreichen, vor allem wenn wir auf diesem Weg der Barmherzigkeit durch Enttäuschungen hindurchgehen müssen.
Manchmal müssen wir ganz schön tief herunter, denn ganz unten spielen sich die Schicksale der Menschen ab. Nur dass dort eben die tiefste Liebe verborgen liegt.
Zeit für Zweifelnde und Suchende
Dann kam er nach Jericho und ging durch die Stadt. Und siehe, da war ein Mann namens Zachäus; er war der oberste Zollpächter und war reich. Er suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei, doch er konnte es nicht wegen der Menschenmenge; denn er war klein von Gestalt. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell herunter! Denn ich muss heute in deinem Haus bleiben. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Und alle, die das sahen, empörten sich und sagten: Er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte: Siehe, Herr, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen, und wenn ich von jemandem zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.
(Lk 19,1–10)
Typisch Jesus von Nazaret: Obwohl er von vielen Menschen umringt ist, darunter viele Priester und Leviten, die in Jericho wohnten, wenn sie keinen Tempeldienst in Jerusalem hatten, also durchaus interessante und interessierte Typen, sucht er sich wieder einen Mann am Rande aus, um ihm seine Zeit zu schenken. Genauer gesagt, er holt ihn sich vom Baum. Als Zollpächter war Zachäus zutiefst verhasst, weil er im Dienst der römischen Besatzungsmacht stand und davon auch persönlich sehr profitierte.
In diesem »Evangelium im Kleinen« (Tomáš Halík) geht es Jesus um die Verlorenen. Die Liste jener, die er ganz selbstverständlich an- und in seine Arme nimmt, mit denen er sich zusammensetzt, mit denen er diskutiert und zusammen speist, ist lang. Es sind nicht die Leviten, die Priester und der Hohepriester, nicht die Pfarrer, Bischöfe und der Papst. Auf seiner Liste stehen andere: Hirten, Behinderte, Kranke, Aussätzige, Prostituierte und eben Zollpächter. Allesamt Außenseiter der Gesellschaft, die Jesus ganz bewusst in die Mitte nimmt. Heute wären das vielleicht die Flüchtlinge vor Lampedusa, die im Sprinter Eingeschleppten aus Osteuropa, die an Aids erkrankten Kinder und Jugendlichen in den Waisenhäusern Afrikas, Menschen ohne jede Zukunftsperspektive und alle, die einer menschenfeindlichen Bürokratie zum Opfer fallen.
Mit einer fragwürdigen Romantik hat das aber bei Jesus nichts zu tun. Es zeigt zunächst, dass die Welt, in die er von Gott gesandt wurde, krank ist. Es ist eine Welt ohne Herz. Diese Welt will er heilen und deswegen lenkt er unseren Blick auf das Reich Gottes, das auch unter und durch uns entstehen soll: eine Welt nach dem Herzen Gottes. So geht er konsequent auf Konfrontation zu den Menschen ohne Herz, zu Menschen, die ein Herz aus Stein haben. Er geht gegen die vor, die auf ihren selbst gemachten Heiligen Stühlen der Macht sitzen und sich durch ihre Gebote und Bestimmungen ihren persönlichen Freiraum schaffen, damit sie das gemeine Volk ja nicht beschmutzen kann.
Zu einem Leben nach dem Evangelium Jesu muss darum heute das besondere Interesse an den Menschen gehören, die am Rand stehen, an den Zweifelnden und Suchenden. Es muss ein gemeinsames Suchen sein gegen all die falschen Sicherheiten – Stichwort »allein seligmachende Kirche«.
Vermutlich haben gerade Suche und Zweifel den Zachäus auf den Baum getrieben, ihn buchstäblich groß und unübersehbar gemacht. Damit hat er sich vor allen Leuten geöffnet, geoutet, sagt man heute, auch wenn er das vermutlich so nicht bedacht hatte. Beides, Zweifeln und Suchen, führt zu jener Offenheit, die die Voraussetzung für das Reich Gottes ist. Schon allein deswegen muss das Evangelium Jesu immer aus der Sicht der zweifelnden und suchenden Menschen gelesen und gedeutet werden.
Oder etwas philosophischer mit Thomas Merton: »Was von uns heute verlangt wird, ist nicht so sehr über Christus zu reden, sondern eher, ihn in unser Leben zu lassen, damit die Menschen ihn finden können, weil sie ihn in uns lebend entdecken.«
Glaube – ein haltbarer Faden
Als einige darüber sprachen, dass der Tempel mit schön bearbeiteten Steinen und Weihegeschenken geschmückt sei, sagte Jesus: Es werden Tage kommen, an denen von allem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem andern bleibt, der nicht niedergerissen wird.
Sie fragten ihn: Meister, wann wird das geschehen und was ist das Zeichen, dass dies geschehen soll? Er antwortete: Gebt Acht, dass man euch nicht irreführt! Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen: Ich bin es! und: Die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach! Wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört, lasst euch nicht erschrecken! Denn das muss als Erstes geschehen; aber das Ende kommt noch nicht sofort.
Dann sagte er zu ihnen: Volk wird sich gegen Volk und Reich gegen Reich erheben. Es wird gewaltige Erdbeben und an vielen Orten Seuchen und Hungersnöte geben; schreckliche Dinge werden geschehen und am Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen.
Aber bevor das alles geschieht, wird man Hand an euch legen und euch verfolgen. Man wird euch den Synagogen und den Gefängnissen ausliefern, vor Könige und Statthalter bringen um meines Namens willen. Dann werdet ihr Zeugnis ablegen können. Nehmt euch also zu Herzen, nicht schon im Voraus für eure Verteidigung zu sorgen; denn ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben, sodass alle eure Gegner nicht dagegen ankommen und nichts dagegen sagen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure Verwandten und Freunde werden euch ausliefern und manche von euch wird man töten. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Und doch wird euch kein Haar gekrümmt werden. Wenn ihr standhaft bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen.
(Lk 21,5–19)
Dass eine Zeit kommt, da alles niedergerissen wird und kein Stein auf dem andern bleibt, schreibt der Evangelist Lukas 70 nach Christus, als der Tempel zu Jerusalem im jüdisch-römischen Krieg bereits zerstört war. Die Erinnerung an diesen prachtvollen Tempelbau aber war da und auch das Erlebnis mit Jesus, der sich davon nicht beeindrucken ließ: Ein gewaltiges Gebäude ist die eine Sache, ein lebendiger, tatkräftiger Glaube eine andere. Gott wohnt nicht einfach so in Kirchen und Kathedralen.
Dass die Anhänger Jesu verfolgt und hingerichtet werden, hat nie ganz aufgehört – bis heute. Die Geschichte hält in allen Jahrhunderten solche Schrecken bereit. Es gibt keinen Grund, sich in Sicherheit zu wiegen. Der Glaube hängt immer an einem seidenen Faden. An Menschen liegt es, ihn zu verstärken und haltbar zu machen, sodass er in Stürmen und Anfeindungen bestehen kann.
Wer auf Steine, auf Pracht und Herrlichkeit setzt, hat schon verloren, sagt Jesus. Die üblichen Sicherheiten, auf die man sich im Leben verlassen will, erweisen sich bereits in ihrer Begrifflichkeit als höchst unsicher: Eine Krankenversicherung erhält nicht gesund, die Unfallversicherung verhindert keinen Crash, die Brandversicherung bewahrt nicht vor Brandstiftung und die Lebensversicherung schützt nicht vor Sterben und Tod.
Weil der Glaube an einem seidenen Faden hängt, braucht er oben und unten einen festen Halt wie bei einem fein gewobenen Spinnennetz: eine Kraft von oben und eine Basis, auf der er gründen kann. Deswegen ist für den Evangelisten die stützende Gemeinde so wichtig. Der Glaube braucht im doppelten Sinn des Wortes Unter–Haltung, also einerseits einen festen Grund, einen Unterhalt. Und andererseits Unterhaltung im Sinne eines freudigen Miteinanders, ein bisschen Entertainment.
Dazu gehören all jene stummen, selbstverständlichen Gewissheiten einer Gemeinschaft, über die man nicht lang und breit diskutieren muss. In immer größer werdenden Gemeinden und Seelsorgeeinheiten, in denen Seelsorger und Gläubige zu ständigen Pendlern werden, ist das eine ganz besondere Herausforderung. Ein Pendler ist nun mal nirgends zu Hause und Glaubenswahrheiten lassen sich nicht im Vorübergehen einkaufen.
Der Glaube braucht eine starke, fest verankerte Gemeinschaft. Das sind dann Menschen, die tragen und mittragen, die wie gute Eltern für ihre Kinder da sind und ihnen sagen: »Es ist gut so.« Dann rückt auch das so wichtige Vertrauen an die Seite des Glaubens. Immerhin haben wir das meiste, was wir »wissen«, von Menschen übernommen, die für uns glaubwürdig waren und sind.
Das gilt noch mehr für den Glauben. Sonst bleibt von dem bloß im Religionsunterricht Angelernten nichts. Es wird schon beim ersten Sturm kein Stein auf dem anderen bleiben.
»Du bist, was du isst«
Die ganze Gemeinde der Israeliten murrte in der Wüste gegen Mose und Aaron. Die Israeliten sagten zu ihnen: Wären wir doch im Land Ägypten durch die Hand des HERRN gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot genug zu essen hatten. Ihr habt uns nur deshalb in diese Wüste geführt, um alle, die hier versammelt sind, an Hunger sterben zu lassen. Da sprach der HERR zu Mose: Ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausgehen, um seinen täglichen Bedarf zu sammeln. Ich will es prüfen, ob es nach meiner Weisung lebt oder nicht. Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Sag ihnen: In der Abenddämmerung werdet ihr Fleisch zu essen haben, am Morgen werdet ihr satt werden von Brot und ihr werdet erkennen, dass ich der HERR, euer Gott, bin. Am Abend kamen die Wachteln und bedeckten das Lager. Am Morgen lag eine Schicht von Tau rings um das Lager. Als sich die Tauschicht gehoben hatte, lag auf dem Wüstenboden etwas Feines, Knuspriges, fein wie Reif, auf der Erde. Als das die Israeliten sahen, sagten sie zueinander: Was ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Da sagte Mose zu ihnen: Das ist das Brot, das der HERR euch zu essen gibt.
(Ex 16,2–4.12–15)
Als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger dort waren, stiegen sie in die Boote, fuhren nach Kafarnaum und suchten Jesus. Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierhergekommen? Jesus antwortete ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird! Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn: Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Sie sagten zu ihm: Welches Zeichen tust du denn, damit wir es sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer dieses Brot! Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.
(Joh 6,24–35)
Essen und Trinken halten Leib und Seele zusammen. Wer keinen Appetit hat, wem Essen und Trinken nicht schmecken, fühlt sich krank, missmutig und depressiv. Wer herzhaft essen und trinken kann, am besten in Gemeinschaft, der strahlt dagegen pure Lebensfreude aus. Im Evangelium geht es aber nicht nur um etwas Alltägliches, sondern um eine Speise, die für das ewige Leben bleibt, und um ein Brot, das der Welt das Leben gibt.
Die Rede Jesu weckt bei den Zuhörern Erinnerungen an andere weitererzählte Erfahrungen, wie sie das Buch Exodus beschreibt: Der Traum vom Brot, das vom Himmel fällt und alle ohne besondere Mühe satt machen kann: Es ist der Traum vom Schlaraffenland. In der jüdischen Tradition kam noch die Erwartung hinzu, dass derjenige, der das Manna-Wunder, wie einst in der Wüste, noch einmal vollbringen würde, der Messias sein muss. Das Zeichen der Brotvermehrung reicht dafür aber nicht aus. Wie immer lehnt Jesus jede Wundersucht und alle frommen Erwartungen ab und setzt auf die Mitwirkung der Menschen.
Die Sorge um das tägliche Brot treibt die Menschheit zu aller Zeit um bis in unsere Tage. Es werden immer mehr Menschen, die nicht satt werden. Jesus spricht vom Brot des Lebens und das schließt das tägliche Brot nicht aus. Im Gegenteil. Und trotzdem braucht der Mensch mehr als nur das tägliche Brot. Er hungert ebenso nach Liebe und Zuwendung, nach Anerkennung und Aufmerksamkeit, Frieden und Gerechtigkeit sowie auf Antworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens (und des Sterbens).
So wie Menschen auf ärztlichen Rat zur Wiedergewinnung ihrer Gesundheit ihre Ernährungsweise ändern, so lädt Jesus hier die Menschen ein, ihre Lebensweise ganz bewusst auf ihn umzustellen. Kauen und verdauen genügen da nicht. Einfach nur sonntags zur Kommunion gehen, hat keine besondere Auswirkung auf Ernährung oder Energie. Der Christ wird zeitlebens die Worte und Taten Jesu kauen und essen, damit ihn deren Kraft durchdringt und Teil seines Lebens wird. Wie beim täglichen Brot auch wird er daraus leben, seine Kraft beziehen und sie mit anderen teilen, ganz selbstverständlich, ohne extra groß darüber nachdenken oder reden zu müssen. Aus dieser Selbstverständlichkeit des Glaubens heraus bezieht er dann auch seine Antworten, auch die auf die Frage nach dem Sinn des Lebens.
Der schlafende Jesus
Am Abend dieses Tages sagte er zu ihnen: Wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg; und andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See: Schweig, sei still! Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander: Wer ist denn dieser, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen?
(Mk 4,35–41)
Jesus schläft in aller Ruhe, während anderen buchstäblich das Wasser bis zum Halse steht. Ein einziges Mal wird im Neuen Testament von einem schlafenden Jesus berichtet. Schlaf bedeutet hier ganz sicher mehr als nur ein körperliches Geschehen. »Wie kann Gott das zulassen?«, drücken es Menschen angesichts unverständlicher Schicksalsschläge aus.