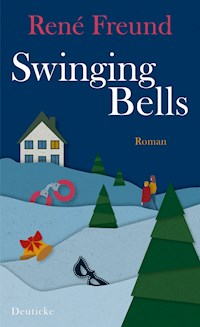Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fred Firneis, Lyriker mit Sensationsauflagen, leidet nach langen alkoholdurchtränkten Jahren an einem Burnout. Seine Verlegerin, die ihn in seiner Berliner Wohnung aufspürt, schickt ihn in eine Holzhütte in die Alpen nach Österreich. In Grünbach am See gibt es weder Strom noch Handyempfang, und Firneis kommt wieder zu Kräften. Doch dann taucht Mara auf, eine junge Biologin aus der Slowakei, die ihre Doktorarbeit über die Elritze schreibt, einen spannenden kleinen Schwarmfisch. Bald interessiert sich Fred für sämtliche Details von Biologie, Verhaltensforschung - und Mara, die jedoch plötzlich verschwindet … Eine alpine Liebesgeschichte mit Humor und Showdown in Berlin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Deuticke E-Book
René Freund
Liebe unter Fischen
Roman
Deuticke
ISBN978-3-552-06216-0
Alle Rechte vorbehalten
© Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 2013
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
16. Juni
»Anrufbeantworter von Alfred Firneis. Bitte hinterlassen Sie keine Nachricht. Ich rufe nicht zurück.«
»Firneis! Ich grüße Sie. Hier spricht Beckmann, falls Sie noch wissen, wer ich bin. Hören Sie, Firneis, wär doch mal wieder Zeit, was zu machen. Ein schönes Bändchen auf die Reihe bringen. Muss nicht viel sein. Ein paar Texte werden Sie bestimmt in der Pipeline haben, Herr Firneis. Seien Sie doch so freundlich und rufen Sie mich zurück. Im Übrigen sind Sie per Mail nicht zu erreichen. Hat Ihr Computer ein Problem?«
18. Juni
»Anrufbeantworter von Alfred Firneis. Bitte hinterlassen Sie keine Nachricht. Ich rufe nicht zurück.«
»Firneis, ich bin’s noch mal. Beckmann. Hören Sie, es wäre doch echt an der Zeit, wieder was nachzuschieben. Die Vertreter machen Druck! Firneis, der Markt lechzt nach Ihnen! Von Im Schein der Wolkenkratzer haben wir jetzt Hundertfünfzigtausend verkauft. Jenseits von Mitte ist vergriffen, wir drucken gerade nach. Mensch, Sie sind der einzige Lyriker im deutschen Sprachraum, der Kasse macht. Sie müssen jetzt nachlegen, Firneis, der Markt vergisst schnell! Rufen Sie umgehend zurück. Oder schalten Sie Ihr Handy ein!«
19. Juni
»Anrufbeantworter von Alfred Firneis. Bitte hinterlassen Sie keine Nachricht. Ich rufe nicht zurück.«
»Ich hätte da auch schon ’nen Titel für Sie, Firneis. Irgendwas mit Kreuzberg. So wie Liebling Kreuzberg, nur anders. Griffiger. Poetischer. Sie wissen, was ich meine, Firneis. Wir sollten keine Zeit mehr verlieren.«
19. Juni
sms: »Lieber Firneis! Ihr Anrufbeantworter kotzt mich an. Bitte dringend um Rückruf.«
20. Juni
Nachricht, Mobilbox: »Lieber Herr Firneis, ich weiß, dass Sie in Berlin sind. Ihr Spiel ist albern. Ich sag Ihnen die Wahrheit, Fred, ich hab Ihren neuen Lyrikband bereits angekündigt. Es fehlen eigentlich nur noch die Texte. Und der Titel! Ich … ich erhöhe Ihre Tantiemen auf elf Prozent. Bitte dringend um Rückruf! Susanne Beckmann. Ihre Verlegerin, falls Sie sich daran noch erinnern können!«
21. Juni
Na gut, dachte Susanne, dann müssen wir es eben auf die harte Tour machen. Das störte sie nicht. So kam sie zumindest einmal aus dem Büro heraus, und das war an diesem sonnigen Nachmittag nicht das Schlechteste. Die Fahrt nach Kreuzberg zögerte sie ein wenig hinaus. Als überzeugte »Schnitte von Mitte«, wie sie sich selbst titulierte, genoss sie zunächst den gut halbstündigen Spaziergang von ihrem Verlagsbüro in der Tucholskystraße zu ihrer Wohnung in der Kollwitzstraße. Zwar hatten die iPhones und iPads, die mit ihren Menschen durch die Straßen liefen, für ihren Geschmack ein wenig überhand genommen, aber immerhin konnte sie sich unter all diesen jungen und elitären Leuten selbst auch ein wenig jugendlich und mondän fühlen.
Susanne hatte das Glück gehabt, noch vor dem Boom eine erschwingliche Mietwohnung in der Gegend um den Prenzlauer Berg zu finden. Noch dazu mit einer Dachterrasse, auf der sie nun Kaffee trank. Sie liebte dieses kleine Refugium mit dem Bretterboden und dem Holztisch, an dem sie auch abends gerne saß, mit Freunden bei Wein und Kerzenschein. Besser ging es gar nicht. Nun ja, ein Mann fehlte vielleicht für die perfekte Idylle, gestand sich Susanne manchmal ein, wenn sie ehrlich zu sich selbst war. Männer gab es in ihrem Leben. Aber der Mann war nicht dabei. Schließlich werden die Ansprüche an einen Partner im Lauf eines Lebens nicht geringer. Susannes Ansprüche waren hoch und ihr Wille, lieber allein als mit einem Kompromiss zu leben, ungebrochen.
Susanne goss ihre Rosmarinsträucher und Lorbeerbäumchen und duschte kalt, bevor sie sich auf die Reise nach Kreuzberg machte. Eine Reise, die sie nicht nur wegen der Aufgabe, die ihr bevorstand, nicht gerne antrat, sondern auch, weil sie Kreuzberg nicht sonderlich mochte. Überhaupt den Bergmannkiez, wo Fred wohnte, ein ihrer Meinung nach vollkommen überschätztes Viertel, das sie ein wenig schmuddelig fand.
Susanne Beckmann blieb vor einem Haus stehen. Sie sah an der Fassade hinauf. Die Fenster im zweiten Stockwerk waren geschlossen und von einer dicken Schmutzschicht bedeckt. Susanne atmete durch und drückte die schwere Eingangstür auf.
Die Glocke läutete schrill. Susanne drückte den Klingelknopf, immer wieder. An der Wohnungstür hing ein kleines Messingschild: Alfred Firneis. Daneben vier kleine Löcher. Offensichtlich war hier ein anderes Schild abmontiert worden. Vor Firneis’ Wohnung sah es aus wie bei der Altpapiersammlung. Briefe, Werbeprospekte, Pakete stapelten sich auf dem Flur. Susanne hielt inne. Lauschte. Sie hörte jemanden in der Wohnung herumschleichen. Sie beschloss, weiter zu klingeln, wobei sie sich bemühte, den Rhythmus so nervenaufreibend wie möglich zu gestalten.
Endlich ging die Tür auf. Fred Firneis stand seiner Verlegerin leicht gekrümmt, aber keineswegs überrascht gegenüber. Er trug Shorts und ein ärmelloses Unterhemd, das mit seinen vielen Flecken als Menükarte der Nahrungsaufnahme der letzten Tage dienen konnte.
»Wusste ich’s doch«, sagte Fred.
»Wenn Sie es wussten, hätten Sie ruhig früher aufmachen können«, sagte Susanne, »darf ich reinkommen?«
Fred gab zögernd den Weg frei. »Es ist nicht besonders aufgeräumt.«
Susanne drängte sich an ihrem Autor vorbei. Die Tür fiel zu. Es war ziemlich düster in Alfreds Altbauwohnung, weil der Schmutz auf den Fensterscheiben das Licht nicht so richtig durchließ. Susanne Beckmann sah sich um. Nicht besonders aufgeräumt, dachte sie, ist eine Untertreibung. Eine gewaltige Untertreibung. Es gab, genau genommen, nicht einmal einen freien Sitzplatz, den Fred seiner Verlegerin hätte anbieten können. Leere und halbleere Flaschen standen überall herum. Aschenbecher quollen über, Kartons mit Pizzaresten und Papiertassen vom Take-away-Chinesen blockierten Sofa und Stühle, Zeitungen und Zeitschriften stapelten sich auf dem Tisch.
»Wollen Sie was trinken?«, fragte Fred, »Jack Daniels … Smirnoff? Bordeaux hab ich auch noch irgendwo … Montepulciano?«
»Was ohne Alkohol?«
»Leitungswasser.«
»Dann lieber ein Glas Wein.«
Susanne nahm einige der herumstehenden Gläser und beförderte sie in die Küche. Dort sah es noch schlimmer aus als im Wohnzimmer. Etwas verlegen lief Fred hinterher.
»Lassen Sie, ich wasch es selbst«, sagte Susanne, die bei ihrem Glas auf Nummer sicher gehen wollte.
»Warum kommen Sie zu mir?«, fragte Fred.
»In Ihrer Spüle wachsen Pilze.«
»Die brauche ich für meine Pizza funghi.«
Da Susanne kein vertrauenswürdiges Geschirrtuch fand, hielt sie Fred das tropfende Glas vor die Nase.
»Wo ist der Wein?«
Fred begann, zunächst in einem Küchenschrank, dann im Kühlschrank, danach im Wohnzimmer nach Wein zu suchen. Er fand nur leere Flaschen. Immerhin stieß er zufällig auf Jack Daniels und nahm einen tiefen Schluck aus der Flasche. Denn Whisky half bei Aufregungen wie einem unerwarteten Besuch.
»Ich ruf im Laden unten an«, sagte Fred. »Özer bringt mir Wein rauf, wenn er Zeit hat. Obwohl er Moslem ist. Kann aber ein, zwei Stunden dauern.«
»Warum gehen Sie nicht in den Laden runter und kaufen eine Flasche?«
»Nein.«
Susanne sah Fred fragend an. Fred nahm noch einen Schluck aus der Flasche und seufzte: »Ich war schon seit Wochen nicht mehr draußen.«
»Warum nicht?«
»Interessiert mich einfach nicht.«
»Wir gehen jetzt gemeinsam raus und kaufen eine Flasche Wein.«
»Nein, das machen wir nicht!« Fred bemerkte, dass er ungebührlich laut geworden war, deshalb setzte er hinzu: »Wissen Sie, draußen, da bekomme ich so … Schwindelgefühle. Aber das haben viele. Als würde sich alles drehen.«
»Wenn ich Sie an der Hand nehme, Fred, dann sind Sie in Sicherheit.«
»Ist wirklich nicht nötig. Mir ist da unten einfach zu viel los. Und wenn so viele Leute da sind, zum Beispiel im Supermarkt, kennen Sie das? Wenn das Herz so pocht? So schnell? Und total unregelmäßig? Mir wird davon schwindlig und dann lauf ich schnell heim, da kann mir nichts passieren. Ich ruf jetzt Özer an. Ist einer unserer letzten Türken hier im Kiez. Die werden alle verdrängt von Ihren Wessis aus Mitte mit den Luxuskinderwagen.«
»Erstens sind es nicht meine Wessis und zweitens sind Sie hier der Zuwanderer.«
»Warum sind Sie gekommen?«
Susanne ging zu einem der Fenster im Wohnzimmer und riss es auf.
»Sie brauchen Hilfe«, sagte sie.
Frische Luft strömte herein und mit ihr Straßenlärm, Gelächter und Vogelgezwitscher.
Fred verschränkte die Arme: »Man soll keinem helfen, der nicht darum gebeten hat.«
»Alfred, Sie brauchen professionelle Hilfe.«
»Sie meinen einen Psychiater?«
»Ich meine zunächst mal eine Putzfrau.«
22. Juni
sms: Lieber Alfred! Bitte werfen Sie Ihren Computer an! Gruß Susanne
sms: danke für die reinigungskraft. ich fürchte, jetzt braucht sie professionelle hilfe. in dem fall psychologische ☺
sms: Rufen Sie Ihre Mails ab, damit ich Ihnen wieder schreiben kann. Das Getippse ist mühsam.
sms: ich kann keine mails abrufen.
sms: ?
sms: ich hab meinen laptop weggeworfen.
sms: Da waren doch sicher neue Gedichte drauf?!
sms: keine sorge. ich habe ihn mit einem hammer zertrümmert und erst dann in die mülltonne getan.
Gespräch, Mobiltelefon
Susanne: Das war ein Scherz.
Fred: Nein, wieso?
Susanne: Sie haben Ihren Computer nicht wirklich zerstört?!
Fred: Schon.
Susanne: Wir müssen miteinander reden.
Fred: Ich brauche keine Hilfe.
Susanne: Ich brauche Hilfe!
Fred: Putze oder Psycho?
Susanne: Ich brauche ein erfolgreiches Buch. Und zwar ziemlich dringend.
Fred: Dann müssen Sie sich einen guten Autor suchen. Versuchen Sie es mal mit einem Krimi. Die sollen gut gehen.
Susanne: Jetzt weiß ich’s. Sie haben den Verlag gewechselt.
Fred: Was?
Susanne: Sie sind jetzt bei Suhrkamp.
Fred: Nein.
Susanne: Bei Hanser!
Fred: Nein!
Susanne: Können wir miteinander essen gehen?
Fred: Nein.
Susanne: Bitte! Alfred! Seien Sie ein bisschen kooperativ. Sie brauchen doch auch Geld!
Fred: Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht, da draußen unter Leuten zu sitzen.
Susanne: Ich komme zu Ihnen.
Fred: Ich weiß nicht.
Susanne: In zwei Stunden. 19 Uhr.
Fred: Heute war schon die Putzfrau da. Ich schaff das nicht. Ich bin müde.
Susanne: Morgen.
Fred: Rufen Sie morgen an.
Susanne: Sie gehen dann wieder nicht ran!
Fred: Ich weiß nicht.
Susanne: Ich bin morgen um 19 Uhr bei Ihnen. Tschüss!
23. Juni
Fred Firneis und Susanne Beckmann saßen an Freds Esstisch, der seit kurzem wieder als solcher erkennbar war. Die Reinigungskraft hatte ganze Arbeit geleistet.
Während Fred ein Glas Wein nach dem anderen in sich hineinschüttete, aß Susanne sämtliche Papierboxen des Take-away-Asiaten leer. Drei Gerichte für zwei, das sollte reichen, hatte sie gedacht, aber jetzt futterte sie ganz alleine, knusprige Ente, Garnelen mit Ingwer, Rindfleisch mit Koriander.
»Sie sollten auch etwas essen«, sagte sie vorwurfsvoll.
»Ich habe keinen Hunger«, antwortete Fred. »Aber das Zeug ist nicht schlecht. Obwohl es natürlich kein Vietnamese ist, sondern ein Chinese. Er behauptet nur, er wäre Vietnamese, um sich interessant zu machen.«
Susannes iPhone meldete sich. Während sie mit der rechten Hand Garnelen fing, checkte sie mit links die neuen Mails und Postings. Da Fred ohnehin nur trank und vor sich hin starrte, nahm Susanne sich die Zeit, auf ihre elektronische Post zu antworten. Sie schaffte es aber, gleichzeitig zu reden: »Sie sollten sich einen Computer kaufen. Zumindest einen Tablet.«
»Ich will nicht.«
»Sie müssen wieder Anschluss finden. Anschluss an die Welt! Sie müssen kommunizieren! Warten Sie mal. Ich zeig Ihnen was.«
Susanne warf die Garnelenschale in eine leere Papierbox und wischte sich den Mund ab. Sie nahm ihr iPhone, tippte etwas ein, setzte sich neben Fred.
»Sehen Sie mal. Die Facebook-Fanseite, die wir für Sie eingerichtet haben: Sie haben 2768 Freunde! Stellen Sie sich das mal vor! Die liken Sie alle! Hier, lesen Sie: ›Jenseits von Mitte ist der beste, ironischste, witzigste, hintergründigste Gedichtband, den ich je gelesen habe. Bitte mehr davon!‹ Das schreibt diese Petra. Gucken Sie mal! Die sieht richtig gut aus. Und hier: ›Felicidades a Fred!‹ Mercedes aus Barcelona. Wir haben in Spanien 3000 verkauft. Und erst die Franzosen, die lieben ja Gedichte. Im Schein der Wolkenkratzer hat dort über 11.000 verkauft! Hier, eines der vielen Postings: ›Bonjour, je dévore A la lueur des gratte-ciels. Je ris, je pleure! Merci! Isabelle, Paris.‹«
»Lauter Frauen«, seufzte Fred missmutig.
»Nein, auch Männer. Hier, ein Uni-Professor aus den USA. Germanist: ›I loved your books (Jenseits von Mitte and Im Schein der Wolkenkratzer). Will there be more poems?‹ Sie machen die Menschen da draußen glücklich, Fred. Die wollen Sie. Die lechzen nach Neuem!«
»Wer hat Ihnen überhaupt erlaubt, diese Facebook-Seite zu machen?«
»Alfred, die Werbung mit neuen Medien ist Teil des Vertrags. Es wäre höchst unprofessionell von uns, keine Facebook-Fanseite für unseren erfolgreichsten Schriftsteller einzurichten.« Susanne ließ drei Stück Ente gleichzeitig in ihrem Mund verschwinden, was Fred mit dem Leeren seines Glases beantwortete.
»Ich wette, die meisten haben die Gedichte gar nicht gelesen«, rief er aus, »und wenn, dann nicht verstanden. Das ist doch alles Selbstdarstellungs-Scheiße. Wissen Sie, was Facebook für mich ist? Das ist so wie Die große Chance oder Germanys next Top-Irgendwas. Eine riesige Castingshow! Und alle sind gleichzeitig Kandidaten und Jurymitglieder und müssen rund um die Uhr beweisen, wie toll sie sind und wie gut es ihnen geht und dass sie es wert sind, geliebt zu werden. Dabei wissen die nicht mal, wer sie sind und was an ihnen liebenswert sein soll, weil sie sich selbst am allerwenigsten lieben!«
»Das ist doch Intellektuellen-Quatsch, was Sie da reden.«
»Außerdem ist Facebook von vorgestern«, fügte Fred trotzig hinzu. »Glauben Sie, ich habe meinen Computer zum Spaß zerstört? Ich verachte dieses jämmerliche Ersatzleben! Und während ich diesen Satz ausspreche, hat es auf Ihrem Ding da schon wieder fünfmal düdeldü gemacht und Sie haben drei Anrufe oder Postings oder sms oder Mails oder was versäumt! Ständig ist man dabei, irgendwas zu versäumen!«
Fred schenkte sich ein weiteres Glas ein und zündete sich eine Zigarette an, an der er zornig saugte. Susanne seufzte. Sie hatte mit ihrem Autor schon mehr Spaß gehabt.
»Alfred, Sie betrinken sich jeden Tag, arbeiten keinen Strich und gehen nicht mehr aus Ihrer Wohnung. Finden Sie das toll? Oder ein richtiges Leben im Gegensatz zum Ersatzleben? Sie trauen sich ja nicht einmal mehr auf die Straße. Sie haben Angst!«
»Was?«
»Angstzustände. Panikattacken. Burnout. Und Sie sind gerade dabei, in eine hartnäckige Depression zu schlittern, wenn Sie mich fragen.«
»Haben Sie studiert?«
»Ich habe Erfahrung.«
»Mich hat dieser Psychokram noch nie interessiert. Ich helf mir selber. Wenn ich will.«
»Könnte ich vielleicht auch mal ein Glas Wein haben? Die zweite Flasche haben Sie fast alleine gesoffen.«
»Tschuldigung«, sagte Fred und leerte den Rest der Flasche gleichmäßig in beide Gläser.
»Sie sind doch der Meister der Überraschungen! Des Neuen, Frischen!« Susanne versuchte, mitreißend zu wirken. »Noch nie musste man von Ihnen eine Zeile lesen, die auch nur das geringste Klischee beinhaltete! Und jetzt das? Schriftsteller in der Schreibkrise in der unaufgeräumten Wohnung! Ist Ihnen so viel Klischee nicht peinlich?« Ein Versuch, dachte Susanne. Eine kleine Charmeoffensive. Zuckerbrot. Doch Alfred Firneis zeigte nicht einmal den Anflug eines Lächelns. Stattdessen stellte er mit der größten Überzeugtheit fest: »Klischee hin oder her – was ich schreibe, ist Müll, das ist eine Tatsache.«
Susanne stöhnte und schob die Sojasprossen entnervt aus ihrer Reichweite: »Was soll’s. Mich geht’s nichts an.«
»Da haben Sie recht«, sagte Fred schnell. »Ich brauche Ihr Mitleid nicht.«
»Ich habe kein Mitleid mit Ihnen. Ich bin Ihre Verlegerin und möchte ein neues Buch.«
»Sie reden so viel! Und so laut! Ich weiß schon, Sie wohnen am Prenzlauer Berg, da sind die Leute alle ein bisschen laut und ein bisschen oberflächlich, aber übertreiben Sie es nicht ein wenig?«
»Ich finde, Sie übertreiben, Alfred. Zumal Sie in einer Gegend wohnen, die längst von Latte Macchiato überschwemmt ist.«
Das saß. Zumal Fred schon länger überlegt hatte, doch nach Neukölln zu ziehen, wovon ihn in erster Linie die Anstrengungen einer Übersiedlung abgehalten hatten.
»Diese Mitte-Leute haben auf Sie abgefärbt«, sagte er, um wieder in die Offensive zu gehen. »Kohle. Sie wollen Kohle mit mir machen.«
»Ja. Auch! Und wissen Sie, warum? Ihr Erfolg hätte uns beinahe umgebracht. Klingt jetzt vielleicht doof, aber wir haben gleichzeitig Steuervorauszahlungen und Nachzahlungen zu leisten! Da kennen die keine Gnade. Dieses Schicksal wird Sie im Übrigen auch treffen.«
»Ich bin Österreicher.«
»Das wird Ihnen nichts helfen. Sie werden Geld brauchen!«
»Ich werde was anderes machen. Etwas, was sicher nichts mit Schreiben zu tun hat.«
»Oh Gott, jetzt fangen Sie wieder damit an!«
»Nein. Ich höre damit auf. Endgültig. Düdldidum. Sie haben schon wieder was versäumt. In Ihrem Ersatzleben.«
Susanne verstaute ihr Telefon in der Tasche. Am liebsten wäre sie jetzt gegangen, doch erstens war sie zäh, und zweitens entsprach es leider der Wahrheit: Sie brauchte tatsächlich einen Bestseller, um den S. Beckmann Verlag zu sanieren. Und der einzige Bestseller-Autor in ihrem Stall war nun mal Alfred Firneis. Ausgerechnet ein Lyriker. Es war zum Heulen.
»Alfred. Was uns gemeinsam passiert ist, war ein Wunder. Das wissen Sie. Es ist praktisch unmöglich, von einem Gedichtband mehr als fünfhundert Stück zu verkaufen. Sie haben zwei Bände mit jeweils mehr als Hundertfünfzigtausend verkauft, mit den Taschenbuch-Ausgaben und den Übersetzungen ist das fast eine halbe Million. Herr Firneis! Das ist ein Gottesgeschenk! Ein Wunder! Werfen Sie das nicht weg!«
»Wunder kann man nicht wiederholen.«
»Sie haben es bereits wiederholt. Und ich bin überzeugt davon, es geht noch einmal.«
»Ich nicht.«
»Wollen Sie es nicht versuchen?«
»Es ist verdammt hart, nach einem Erfolg einen Misserfolg einzustecken.«
»Sie werden doch kein Feigling sein?«
Fred trank, rauchte und dachte nach. Susanne spürte, dass er nun etwas weicher wurde, und setzte nach: »Fred, wovor laufen Sie davon?«
Fred sagte nichts.
»Schreiben Sie überhaupt irgendwas?«
»Klar«, sagte Fred. »Aber das ist alles Müll.«
»Sagten Sie bereits. Vielleicht stimmt es nicht. Zeigen Sie es mir.«
»Ich kann das schon beurteilen. Wissen Sie – bei meinen guten Gedichten war es so – sie wussten mehr als ich. Sie haben Türen geöffnet, hinter denen Räume lagen, von denen ich selbst nichts wusste. Aber die Türen sind zu. Oder die Räume weg …«
»Schreiben Sie darüber!«
»Nein.«
»Was machen Sie eigentlich den ganzen Tag?«
»Dies und das. Ehrlich gesagt, nicht viel.«
»Sie haben nicht mal einen Fernseher.«
»Den hab ich verschenkt. Ich bin mal über eine Werbung gestolpert, da sah man eine Kuh auf der Weide, auf so einer schönen grünen österreichischen Almwiese, und das Herz ging mir auf. Danach sah man ein verpacktes Stück Fleisch. Der Sprecher sagte: Knallhart kalkuliert. Rinderfilet, jetzt um 12,99. Da musste ich weinen.«
»Früher hätten Sie ein Gedicht draus gemacht.«
»Sie kalkulieren auch knallhart.«
»Und Sie haben also geheult wie ein Mädchen und dann Ihren Fernseher verschenkt?!«
»Ja. Seitdem ess ich nur noch Veggie-Pizza und dieses chinesische Garnelenzeug.«
Der ist leider richtig durchgeknallt, dachte Susanne.
»Wissen Sie was? Gehen Sie den Jakobsweg! Das hat schon viele auf andere Ideen gebracht.«
Alfred lachte höhnisch: »Allein wenn ich Jakobsweg höre, bekomme ich die Krise.«
»Die haben Sie schon.«
»Sie denken, ich bin dann mal weg und komme als Hape Kerkeling der Lyrik mit einem Rucksack voller Gedichte zurück?«
»Eine Veränderung würde Ihnen gut tun. Das ist alles, was ich denke.«
Fred sagte nichts. In der sich ausbreitenden Stille öffnete er die dritte Flasche Rotwein, schenkte allerdings nur sich selbst nach.
»Nun ja«, sagte er kühl, »schön, dass Sie da waren. Danke für den Wein.«
»Mein Vater ist vor drei Wochen gestorben«, sagte Susanne.
»Das tut mir leid.«
»Muss es nicht. Er war ein verbitterter alter Mann. Seit meine Mutter gestorben ist, wollte er nichts als abtreten von dieser Welt. Schade um die gute Zeit, die er noch hätte haben können. Ich hab ihn nicht mehr viel gesehen. Er hat in München gewohnt. Bis vor zwei Jahren verbrachte er noch jeden Sommer in unserer Hütte am Elbsee, aber das hat er dann nicht mehr gewollt. Trotz der slowakischen Pflegerin. Sieht aus wie ’ne Striptease-Tänzerin, hat er immer gesagt, und sie kocht auch so.«
»Wollen Sie mir etwas damit sagen?«
»Die Hütte ist frei. Sie können sich gerne kreativ dorthin zurückziehen.«
Da Fred nicht antwortete, begann Susanne, die Reste des Essens zusammenzuräumen, wobei sie sich nicht daran hindern konnte, noch den einen oder anderen Bissen in ihrem Mund zu entsorgen. Jetzt wollte sie Fred noch ein bisschen quälen, das hatte er verdient.
»Und Charlotte? Wann ist sie ausgezogen?«
»Vor drei Monaten. Ich möchte nicht darüber reden.«
»Haben Sie einen Freund? Einen guten Freund?«
»Ich möchte mit niemandem darüber reden.«
»Ihnen fehlt eine Muse.«
»Geben Sie’s auf.«
»Sie brauchen eine Frau.«
»So dringend wie einen Schuss ins Knie.«
Fred sprang plötzlich auf. Er wankte. Sein Gesicht war rot, knallrot, und er schwitzte, der Schweiß rann in feinen Strömen aus seinen zottigen Haaren.
»Was ist denn das für ein Rotwein? Kalifornisch oder was? Ich vertrag nämlich keine Kalifornier!«
»Sie sind ganz rot! Setzen Sie sich hin!«
»Das sind diese Tannine.«
Fred schleppte sich zu einem Ladenschrank und holte ein Blutdruckmessgerät heraus.
»Das ist ein Südfranzose aus biologisch-dynamischem Anbau«, sagte Susanne. »Nicht bewegen beim Messen!« Sie wusste, wie man korrekt den Blutdruck misst, sie hatte es bei ihren spärlichen Besuchen bei ihrem Vater zur Genüge geübt. Ein Pfeifsignal ertönte. »Sehen Sie, Error!«, schimpfte Susanne.
Fred begann mit einer neuen Messung. Susanne stand auf, um das kleine Display zu sehen. »Das kann nicht stimmen. Winkeln Sie den Arm an!«
Fred wiederholte den Vorgang. Beide starrten auf das Display.
Fred stöhnte: »180 Blutdruck, das hatte ich schon. Aber 195 Puls!«
Susannes Unruhe steigerte sich zu einer leichten Panik. Hektisch nahm sie Freds Arm und hielt ihre Finger an sein Handgelenk.
»Ihr Herz rast!«
»Ich weiß!«
Fred stand auf, er torkelte Richtung Sofa, ließ sich stöhnend darauf nieder.
»Das wird wieder … Bitte gehen Sie jetzt …«, brachte er gerade noch heraus.
Susanne hatte ihr Telefon aus der Tasche geholt. »Fred! Atmen Sie! Atmen Sie weiter! Ich rufe jetzt den Notarzt.«
24. Juni
Zu dritt standen sie um das Bett des Patienten Firneis, Alfred: eine ältere Ärztin, eine junge Ärztin und ein Arzt. Lag es am Mundschutz, dass ihre Blicke so finster wirkten? Mit einem Mundschutz sehen Menschen selten freundlich aus, das verbindet Bankräuber, Western-Bösewichte und Ärzte.
Die Ärzte starrten auf verschiedene Monitore, die über Freds Kopf zu schweben schienen und äußerst unharmonische Linien zeigten. Hektisch und unrhythmisch piepste dazu der Ton, der die Herzfrequenz wiedergab. Der Arzt kontrollierte die Elektroden an Alfreds Armen. Er sah auf seine Uhr. Es war fünf Minuten nach Mitternacht.
Die Ärztinnen sahen einander an. Das Piepsen klang plötzlich wie ein Kreischen, dann wie das Schreien einer Auto-Alarmanlage. Mit einem Mal – Stille. Und danach – ein summender Dauerton.
Keine lebendigen Zacken mehr auf den Bildschirmen.
Eine gleichmäßige Linie.
25. Juni
Trotz ihrer langen Berufserfahrung erschrak die ältere Ärztin, als sie das sonnendurchflutete Zimmer betrat. Auf dem Krankenhausbett lag ein Körper. Und auf dem Körper lag ein Leintuch, das auch Gesicht und Kopf bedeckte.
Mit drei schnellen Schritten erreichte die Ärztin das Bett und riss das Leintuch von dem Körper. Fred Firneis setzte sich mit einem Ruck auf.
»Sie erschrecken mich zu Tode«, rief er aus.
»Und was glaubt er was er macht?«, antwortete die Ärztin, die freundliche Augen und einen ausgeprägten Berliner Dialekt hatte. »Spielt Leiche, was?«
»Es war so grell, ich konnte nicht schlafen.«
»Fühlen Sie sich müde? Erschöpft?«, fragte die Ärztin.
»Nach diesem Belastungs-EKG wären Sie auch erschöpft!«
Die Ärztin lachte. Sie setzte sich auf einen Stuhl neben Freds Krankenbett und sah ihn an. Fred mochte sie auf Anhieb. Ihr Zigarettenatem und ihr braungebranntes Gesicht mit den markanten Falten beruhigten ihn. Deshalb traute er sich, die alles entscheidende Frage zu stellen: »Wie lange habe ich noch zu leben?«
»Ja, deswegen bin ich gekommen«, sagte die Ärztin.
Fred spürte regelrecht, wie er erblasste. Er legte sich wieder hin.
»Sie werden heute Nachmittag entlassen«, sagte die Ärztin.
»Ich bin unheilbar? Sie geben mich auf?«
»Herr Firneis: Sie sind vollkommen gesund! Auch wenn Sie letzte Nacht kurz tot waren.«
»Was?«
»Wie haben Sie das erlebt? Manche Patienten beschreiben die Erfahrung als sehr unangenehm.«
»Ich hab gar nichts gespürt! Ich war tot?!«
»Wir terminieren Tachykardien wie die Ihre mit Adenosin, wenn es indiziert ist.«
»Was bedeutet das auf Deutsch?«, wollte Fred wissen.
»Wir haben ein gutes Mittel, um solches Herzrasen zu stoppen. Wir haben Ihnen Adenosin gespritzt, ein Medikament, das zu einem kurzen Herzstillstand führt. Adenosin ist ein todsicheres Mittel, keine Sorge! Die Halbwertszeit beträgt ein paar Sekunden. Dann beginnt das Herz wieder zu schlagen, und zwar in einem normalen Rhythmus. Verstehen Sie? Die Reset-Taste. Das Ganze ist wie ein Neustart. Ihr Puls sank von 220 auf 75, in wenigen Sekunden. Alle anderen Untersuchungen gestern und heute haben Sie ja mitbekommen. Das EKG ist unauffällig, die Ergometrie zeigt keinerlei Hinweis auf eine belastungsinduzierte Minderperfusion, der Sinusrhythmus ist durchgehend, auch unter Belastung keine Endstreckenkinetik. Die Echokardiographie zeigt eine gute systolische Pumpfunktion und keine Klappendysfunktion. Von der Stoffwechselfunktion her besteht eine Euthyreose.«
»Eiterrose«, murmelte Fred erschrocken. »Kann man daran sterben?«
Wieder musste die Ärztin lachen. »Euthyreose bedeutet, dass Ihre Schilddrüse vollkommen normal funktioniert. Herr Firneis, Sie sind gesund.«
»Das hat sich aber nicht so angefühlt.«
»Sollten Sie in nächster Zeit noch mal dieses Herzrasen bekommen: Es ist ungefährlich, machen Sie sich das klar. Es kann Ihnen nichts passieren. Ich geb Ihnen ’nen Tipp – halten Sie Ihren Kopf unter kaltes Wasser, das hilft oft. Und rauchen Sie nicht so viel, Mann!«
»Bekomme ich gar keine Medikamente?«, fragte Fred enttäuscht.
»Ich kann Ihnen ein Rezept für ’nen Betablocker ausstellen, das sorgt mal für Ruhe.« Mit leiser Stimme fügte sie hinzu: »Es gibt Kollegen, die würden Ihnen das Zeug vorsorglich lebenslang verschreiben. Ich rate Ihnen, nehmen Sie die Tabletten eine Woche lang, und dann werfen Sie die Packung weg. Das haben Sie aber nich’ von mir!«
»Ich versteh nicht ganz …«
»Ich bin ein Fan von Ihnen, Herr Firneis. Nicht jeder bekommt hier ein Einzelzimmer, wissen Sie? Ich dachte, nach Hölderlin und Klopstock in der Schule würde ich nie wieder Lyrik lesen. Ich … ich liebe Ihre Gedichte. Vor allem die Liebesgedichte!«
»Und deshalb soll ich die Mittel nicht nehmen.«
»Sie sind ein junger Mann …«
Fred setzte sich im Bett auf: »Das hat schon lange niemand mehr zu mir gesagt. Schwester! Champagner für die Dame, bitte!«
»Im Ernst, Herr Firneis. Betablocker haben Nebenwirkungen, was die erektile Funktion betrifft. Das wäre doch schade, nicht?«
Fred zuckte mit den Schultern. Momentan war ihm das egal, aber er brachte es doch nicht übers Herz, das zu sagen.
»Außerdem sind Sie nicht krank«, insistierte die Ärztin.
»Das sagen Sie!«
»Das sagen unsere Geräte …«
»… Aber …«
»Reden Sie mir nicht drein, wenn ich Sie unterbreche! Ich weiß, Ihr persönliches Empfinden mag ein anderes sein als die beschränkte Weisheit unserer Computer. Ich kann Sie allerdings beruhigen, Sie sind hier nicht in irgendeiner Klinik, Sie sind in der Charité.«
»Ich bin wahnsinnig stolz drauf«, ächzte Fred.
»Wenn Sie diese Rhythmusstörungen endgültig loswerden wollen, kann ich Ihnen aus meiner Erfahrung nur drei mögliche Therapien empfehlen: Erstens, eine Psychotherapie.«
»Abgelehnt.«
»Zweitens: Meditation.«
»Das ist noch schlimmer. Meditation treibt mich in den Wahnsinn!«
»Drittens – ziehen Sie sich eine Zeitlang zurück, in die Ruhe. Gehen Sie in die Stille. In eine Berghütte zum Beispiel.«
Fred sprang mit einem Satz auf, lief zum Fenster und drehte sich theatralisch um: »Das ist ein Komplott! Geben Sie es zu, Sie stecken unter einer Decke!« Die Sache mit der Berghütte konnte kein Zufall sein. Seien Sie in meiner Hütte kreativ oder so ähnlich hatte Susanne gesagt. Hütte – Berghütte – das war zu viel des Guten!
»Was genau meinen Sie mit Komplott, Herr Firneis?«
»Hütte – Hütte! Das ist das Hüttenkomplott!«
Fred ging zum Schrank und begann, sich hastig anzukleiden.
Die Ärztin schien nun doch ein wenig irritiert: »Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Aber gewisse zwanghafte Vorstellungen passen absolut zu Ihrem Störungsbild. Wollen Sie nicht noch zu Mittag essen?«
»Nein, danke.«
»Na dann. Tschüss, Herr Firneis. Auf Wiedersehen sag ich mal lieber nich’.«
In der Tür drehte sich die Ärztin noch einmal um. Sanftmütig sagte sie: »Meine Enkeltochter hat gerade die Schule gewechselt. Sie hatte große Ängste vor der neuen Schule, aber sie hat mir verraten, wie sie diese Ängste in den Griff bekommt: Oma, immer, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, rede ich mit der kleinen Fee, die in meinem Herzen wohnt. Da bekomme ich eine Antwort.«
Fred hatte nicht wirklich zugehört und sah die Ärztin ratlos an – gehörte diese Fee auch zum Komplott?
»Denken Sie dran, Herr Firneis«, sagte die Ärztin, ging hinaus und schloss die Tür.
27. Juni
Seit Fred Firneis bei Passau über die Donau gefahren war, regnete es. Das Wasser floss sturzbachartig über die Windschutzscheibe, obwohl der Scheibenwischer auf der höchsten Stufe lief. Immerhin konnte Fred nun fahren, nachdem er auf der Autobahn A9 kurz vor der rettenden Abzweigung bei Hof in einem 25 Kilometer langen Stau gestanden war. Hätte er das gewusst, Fred wäre über Gera oder Chemnitz gefahren, ganz egal, ob das länger dauerte, Hauptsache: fahren.
Fred fuhr langsam, denn auf der Straße stand Wasser, und sein Auto verfügte weder über ABS noch ESP noch all die anderen Dinge, von denen er nicht genau wusste, wozu sie dienten, weil ihn das nicht interessierte. Sich für Technik und Autos zu begeistern, fand er peinlich. Jedenfalls tat er so. Ganz stimmte es ja nicht, denn sein eigenes Auto liebte er geradezu, einen uralten Mercedes, Benzin, Automatik, einer von denen mit senkrechten Scheinwerfern vorne, so alt.
Fred genoss die sagenhafte Heizung, die seine Füße wärmte, und die glatte Geschmeidigkeit der Ledersitze. Als er das sternumkränzte Schild mit der Aufschrift »Republik Österreich« sah, überkamen ihn keinerlei heimatliche Gefühle. Er mochte Österreich, aber er mochte auch seine Wahlheimat Deutschland. Dabei war Fred – wie alle österreichischen Kinder seiner Zeit – sehr antideutsch erzogen worden. Bei ihm zu Hause sagte man statt »Deutscher« prinzipiell »Piefke«. Die Verwendung des Grußes »Tschüss« wurde mit Hausarrest bestraft. Der Piefke galt als laut, geschmacklos und spießig, während der Österreicher sich selbst als charmant, stilvoll und fesch erlebte.
»Tschüss« sagte Fred noch immer nicht gerne, aber gelegentlich gebrauchte er es, um nicht durch ein allzu distanziertes »Auf Wiedersehen« unhöflich zu erscheinen. Ehemalige Tabu-Worte wie »