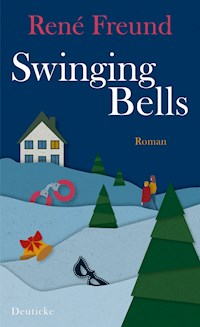Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paris, August 1944. Die Stadt ist von Hitlers Wehrmacht besetzt, doch die Tage der deutschen Herrschaft sind gezählt. Gerhard Freund ist achtzehn, als er zur Wehrmacht eingezogen wird; Mitte August 1944 soll seine Einheit an der Schlacht um Paris teilnehmen. Der junge Soldat erlebt die sinnlose Brutalität des Kampfes und desertiert. Er wird von der Résistance festgenommen und von amerikanischen Soldaten vor der Erschießung gerettet. Mehr als sechzig Jahre später liest René Freund das Kriegstagebuch seines verstorbenen Vaters, stöbert in Archiven, spricht mit Zeitzeugen und fährt nach Paris, auf der Suche nach einem schärferen Bild von seinem Vater – und der eigenen Familiengeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Deuticke E-Book
René Freund
Mein Vater, der Deserteur
Eine Familiengeschichte
Deuticke
Gefördert durch das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Staatsstipendium 2009/10) sowie durch das Land Oberösterreich (Adalbert-Stifter-Stipendium 2010)
ISBN 978-3-552-06269-6
Alle Rechte vorbehalten
© Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 2014
Umschlag: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,
unter Verwendung eines Privatfotos des Autors
[Mein Vater in der Uniform des Reichsarbeitsdienstes,
mit unbekannter Freundin]
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Familienstellen. Ursprungsbild
Vater, dich stell ich in die Mitte. Hierher, ja. Die Mutter zu deiner Linken. Nein. Die Mutter zu deiner Rechten. Dich, meine Schwester, vor die Mutter. Ja, so ist es recht. Mich selbst vor den Vater. Das fühlt sich gut an. Du willst mich sehen, Schwester? Ich wende mich dir zu. Einen Schritt zur Seite. Besser? Gut. Wie geht es dir? Warum hat Mutter Angst? Warum ist Vater zornig? Oder ist er traurig? Fehlt hier jemand? Und du, Vater, warum stehst du neben deiner Mutter? Deine kleinen Schwestern vor dir, als wären sie deine Kinder. Stehst du gut, Mutter? Sind das Tränen in deinen Augen? Dein Vater und deine Mutter stehen hinter dir und deiner kleinen Schwester. Sie scheinen jemanden zu suchen. Und all die anderen tauchen auf aus dunklem Hintergrund, Kinder, geborene und ungeborene, Lebende und Tote, jeder sucht seinen Platz und alles kommt in Bewegung, bleibt in Bewegung, es scheint wie ein Tanz, und die einzelnen Menschen lösen sich auf in dem Ganzen, verschwinden in der Suche nach Gleichgewicht und Ordnung.
1979
Eine Frage wollte ich meinem Vater immer stellen: »Hast du einen anderen Menschen erschossen?« Ich habe es nie gewagt, meinem Vater diese Frage zu stellen. Heute ist es zu spät. Mehr als drei Jahrzehnte zu spät. Mein Vater starb, als ich zwölf war. Ich weiß noch, wie er auf dem Sofa im Wohnzimmer lag und meiner Mutter zustöhnte: »Zweihundertfünfzig zu hundertachtzig.« Er hatte sich den Blutdruck gemessen. Er maß sich ständig den Blutdruck, um sich zu beruhigen, vielleicht auch, um sich zu beunruhigen. In seinem Kopf war eine Ader geplatzt. Aneurysma, hieß es im ärztlichen Fachjargon. Das Wort erinnerte mich zwölfjährigen Buben an den Lieblingsedelstein meiner Mineraliensammlung: Amethyst. Aneurysma war auch violett. Jedenfalls verfärbte es das Gesicht meines Vaters in der Folge violett. Aber das weiß ich nur aus den Erzählungen meiner Mutter. Ich habe meinen Vater »so« nie gesehen. Sie wollte nicht, dass ich und meine vier Jahre jüngere Schwester Natalie ihn »so« sahen. Wir sahen ihn dann nie wieder.
Der Krankenwagen kam und holte ihn ab. Da war ich schon nicht mehr dabei. Meine Mutter hat uns weggeschickt. Ich weiß auch nicht mehr, ob wir den Surbraten noch gegessen haben. Es war ein Sonntag, als das Aneurysma meines Vaters platzte. Das geschah in dem Moment, als er sich zum Backofen hinabbeugte, um nachzusehen, ob der Surbraten schon gar und knusprig war. Mein Vater hätte eigentlich gar keinen Surbraten essen sollen. Er hatte schon fünfzehn Jahre davor eine Gehirnblutung gehabt. Die Ärzte verordneten ihm Diät, Ruhe, sie gaben ihm Blutdrucksenker, Beruhigungsmittel und Aufputschmittel, damit er sich seine Befindlichkeiten einrichten konnte. Damals glaubte man noch mehr als heute an die Macht der Chemie.
1944
Freitag, 11. August
18 Uhr Abschied von zu Hause, 23 Uhr Abfahrt Wien,
Westbahnhof
Der Krieg hat meinen Vater umgebracht, behauptet seine Schwester, meine Tante. Sie sieht ihn als Gefallenen, gestorben für Führer, Volk und Vaterland, 34 Jahre nach Kriegsende. Es waren die Entbehrungen, sagt meine Tante. Und die Angst. Mein Vater war ein unruhiger Mensch. Und er konnte keinem Genuss widerstehen. Die tägliche Rindsbouillon. Innereien. Würste. Fettes Fleisch. Wein. Fernet. Und »Falk«, achtzig Zigaretten täglich. Und die Medikamente. Die Ärzte haben deinen Vater auch umgebracht, sagt meine Tante. Und der Krieg. Aber natürlich hat er sich selbst umgebracht, »weil es muss ja keiner«.
Muss keiner?
Mein Vater musste Soldat werden. Musste er? Geboren am 5. September 1925, erst bei der HJ, dann beim Reichsarbeitsdienst, ein großer, schlanker, blauäugiger Junge. Vier Tage vor seinem vierzehnten Geburtstag konnte dieser hübsche Junge im Radio Adolf Hitlers Worte hören: »Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.« Jene Umkehrung der Tatsachen, die den verheerendsten Krieg der Menschheitsgeschichte einleitete. Zur Ausbildung eingezogen 1943, mit achtzehn Jahren. An die Front geschickt im August 1944. Zwischen Musterungspapieren und Marschbefehlen finde ich ein Gedicht, das er von seiner Mutter zum Abschied bekommen hat. Schon deren Vater war Dichter gewesen. Offensichtlich hat man in diesem Familienzweig Sorgen und Kummer stets literarisch verarbeitet. Das Gedicht der Mutter meines Vaters ist datiert: »Wien, 30.VII.1944«. Die Schrift ist gut zu lesen:
»Mein armer Sohn, Du musst hinaus
Ins Feindesland, ins Schlachtgebraus.
Doch orgelt wild der Tod Dir dort sein Lied,
So denk daran, dass irgendwie Dein Vater mit Dir zieht.
Er, der den Tod schon überwunden,
Er ist bei Dir in jenen Stunden,
Er wird mit seinem Rat Dir gegenwärtig sein.
Lass Deines Vaters Stimme bei Dir ein.
Du weißt, was er einst fühlte und auch litt,
An seiner Bürde trägst auch Du noch mit.
Ringst Du blutig um Dein Leben,
Möge Gott Gelingen geben!
Und Du weißt den Sinn zu deuten,
Um Dein Menschtum musst Du streiten!
Sieg ist, was Du selbst Dir abgerungen!
Deiner Eltern Liebe hält Dich eng umschlungen!
Gedenke auch Du öfter Deiner
Mutter –«
Gymnasiast Gerhard Freund
2010
Die Internet-Plattform WikiLeaks veröffentlicht geheime Dokumente über amerikanische Kriegsverbrechen im Irak. Die Weltöffentlichkeit scheint überrascht. Ich greife wie so oft in das Regal hinter mir und nehme einen Band der zehnteiligen Werkausgabe von Kurt Tucholsky zur Hand. Tucholsky hat immer schon alles gewusst.
In Erinnerung an den Ersten Weltkrieg und als Warnung vor dem Zweiten schrieb Kurt Tucholsky in der Glosse »Der bewachte Kriegsschauplatz« die berühmt gewordenen Sätze: »Da gab es vier Jahre lang ganze Quadratmeilen Landes, auf denen war der Mord obligatorisch, während er eine halbe Stunde davon entfernt ebenso streng verboten war. Sagte ich: Mord? Natürlich Mord. Soldaten sind Mörder.«
Dieser Satz »Soldaten sind Mörder« des ehemaligen Soldaten Tucholsky führte nicht nur 1931 zu einem Prozess, er beschäftigte so oder in Abwandlungen die bundesdeutschen Gerichte bis in die neunziger Jahre. Ich fand diesen Satz immer unbestechlich richtig, einleuchtend und wahr. Doch mein von meinem Vater geprägter Pazifismus, später weiter geschult und bestärkt durch Erich Kästner, Alfred Polgar, Karl Kraus, Konstantin Wecker, Werner Schneyder, hat für mich in den letzten Jahren an Strahlkraft verloren. Ist es mein Verdacht, dass Österreichs bedingungsloser Glaube an die Neutralität mehr mit Provinzialismus als mit Pazifismus zu tun hat? Wie war das im jugoslawischen Bürgerkrieg? Wie war das mit dem Massaker von Srebrenica, wo Tausende Menschen abgeschlachtet wurden? Soll man Gewalt dulden und die Verbrecher walten lassen? Andererseits: Ist nicht das Wort »Kriegsverbrechen« selbst ein Verbrechen? Bedeutet es nicht, dass es einen Krieg gibt, der kein Verbrechen ist?
Hatte nicht Benjamin Franklin die Sache ein für alle Mal geklärt, als er sagte: »There never was a god war or a bad peace.«
Heute werden für Kriege »humanitäre« Gründe vorgeschützt, um die wirtschaftlichen Interessen zu verschleiern. Der brutale Einsatz modernster Waffen in entlegenen afghanischen Bergregionen soll die Welt vom Terrorismus befreien und führt zu dessen Verstärkung. Oder ein paar Jahre vorher: Wer außer ein paar willfährigen Journalisten glaubte tatsächlich an irakische Massenvernichtungswaffen? George Bush selbst wohl am allerwenigsten. Und wer konnte tatsächlich überrascht sein von der via Internet verbreiteten Entdeckung, wonach Krieg eine schmutzige Sache sei? Tausende Zivilisten wurden von überforderten Soldaten über den Haufen geschossen. Es gab systematische, vom Präsidenten selbst angeordnete Folter. Das Bild vom amerikanischen Helden als Behüter der Freiheit hat zuerst in Vietnam, danach im Irak schlimme Kratzer bekommen. Auch Rückschlüsse auf die Vergangenheit durften nun gezogen werden. Man wusste, auch amerikanische Soldaten hatten sich während des Zweiten Weltkriegs diverser Kriegsverbrechen schuldig gemacht. Über das Ausmaß dieser Kriegsverbrechen hat bisher keiner so offen geschrieben wie der britische Historiker Antony Beevor in seinem monumentalen Werk »D-Day. Die Schlacht um die Normandie« (2010). Ich werde darauf zurückkommen.
Im Grunde geht es um die Frage, ob der Zweck die Mittel heiligt. Darf ein Geheimdienst Terroristen foltern, um unschuldige Menschen vor Attentaten zu bewahren? Ab wann ist es legitim zu töten? War Stauffenberg ein Held? Und Saddams Henker? Kann es moralisch richtig sein zu töten? Darf man töten, wenn es befohlen wird? Zielt nicht jede militärische Ausbildung auf die Umkehrung des fünften Gebots? Im Zweiten Weltkrieg traf das sicher auf alle Armeen zu: »Du sollst töten!« Die alliierten Soldaten konnten und können sich immerhin darauf berufen, den »richtigen« Feind gehabt zu haben. Das Gefühl, für die rechte Sache zu kämpfen, hatten die GIs im Irak oder in Afghanistan offensichtlich nicht. 2012 starben mehr Soldaten der US-Armee durch Selbstmord als im Kampfeinsatz.
Im Dokumentarfilm »The Fog of War« kommt der US-Stabsoffizier und spätere Außenminister Robert McNamara zu manch später Einsicht. McNamara, der im Zweiten Weltkrieg mathematische Modelle für die möglichst zerstörerische Bombardierung japanischer Städte entwickelte und für den Tod von rund einer Million Zivilisten mitverantwortlich ist, bekannte offen, die USA hätten sich verhalten wie Kriegsverbrecher – und hätten sie den Krieg verloren, hätte man ihnen den Prozess gemacht. Aber, so lautete ein Leitsatz McNamaras: »Um Gutes zu tun, kann es notwendig sein, sich auf das Böse einzulassen.«
Das ist genau die Frage nach dem Zweck und den Mitteln.
Der Schriftsteller Doron Rabinovici erzählt mir bei einer Begegnung, er sei kein Pazifist, sei nie Pazifist gewesen. »Die Sätze ›Nie wieder Krieg‹ und ›Nie wieder Auschwitz‹ widersprechen einander«, sagt er. Das kann ich nur so stehen lassen.
Was wäre gewesen, wenn man die Welt Adolf Hitler und seinen Erben überlassen hätte? Man hätte das millionenfache Morden geduldet. Toleriert. Gesagt: Macht nur weiter, wir finden das vielleicht nicht schön, aber wir lassen euch in Ruhe. Können solcherart Pazifisten zu Mördern werden? Ist es nicht legitim, für die Freiheit zu kämpfen? »Im Alter werden die Huren fromm«, soll Axel Springer einmal gesagt haben. Und die Pazifisten nachdenklich.
1985
Als ich achtzehn war, lagen die Antworten viel klarer vor mir: »Soldaten sind Mörder.« Ich hatte meinen Tucholsky gelesen. Als ich den Einberufungsbefehl zur Stellungskommission des österreichischen Bundesheers bekam, empfand ich das als eine Art Todesurteil. Ich wollte untauglich sein, weshalb ich vor den ärztlichen Tests Unmengen Kaffee trank und wie ein Verrückter rauchte, was auf meine gute Gesamtverfassung keinerlei Auswirkungen hatte. Bei den psychologischen Tests stellte ich mich blöd, das aber mit so wenig Intelligenz, dass mir der Militärpsychiater draufkam.
Ich landete also Monate später vor der Zivildienstprüfungskommission. Um den Wehrersatzdienst zu leisten, musste man damals eine Gewissensprüfung über sich ergehen lassen. Ich hatte gehört, dort würden Fragen gestellt wie: »Sie gehen mit Ihrer Freundin im Wald spazieren. Plötzlich wird Ihre Freundin von einem Gewalttäter attackiert. Was machen Sie?« Diese Fragestellung ist nicht legitim, hörte ich mich antworten, denn private Notwehr kann nicht mit militärischen Befehlsstrukturen verglichen werden und Waffengewalt nicht mit sportlichen Techniken zur Selbstverteidigung, ebenso wenig wie Sie einen Boxkampf mit dem atomaren Overkill vergleichen können. Overkill, das war ein Wort der achtziger Jahre. Es bedeutete, dass sich die Menschheit dank ausgefeilter Waffensysteme unzählige Male selbst vernichten konnte. Das trifft heute immer noch zu, aber Overkill sagt man nicht mehr. Überhaupt kam ich nicht dazu, meine großartigen Antworten zu geben. Der Vorsitzende der Zivildienstprüfungskommission fragte mich, ob ich der Sohn von Gerhard Freund sei. Als ich das bejahte, begann er von meinem Vater zu schwärmen, der habe sich noch was getraut als Fernsehdirektor, denken Sie nur an den »Herrn Karl« vom Qualtinger, überhaupt sei er ein so sympathischer und engagierter und volksnaher Fernsehdirektor gewesen, heute gebe es das ja alles nicht mehr, und erst die Sendungen, die man damals gemacht habe, und unter welchen Umständen diese Sendungen zustande gekommen seien! Der Vorsitzende zitierte Beispiele, ich weiß bis heute nicht, warum er sich so gut auskannte, vielleicht war er einfach ein begeisterter Fernsehzuschauer. Nach einem zehnminütigen Monolog fragte er mich, ob ich noch etwas sagen wolle. Ich überlegte, denn ich hätte gerne mit den Herren diskutiert. Mich beschäftigte die Frage, ob Notwehr gegen äußere Gewalt legitim ist und unter welchen Umständen diese Gegengewalt organisiert werden darf oder muss. Gut, unterbrach der Vorsitzende mein Schweigen, ich glaube, es ist gut gelaufen für Sie, Sie werden schriftlich verständigt. Und wie Sie Ihrem Herrn Vater ähnlich sehen!
So hat mich mein Vater, der Soldat, vor dem Dienst mit der Waffe gerettet.
1944
Samstag, 12. August
15 Uhr Ankunft in Straßburg, Abfahrt nach Zabern, von dort um 23 Uhr Abfahrt nach Metz. Kein Fahrplan mehr, Chaos auf den Bahnlinien, äußerlich normales Leben.
Mein Vater schrieb: Strassburg und aeusserlich, denn die französische oder amerikanische Schreibmaschine, auf der er sein Kriegstagebuch tippte, verfügte weder über ein scharfes S noch über Umlaute. Sonst schrieb er ein fehlerfreies Deutsch, was für einen Kriegsmaturanten nicht selbstverständlich war. Er war das älteste von drei Geschwistern, der einzige Sohn, Mutters Augenstern. Man lebte zwar zu fünft in »Zimmer, Küche, Kabinett« in Wien-Meidling, aber man hielt etwas auf Kultur. Vater Maximilian Freund war Lehrer, bis ihn die Nazis aufgrund dunkler Stellen im Ariernachweis seines Postens enthoben, wonach er sehr schnell starb, keine 54 Jahre alt, an einer Lungenentzündung. Das Penicillin war damals bereits erfunden, aber im Deutschen Reich nicht erhältlich. Mutter Mechtilde lernte mit den Kindern Gedichte, die deutschen Klassiker, besonders Schiller.
Die erste Seite von Vaters Kriegstagebuch
Sonntag, 13., Montag, 14. August
In Metz. Stadt ohne Zivil, Waffenschule, über 50 Kasernen, Bombardement, Bahnhof getroffen, den wir eine Viertelstunde vorher verlassen hatten. Sonst sehr unterhaltlich. Montag abends Abfahrt nach Paris. Wir erwischten den letzten Zug. Leider? Gott sei Dank?
»Unterhaltlich«? Was war »unterhaltlich«?
Das Kriegstagebuch hat ein merkwürdiges Format. Nicht A3, nicht A4. Etwas dazwischen. Das Papier ist dünn wie Zigarettenpapier. Ich wundere mich, dass es nicht längst zu Staub zerfallen ist. Ich kann mich nicht erinnern, wie das Kriegstagebuch in meine Hände gekommen ist. Hat es mir mein Vater seinerzeit zu lesen gegeben? Möglich. Habe ich es in irgendeiner Lade in meinem Elternhaus gefunden, zufällig? Auch möglich. Außer mir kennt niemand in der Familie das Kriegstagebuch. Es ist eine Entdeckung.
Dienstag, 15. August
Abenteuerliche Fahrt. Jagdbomberangriffe, wir liegen mehr neben dem Zug im Gelände als wir fahren. Während der Luftangriffe werden wir mehrmals von Partisanen beschossen, ein Wunder, dass niemand verletzt wird. Nachts wandern wir über eine Bombentrichter besäte Straße, um eine zerstörte Brücke zu umgehen. Der Weg ist so schmal und halsbrecherisch, dass die Herren Offiziere ihr Gepäck zurücklassen müssen. Drüben wartet ein leerer Zug auf uns und den Rest der Nacht verbringen wir zu dritt in einem Abteil erster Klasse und schlafen durch bis Paris. Die Zeichen des Krieges, die wir während der ganzen Fahrt beobachten konnten, nehmen hier wieder ab.
Wovon die einfachen Wehrmachtssoldaten nichts wussten: Am selben Tag, dem 15. August 1944, trat die Pariser Polizei in den Streik. Die Polizisten weigerten sich, die Ordnung für die deutsche Besatzungsmacht aufrechtzuerhalten. Die alliierten Truppen, die am 6. Juni 1944 in der Normandie gelandet waren, standen vor den Toren der Stadt.
Am selben 15. August – den Hitler als »schlimmsten Tag seines Lebens« bezeichnete – landeten die Alliierten in Südfrankreich. Das besetzte Frankreich war für die Nazis so gut wie verloren. Die Widerstandskämpfer in Paris bewaffneten sich und kamen aus ihren Verstecken. In der Stadt herrschte Chaos, und mitten hinein fuhr, schlafend, mein Vater.
1983
Meine Mutter macht die besten Wiener Schnitzel der Welt. Sie sind eher untypisch, das Fleisch dick geschnitten und nicht geklopft, die Panier fest angedrückt, ohne Luftblasen und Wölbungen, in Schweineschmalz nicht golden, sondern dunkelbraun herausgebacken. So etwas prägt.
Nach den sonntäglichen Wiener Schnitzeln fuhren wir gelegentlich zum Hietzinger Friedhof, um das Grab meines Vaters zu besuchen. Ich war ein Halbwüchsiger von vielleicht fünfzehn oder sechzehn Jahren. Rebellisch pubertiert habe ich nie. Nach dem Tod meines Vaters nahm ich seinen Platz bei Tisch ein, was meine Mutter seltsamerweise zuließ. Während des Frühstücks vor der Schule las ich die »Süddeutsche Zeitung« oder hörte eine Symphonie von Beethoven, Karajan und die Berliner Philharmoniker. Ich trank Tee mit Milch, wie es mein Vater getan hatte, und in die Schule ging ich wie ins Büro.
Bei den Mittagessen am Sonntag war stets meine Großmutter anwesend, die Mutter meiner Mutter, Mummy genannt. Sie war damals schon über achtzig Jahre alt, bewohnte ein Haus in Salmannsdorf, dem Villenviertel eines Wiener Nobelbezirks. Das geografische, politische und soziale Gegenteil von Meidling, wo mein Vater aufgewachsen war. Mummy schminkte sich jeden Tag und legte die große Garderobe an, auch wenn sie nur den Briefträger sah. »Man darf sich niemals gehenlassen«, so lautete ihr ehernes Lebensmotto, und ich musste oft daran denken, als ihr Geist sie später im Stich ließ und sie gezwungen war, sich gehenzulassen.
Jedes Mal, wenn wir zum Grab meines Vaters gingen, schnitzelgesättigt, blieb meine Großmutter am Weg vor einer Marmorgruft stehen, um ein Gebet zu sprechen. Auf dem Grabstein stand: »Bundeskanzler Dr. Engelbert Dollfuß geb. 1892 gest. 1934«.
Erst als unser Geschichtsunterricht allmählich die Habsburger und Napoleon hinter sich zu lassen begann, lernte ich, dass es sich um den Anführer des Austrofaschismus handelte, jenen Mann, der die Demokratie in Österreich ausgeschaltet und 1934 das Bundesheer gegen die Sozialdemokraten mobilisiert hatte. Und der im selben Jahr von einem Nazi erschossen worden war. Eines Tages fragte ich meine Großmutter – die Scheu, solche Fragen zu stellen, überspringt wie viele Konflikte und Ängste eine Generation –, warum sie am Grab eines Mannes betete, der einen Bürgerkrieg verschuldet hatte. Der auf Arbeiter und Sozialisten hatte schießen lassen.
»Herzi-Bub« (das war ich), erklärte meine Großmutter ohne zu zögern, »das verstehst du noch nicht.« Heute, fast dreißig Jahre später, verstehe ich es immer noch nicht. Aber ich habe in der Zwischenzeit erfahren, dass Engelbert Dollfuß der Trauzeuge meiner Großeltern war. Hildegard, geborene Klos, und Dr. Leo Müller, Agrarökonom. Dieser Großvater entging dem Dienst in der Wehrmacht, weil er als Saatgutspezialist unabkömmlich gestellt wurde.
Engelbert Dollfuß (vorne), Leo Müller (Mitte rechts, ohne Kopfbedeckung)
Die Mappe mit seinen persönlichen Dokumenten, die vor mir auf dem Schreibtisch liegt, ist in Samt eingebunden, auf den mit Goldfaden die Initialen L.M. gestickt wurden, wahrscheinlich von meiner Großmutter, die als junge Frau ausgezeichnet zeichnen konnte und der Familie Handarbeiten in künstlerischer Qualität hinterließ.
Als ich die Mappe aufschlage, sehe ich als Erstes den »Ahnenpass«, herausgegeben vom Verlag für Standesamtswesen, Berlin. Darin, in sauberer Schrift mit schwarzer Tinte aufgelistet, die Vorfahren bis ins siebte und sogar achte Glied. Gastwirt aus Böhmen, Fleischhauer aus Mähren, Bauerntochter aus Niederösterreich. Nicht zu vergessen die in unserer Familie legendäre Anna Sölß, Postmeisterstochter aus Hainburg an der Donau, deren Schönheit den durchreisenden Kaiser Franz Joseph überaus entzückt haben soll. Alle die Geburts- und Sterbe- und Taufdaten mussten bei Pfarren oder Gemeindeämtern nachgefragt werden, oft in anderen Ländern, die einst zur Habsburgermonarchie gehört hatten. Eine langwierige und – wie ich mir vorstelle – langweilige Arbeit, zu der alle Bewohner des Dritten Reichs verpflichtet wurden. Auch eine Art von Beschäftigungspolitik.
1939
Immerhin, nach den Ahnen zu forschen, das bedeutete wenigstens Hoffnung. Die Juden brauchten damit gar nicht erst anzufangen.
Dr. Leo Müller, so stellte sich bei den Nachforschungen heraus, konnte sich als Arier bezeichnen. Als Arier und Agrarier. Als Letzterer war er bei der niederösterreichischen Landwirtschaftskammer als Tierzuchtdirektor angestellt. Allerdings nur bis 23. März 1939. Ein Jahr nach dem »Anschluss« Österreichs an das Großdeutsche Reich bekam er Post: »An Herrn Dr. Ing. Leo Müller, früher n.ö. Landw. Kammer, jetzt Reichsnährstand, Wien VIII, Lederergasse 18. Auf Grund der Verordnung zur Neuordnung des österreichischen Berufsbeamtentums vom 31. Mai 1938 werden Sie mit dem Ende des Monats März 1939 mit drei Viertel des Ruhegenusses in den Ruhestand versetzt. Ein Rechtsmittel gegen diese Entscheidung steht Ihnen nicht zu. Gez.: Seyß-Inquart. Für den Reichsstatthalter: SS-Untersturmführer …« Unterschrift unleserlich.
Da saß er nun, 38 Jahre alt, in Zwangsruhestand geschickt, mit einer Rente, die zum Ernähren seiner Frau und seiner beiden Töchter nicht ansatzweise ausreichte. Meine Mutter war damals zwei, ihre Schwester ein Jahr alt.
»Tragen Sie es mit Fassung, Dr. Müller«, soll ein Kollege, ein überzeugter Nationalsozialist, zu ihm gesagt haben. Derselbe wollte nach dem Krieg einen Job von ihm haben, erzählt meine Mutter. Er hat ihn nicht bekommen.
1936
Wie war Leo Müller auf die schwarze Liste der Nazis gekommen? Auch dazu finde ich ein Dokument in der schönen Samtmappe meines Großvaters. Es ist ein Brief von der Landesführung der Niederösterreichischen Sturmscharen. Diese waren eine Teilorganisation der Ostmärkischen Sturmscharen, die mit dem Bauernbund zusammenarbeiteten. Sie waren 1930 von Kurt Schuschnigg, der seit 1934 als Nachfolger Dollfuß’ Österreich diktatorisch regierte, gegründet worden, um als katholische Erneuerungs- und Schutzbewegung ein Bollwerk einerseits gegen Sozialisten, andererseits gegen Nationalsozialisten zu bilden. Chef der NÖ Sturmscharen war kein Geringerer als Bauernbunddirektor Leopold Figl, nach dem Krieg Bundeskanzler und Außenminister (»Österreich ist frei!«).
Im Oktober 1936 wurden alle Wehrverbände der Ersten Republik aufgelöst. Leo Müller bekam ein Dankesschreiben: »Lieber Herr Kamerad! Fünf Jahre Sturmscharbewegung liegt [sic!] hinter uns. Ein schöner Prozentsatz unseres Programmes ist im neuen Österreich durchgeführt worden. Der Führer [gemeint ist Schuschnigg, Anm. R.F.] befahl die Auflösung, wir folgten selbstverständlich bedingungslos. Ich nehme die Gelegenheit wahr, um Dir, verehrter Kamerad, für Deine treue und selbstlose Mitarbeit in der Landesführung herzlichen und aufrichtigen Dank zu sagen. Ich bin überzeugt, dass wir deshalb auch in der Zukunft in Dollfuß-Treue unsere Pflicht im Vaterlande erfüllen werden. Wenn wir auch als Sturmschärler nicht mehr beieinander sein können, so darf ich Dir, lieber Kamerad, versichern, dass ich Dir auch in Zukunft wirklicher Kamerad im Geiste Dollfuß’, ein wirklicher Freund bleiben werde. Mit nochmaligem Danke und ein aufrichtiges ›Treue‹ für alle Zukunft, Dein Figl.«
Die österreichischen Nationalisten »im Geiste« von Dollfuß waren den Nazis ebenso suspekt wie Kommunisten oder Sozialisten. Vielleicht sogar suspekter, weil sie sich bis 1938 an der Macht befanden. Leopold Figl gehörte zu den ersten Verhafteten nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Von 1938 bis 1943 war er im KZ Dachau inhaftiert, nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler im Juli 1944 wurde er unter dem Verdacht des Hochverrats erneut verhaftet.
Im Juni 1937, ein knappes Jahr vor seiner Verschleppung ins Konzentrationslager, fungierte Leopold Figl als Taufpate. Das zu taufende Mädchen hieß Gertraud Müller. Meine Mutter.
1938
Meine Großmutter erzählte mir einmal die Geschichte, ihr Mann sei von Bundeskanzler Schuschnigg auserwählt worden, im März 1938 nach Berlin zu fahren, um in letzten geheimen Verhandlungen mit Hitler den »Anschluss« Österreichs an das Deutsche Reich zu verhindern. Leo Müller kam in Berlin an. Bereits am Bahnhof warteten SS-Männer auf ihn. Sie behandelten ihn höflich. Die nächsten drei Tage wurde er rund um die Uhr von Gestapo-Männern überwacht. Zum »Führer« ließ man ihn nicht vor. Noch ein halbes Jahrhundert später konnte ich die Angst in der Stimme von Mummy hören, die Angst, ihr Leo könnte einfach in Berlin verschwinden. Es ist aber wohl nur eine Ironie der Geschichte, dass das österreichische Außenamt mit den Codeworten »Leo reisefertig« über den bevorstehenden Einmarsch deutscher Truppen informiert wurde.
Später haben die Nazis die landwirtschaftlichen Kenntnisse meines Großvaters gebraucht. Und noch später, im Krieg, sollte sich zeigen, dass Leo Müller, der Kamerad im Geiste von Dollfuß, ein Mensch mit großem Herzen und viel Mut war.
Leider habe ich nur eine einzige persönliche Erinnerung an »Opi«, wie wir ihn nannten. Er starb 1971. Opi kommt im Bademantel aus seinem Schlafzimmer und lächelt mir freundlich zu. Das ist alles, dieses Bild: ein »Herr«, wie man früher gesagt hat, mit gütigen Augen und einem gepflegten Schnurrbart. In den Erzählungen über ihn erscheint er als äußerlich ruhig, schlagfertig und witzig. Zu Hause überließ er das Regiment seiner Frau, die über ebenso viel Autorität verfügte wie er. Er rauchte bis an sein Ende (durch Lungenkrebs) täglich achtzig filterlose Zigaretten der Marke Austria 3, war dem Grünen Veltliner zugetan und gerne bis spät in die Nacht unterwegs. Später, lange nach dem Krieg, traf der Lebemann immer wieder seine auch gerade erst heimgekehrten Töchter im Morgengrauen in der Küche zu einem kleinen Imbiss, von dem die Mutter nichts bemerken durfte, weil sie für so viel Unvernunft nicht viel übrighatte. Egal, wie spät es wurde, pünktlich um sieben Uhr dreißig verließ Dr. Müller am nächsten Tag das Haus, natürlich tadellos rasiert, im Maßanzug, mit Krawatte und Hut. »Ui, jetzt müssen wir schnell schlafen«, pflegte er seinen Töchtern zuzuraunen, wenn absehbar war, dass höchstens ein paar Stunden für die Nachtruhe blieben.
Meinen anderen Großvater habe ich gar nicht gekannt. Der Lehrer aus dem Arbeiterbezirk Meidling wurde wegen der Lücken in seinem Ariernachweis und politischer Unzuverlässigkeit nach dem »Anschluss« seines Postens enthoben. Anti-Nazis waren beide. Das verband und verbindet aber in Österreich nicht. Als meine Mutter, die höhere Tochter aus dem Nobelbezirk, sich anschickte, den roten Fernsehdirektor Gerhard Freund zu heiraten, wurde sie im Herzen der Wiener Innenstadt auf offener Straße von einem Parteifreund ihres Vaters geohrfeigt. Noch in den sechziger Jahren war der Hass von 1934 nicht überwunden.
Mein Vater war im Bürgerkriegsjahr 1934 neun Jahre alt. Im »Anschluss«-Jahr 1938 ein pubertierender Junge, dem die Nazis gelegen kamen. Ein Homme à Femmes, schon in frühen Jahren, wie man auf einem Foto sieht, auf dem der schlanke, große Jüngling in der Uniform des Reichsarbeitsdienstes mit einer brünetten Schönheit posiert.
Mein Vater hat seine Einstellung mir gegenüber nicht beschönigt. Er war, freilich als Kind, der einzige Nazi in der Familie. Nicht im politischen Sinn, denn weder die Politik noch die Rassenideologie interessierten ihn. Doch die Pflichtmitgliedschaft bei der Hitlerjugend zwang seine Eltern dazu, ihn aus den beengten Verhältnissen zu Hause entkommen zu lassen.
»Er ist gerne zur HJ gegangen, weil er da seine Freiheit hatte«, erzählt meine Tante Gudrun, die um neun Jahre jüngere Schwester meines Vaters. »Ich war schon als Kind kein Nazi«, sagt sie. »Ich habe das ganze Singen beim Bund Deutscher Mädchen gehasst und die BDM-Nachmittage regelmäßig geschwänzt. Das war ein Problem für meine Familie, denn die Jugendführerin wohnte in unserem Haus, und meine Mutter musste Ausreden erfinden und erzählte ihr, ich wäre krank.«
Da stellte Tante Gudrun zweifellos eine Ausnahme dar. Die meisten Zeitzeugen waren – wie mein Vater – begeisterte Hitlerjungen. Da gab es Abenteuer, Sport, Gemeinschaft, Lagerfeuer. Und alles ohne Eltern! Dazu schwungvolle Lieder mit einprägsamen Refrains: »Heute gehört uns Deutschland, und morgen die ganze Welt.«
Fragte man heute Zehnjährige, ob sie eine tolle Uniform, Club-Abzeichen und einen Dolch mit Gravur wollen, fänden sie das vielleicht sogar cooler als Computerspielen. Dazu die Mitgliedschaft in einer Art Geheimbund, bei dem alle zusammenhalten. Spiele im Freien, mit Anschleichen, Kampfübungen, Schießen mit Kleinkalibergewehren!
Noch während des Kriegs hat mein Vater radikal umgedacht. Die Ablehnung alles Militärischen habe ich von ihm gelernt. Ich erinnere mich an unsere Ausfahrten zum Angeln. Ich saß am Beifahrersitz des weißen Mercedes. Wir hörten Lieder von Franz Schubert oder Hugo Wolf, und manchmal rezitierte mein Vater auch Gedichte. Er liebte den Dichter Matthias Claudius, und es klingt mir noch heute in den Ohren, wie er dessen »Kriegslied« deklamierte:
»’s ist Krieg! ’s ist Krieg! O Gottes Engel wehre,
Und rede du darein!
’s ist leider Krieg – und ich begehre
Nicht schuld daran zu sein!
Was sollt ich machen, wenn im Schlaf mit Grämen
Und blutig, bleich und blass,
Die Geister der Erschlagnen zu mir kämen,
Und vor mir weinten, was?
Wenn wackre Männer, die sich Ehre suchten,
Verstümmelt und halb tot
Im Staub sich vor mir wälzten und mir fluchten
In ihrer Todesnot?
Wenn tausend Väter, Mütter, Bräute,
So glücklich vor dem Krieg,
Nun alle elend, alle arme Leute,
Wehklagten über mich?
Wenn Hunger, böse Seuch’ und ihre Nöten
Freund, Freund und Feind ins Grab
Versammleten, und mir zu Ehren krähten
Von einer Leich herab?
Was hülf mir Kron’ und Land und Gold und Ehre?
Die könnten mich nicht freun!
’s ist leider Krieg – und ich begehre