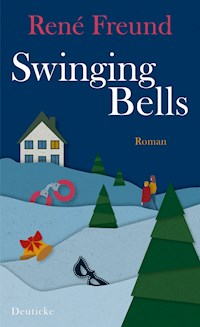Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine verschwundene Pflegerin, ein Dorf, ein Geheimnis: der neue Roman von René Freund über einen Philosophieprofessor und ein Dorf voller Rätsel In Stein am Gebirge scheinen alle alles zu wissen. Und eisern zu schweigen. So kommt es Quintus Erlach zumindest vor. Der Philosophieprofessor will den Sommer im Haus seiner Kindheit verbringen, da weder seine Frau noch seine Tochter derzeit mit ihm zu tun haben wollen. Gerade fürs Hundesitting ist er noch gut genug, und beim Spazierengehen lernt er Evelina kennen. Sie kommt aus der Slowakei und pflegt den alten Zillner, nachdem dessen frühere Pflegerin spurlos verschwunden ist. Evelina und Quintus wollen herausfinden, was mit ihr passiert ist. Aber haben sie sich mit den Zillners, denen das ganze Dorf gehört, womöglich einen zu mächtigen Gegner ausgesucht? Witzig, geistreich und fast schon ein Krimi.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
In Stein am Gebirge scheinen alle alles zu wissen. Und eisern zu schweigen. So kommt es Quintus Erlach zumindest vor. Der Philosophieprofessor will den Sommer im Haus seiner Kindheit verbringen, da weder seine Frau noch seine Tochter derzeit mit ihm zu tun haben wollen. Gerade fürs Hundesitting ist er noch gut genug, und beim Spazierengehen lernt er Evelina kennen. Sie kommt aus der Slowakei und pflegt den alten Zillner, nachdem dessen frühere Pflegerin spurlos verschwunden ist. Evelina und Quintus wollen herausfinden, was mit ihr passiert ist. Aber haben sie sich mit den Zillners, denen das ganze Dorf gehört, womöglich einen zu mächtigen Gegner ausgesucht? Witzig, geistreich und fast schon ein Krimi.
René Freund
Wilde Jagd
Roman
Paul Zsolnay Verlag
Seht ihr den Mond dort stehen? —
Er ist nur halb zu sehen,
Und ist doch rund und schön!
So sind wohl manche Sachen,
Die wir getrost belachen,
Weil unsre Augen sie nicht sehn.
Matthias Claudius
Prolog
Mein Name ist Quintus Erlach. Ich bin dreiundfünfzig Jahre alt. Meine Frau hat mich verlassen, meine Tochter redet nicht mehr mit mir. Ich lebe im verfallenden Haus meiner verstorbenen Eltern, und mein Hund, der gar nicht mein Hund ist, schnarcht.
So etwas oder so etwas Ähnliches hätte ich in der Vorstellungsrunde gesagt. Allerdings gibt es keine Vorstellungsrunde, denn hier bin nur ich. Vor mir stehen eine Tasse Tee und ein Laptop, zu meinen Füßen liegt ein mittelgroßer Mischlingshund.
Meine Sehnsucht nach Erkenntnis zwingt mich dazu, die Geschehnisse der vergangenen zwölf Tage aufzuzeichnen. Vielleicht hilft mir das dabei, mehr Klarheit zu erlangen, denn von meinem einst so gefestigten Weltbild ist nicht viel übrig geblieben.
Das meiste habe ich selbst erlebt, weshalb ich so unmittelbar, nahe und objektiv wie möglich davon berichten werde, auch wenn sich bereits mein Deutschlehrer auf dem Stiftsgymnasium über meine gelegentlich überbordende Phantasie lustig gemacht hat. Manches habe ich erst später erfahren, gemutmaßt, rekonstruiert, aber auch das soll in diesen Bericht einfließen.
Mittwoch, 4. Juli 2018
1
Bei unserer ersten Begegnung hatte ich nur einen Gedanken: Das muss eine Verrückte sein. Sie steht zwischen Farnen auf der Lichtung, breitbeinig, wie mit dem Boden verwurzelt, aber gleichzeitig strahlt sie etwas Schwereloses aus. Ihr kurzes, kastanienbraunes Haar bewegt sich wie von Geisterhand, mal eine Locke hier, mal eine da, obwohl es eigentlich windstill ist.
Die Frau lächelt und starrt gleichzeitig vor sich hin. Sie hält ein Stofftier in der Hand, dessen Art ich nicht bestimmen kann. Ist das ein Bär? Ein Hund? Ein Hase? Ich bin nicht in der Lage, ihr Alter zu schätzen. Die Frau kann ebenso Ende dreißig sein wie Anfang zwanzig. Weggetreten wirkt sie jedenfalls, ja, ver-rückt. Wobei ich zugeben muss, dass weggetreten oder verrückt keine Wörter sind, die ein Wissenschaftler verwenden sollte. Aber es sind die einzigen Wörter, die mir dazu einfallen.
Mein Weg führt direkt an ihr vorbei. Ich zögere. Bleibe stehen. Zu merkwürdig erscheint diese Szenerie, fast unheimlich. Hinter mir knackst und raschelt es im Dickicht. Ein Schauer läuft mir über den Rücken. Ich versuche zu schmunzeln. Zum Glück bin ich ein rationaler Mensch. Ich weiß, was Realität ist und was Phantasie, ich weiß, was Einbildung ist, was Traum und was Wirklichkeit, ich weiß, was handfest und beweisbar ist und was ein Hirngespinst. Ich kann untersuchen, ich kann analysieren, ich kann auseinanderhalten. Ich weiß, wo die Trennlinien verlaufen. Ich lasse mich nicht in die Irre führen. Schon gar nicht von einem Rascheln im Gebüsch, von wehenden Haaren, einem entrückten Blick und einem undefinierbaren Stofftier.
Als ich mich, dem Waldweg folgend, nähere, öffnet sich eine kleine Lücke in der Wolkendecke, und ein Sonnenstrahl fällt direkt auf diese merkwürdige menschliche Erscheinung. Es sieht aus wie auf einem dieser barocken Heiligengemälde, dunkler Himmel und dann: dieser eine Lichtstrahl, der die Begnadete erleuchtet. Als ich an ihr vorbeigehen will, nicke ich ihr so freundlich und unauffällig wie möglich zu, woraufhin sie die Arme in die Höhe reißt, als wollte sie die Sonne begrüßen. Ich zucke zusammen, und ein noch heftigerer Schauer läuft mir den Rücken hinunter. Ich ärgere mich. Ich bin Wissenschaftler. Ich fürchte mich nicht.
»Ein Engel«, haucht die Frau und sieht mich an. Sie hat fast runde und unglaublich helle Augen, deren Farbe schwer zu definieren ist, zwischen Türkis, Grau, Blau und Grün.
»Wie?«, frage ich und tue so, als würde ich mein Ohr näher halten, nicht ohne einen gewissen Sicherheitsabstand zu wahren. »Was haben Sie gesagt?«
»Ein Engel«, wiederholt sie mit einer Stimme, die keinerlei Emotion ausdrückt. »Und dann einfach weggeworfen.«
»Machtnix!«, rufe ich aus.
Die Frau lässt die Arme sinken und sieht mich an.
»Ein wertloses Ding«, sagt sie kopfschüttelnd.
»Machtnix!«, schreie ich. »Machtnix!«
Ich gebe zu, dass nun ich es bin, der möglicherweise wie ein Verrückter wirkt. Die junge Frau sieht mich verstört an. Die Spannung in ihrem Körper scheint plötzlich verschwunden. Sie lässt die Hand, in der sie das Stofftier hält, sinken. Ohren hängen herab. Ein Hase, denke ich. Das muss ein Hase sein. Ich räuspere mich und erkläre: »Machtnix, das ist mein … Hund.«
Da kommt der Köter auch schon gelaufen, doch statt meine Nähe zu suchen, begrüßt er die junge Frau mit einer ungewohnten Überschwänglichkeit. Sie geht in die Knie, um Machtnix zu streicheln und zu liebkosen. Er schleckt ihr ungestüm über das Gesicht. Sie lacht aus vollem Hals. Jetzt scheint sie ganz normal.
»So ein Süßer«, sagt sie.
»Er gehört eigentlich Michaela«, antworte ich. »Meiner Tochter.«
»Sie mögen keine Hunde, Herr Professor?«, fragt die Frau. Hat sie einen Akzent? Eine weiche Melodie in der Sprache? Ich kann es ebenso wenig bestimmen wie ihre Augenfarbe.
»Woher wissen Sie das?«, frage ich.
»Das merkt man sofort«, antwortet sie und richtet sich auf. »Deshalb kommt er zu mir und nicht zu Ihnen. Machtnix.« Sie lacht.
»Schon«, sage ich, »aber: Woher wissen Sie … Warum sagen Sie Professor zu mir?«
»Sie sind doch der Professor?«
»Ja, aber …«
»Brauchen Sie Hilfe?«, fragt die junge Frau. Ich sehe sie verdutzt an. Wieso um alles in der Welt sollte ich die Hilfe einer Verrückten brauchen?
»Ich liebe Hunde«, sagt die Frau. »Ich habe zu Hause auch einen. Er fehlt mir so. Wenn Sie wollen, kann ich in meiner Mittagspause spazieren gehen. Mit Machtnix.«
Wieder geht sie in die Knie, um den Hund zu liebkosen.
»Mir tut die Bewegung gut«, sage ich.
»Sind Sie sicher?«, fragt sie.
»Warum nicht?«, frage ich zurück.
»Sie haben Schmerzen«, sagt die Frau.
Kann man sehen, dass ich hinke? Eigentlich hat das noch niemand bemerkt. Ich will weiter. Diese unheimliche Erscheinung abschütteln, mich beuteln wie ein Hund, wenn er Stress loswerden muss.
»Wir müssen uns erst aneinander gewöhnen«, sage ich. »Ich meine, Machtnix und ich.«
»Wir beide auch.« Die junge Frau zeigt auf mich und nickt mir aufmunternd zu. Sie wirkt jetzt gar nicht mehr zerbrechlich, sondern sehr bestimmt. »Und wir werden uns aneinander gewöhnen. Sie werden mir helfen, Professor. Ich weiß es. Sie haben ein gutes Herz.«
Besonders an der letzten Bemerkung habe ich begründete Zweifel, und langsam wird mir diese Begegnung zu schräg.
»Machtnix!«, rufe ich. »Komm, wir gehen!«
Die Frau streichelt noch einmal über den Kopf des Hundes und sieht mir ebenso selbstbewusst wie eindringlich in die Augen. Ich nicke ihr kurz zu und gehe los.
Sie haucht mir einen Satz nach. »Wir sehen uns wieder, Professor.«
2
Ich folge dem Weg oder vielmehr dem vorauslaufenden Hund, bis ich den Schwarzenbach erreiche. Der Schwarzenbach war das Paradies meiner Kindheit, und es ist noch heute so, dass ich an sein türkis schimmerndes Wasser, an die tiefen Gumpen, die überspülten, mit Moos bewachsenen Felsen und die kleinen Wasserfälle denke, wenn ich mir etwas Schönes vorstellen will. Manchmal zaubere ich mir in Gedanken auch den Schwarzensee herbei, der unbewegt inmitten des Talkessels zwischen hoch aufragenden Felsen und uralten Wäldern liegt. Wandert man den Pyramidenstein an der Ostseite des Sees hinauf, kann man auf der einen Seite ins Bayerische sehen, auf der anderen Seite die Silhouette der Stadt Salzburg. Doch der See war als Kind für mich nicht erreichbar, liegt er doch gute zehn Kilometer südlich im Talschluss. Ich spiele mein Kindheitsspiel: Ich muss mindestens eine der rotgepunkteten Forellen sehen, die im Kehrwasser auf ihre spärliche Beute lauern, bevor ich weitergehen darf.
Obwohl die Schmerzen in meinem Fuß mich in der Wirklichkeit verankern sollten, habe ich den Eindruck, noch nicht wirklich wach zu sein. Und das, obwohl Mittag längst vorbei ist. Ich schwebe, wie in Watte gepackt. Wie ein Fremder in meinem Leben. Ein Besucher, der die anderen Teilnehmer dieser merkwürdigen Veranstaltung aus innerer Ferne bestaunt. Ein Kinogeher, der sich im Vorführsaal geirrt hat und nun verwundert einen Film sieht, den er sich eigentlich nicht anschauen wollte.
Seit ich mich im Haus meiner Eltern befinde, verfolgen mich nachts merkwürdige Träume. Verfaultes Wasser und verschimmelte, träge, sterbende Riesenfische kommen darin vor. Ich weiß in der Früh nicht mehr, worum es sich handelt. Es sind eher Bilder, die sich mir zeigen, die aber verschwinden, sobald ich die Augen öffne. Warum träume ich von trägen, verschimmelnden Fischen? Oder bin es gar nicht ich, der träumt? »Mir hat geträumt«: Mit dieser altmodischen Redewendung hat mein Vater einst seine Traumerzählungen begonnen, und das scheint mir viel zutreffender. Der Mensch träumt nicht, er wird geträumt.
Der Hund watet lautstark durch das Wasser, taucht unter, trinkt. Da ist sie, meine Forelle: Machtnix hat sie aufgescheucht, eine kleine, flinke, rotgepunktete und höchst vitale Bachforelle. Alles ist gut. Natürlich stellt sich der Köter neben mich, als er sich beutelt, und ich seufze. Er sieht mich fröhlich an. »Musste das sein?«, frage ich. Er senkt den Kopf und blickt nach oben. Ich glaube, dass er das Weiße seiner Kulleraugen sehr gezielt einsetzt, weil er sich mit dem Aussehen eines Kuscheltiers für unwiderstehlich hält. Meine Frau sagt immer, er sei bei der Verteilung der Inkarnationen nur ganz knapp am Menschen vorbeigeschrammt, beim nächsten Mal würde es sicher klappen. Ich weiß allerdings nicht, welche Vorteile der Hund daraus ziehen sollte, als Mensch wiederzukehren.
Als wir zu Hause ankommen, beginnt es zu regnen. Ich finde, es ist eine Art Herbstregen. Gut, wir schreiben Anfang Juli, und ich habe Lou immer damit genervt, dass ich bereits im Mai erste Anzeichen für den kommenden Herbst, sprich für den Niedergang, entdeckt habe. Die Rosen an der Schuppenwand sind teilweise schon verblüht. Der Garten sieht, das muss ich zugeben, nicht nur verwildert, sondern sogar ein klein wenig verwahrlost aus. Aber ich bin ja erst vor drei Tagen, zu Beginn der Sommerferien, nach Stein am Gebirge gekommen, und im Juli braucht man gar nicht mehr zu beginnen, die Natur zähmen zu wollen. Noch dazu allein. Immerhin haben die Blumen und Blüten und Moose und Gräser und Flechten den Freiraum gehabt, sich ungehindert auszubreiten, und mir reicht der kleine Steinplatten-Pfad, der vom chronisch klemmenden Gartentor zu dem zweistöckigen Forsthaus aus dem 19. Jahrhundert führt.
Mein Elternhaus. Mein Kindheitshaus. Mein Lebenshaus.
Meine Füße kochen. Auf der Veranda lasse ich mich in einen der Korbstühle fallen und ziehe mir die Wanderschuhe aus. Die linke Socke lässt sich kaum ausziehen, sie haftet an der Fußsohle. Aber ich hinke doch nicht! So schlimm ist es nicht! Nun ja. Als ich die Socke endlich vom Fuß bekomme, kleben verkrustete Wollfasern an den Wunden. Machtnix hebt den Kopf und schnüffelt besorgt.
»Schau nicht so blöd«, sage ich. »Das ist gar nichts.«
Ich habe Hunger. Oder vielleicht eher Durst. Das Schöne an diesen kleinen Flaschen der Privatbrauerei: Eine ist keine. Und eine zweite ist immer noch eine kleine. Die leeren Flaschen versuche ich in den Karton auf der Veranda zu schlichten, der allerdings dermaßen überquillt, dass es höchste Geschicklichkeit erfordert, noch zwei Exemplare darauf zu stapeln. Es gelingt. Ich hinke zum Sofa in der Zirbenholzstube. Eine Staubwolke hüllt mich ein, als ich darauf niedersinke.
Ich wache davon auf, dass Machtnix über meine Fußsohle schleckt.
»Hey, was soll das?« Ich ziehe den Fuß ein. »Schon was von Wundhygiene gehört?« Er hält den Kopf schief, winselt leise und zeigt mir sein Augenweiß. Als ich aufstehe, um zur Toilette unter der Holztreppe zu gehen, merke ich, dass ich jetzt tatsächlich hinke. Auf dem Klo sitzend sehe ich, dass der linke Fuß unzweifelhaft geschwollen ist. Außerdem fühlt er sich heiß an.
Ich habe jetzt wirklich Hunger, oder zumindest einen leeren Magen. Der Weg ins Gasthaus scheint mir aber zu beschwerlich, und noch mehr die Vorstellung, Schuhe anzuziehen. Außerdem ist es zu spät. Am Nachmittag bekomme ich dort allenfalls Gulaschsuppe aus der Dose. Den Inhalt einer Dose kann ich mir dank der Vorräte meiner Mutter, die sich schon Jahrzehnte vor ihrem Tod auf den Dritten Weltkrieg oder sonst einen Untergang vorbereitet hat, selbst wärmen. Ich entscheide mich für Ravioli und dafür, sie wie einst in der Studentenzeit beim Heimkommen nach durchzechten Nächten kalt zu verspeisen. Machtnix ist begeistert, als ich die Dose aus dem Schrank hole. Er springt im Stand, wedelt, gibt kleine Singgeräusche von sich und niest. Das ist wohl das wertvollste Kunststück, das Lou ihm beigebracht hat: Er kann auf Befehl niesen. Nun macht er es auch ohne Befehl, um sich eine Belohnung zu verdienen. Meine Ravioli-Dose sieht aus wie Hundefutter. Als ich sie öffne, riecht sie wie Hundefutter. Nach zwei, drei Bissen kann ich mich des Gedankens nicht erwehren, dass sie wie Hundefutter schmeckt. Ich kontrolliere das Ablaufdatum. Nun ja, das war vor zwölf Jahren, aber Dosen können doch eigentlich nicht schlecht werden.
»Machtnix, niesen!«, rufe ich, und Machtnix simuliert einen Niesanfall ungeahnten Ausmaßes. Er bekommt die restliche Dose. Ich selbst spüle mit einem Bierchen nach und werfe den Computer an. Keine Nachricht von Lou. Ein paar Mails von Studierenden mit überwiegend stupiden Fragen. In meinem linken Fuß beginnt es zu pochen. Machtnix hat alles aufgefressen und stupst mich mit seiner feuchten Schnauze an.
»Ach lass mich doch in Ruhe«, schnauze ich zurück.
Der Hund möchte etwas unternehmen. Im Grunde hat er ja recht, ich sollte etwas unternehmen. Meine Frau ist Ärztin, und ich habe genügend von ihr gelernt, um zu wissen, dass es höchste Zeit ist.
3
»Herr Herwig! Essen ist fertig! Hören Sie mich? Bitte kommen Sie zum Essen!«
Evelina läuft durch die riesige, aber sehr veraltete Küche, in der einst zwei Köchinnen und zahlreiche Dienstmädchen gewerkt haben. Auf der Kochfläche mit den sechs Gasflammen stehen zwei Töpfe und eine Pfanne. Julia hat ihr zwar aufgetragen, sie solle frisches Gemüse und frischen Fisch kochen, aber Evelina hat sich für die fertige Tiefkühlgemüsemischung entschieden. Die ist nämlich auch sehr gut und vitaminreich. Frischen Fisch greift sie nicht gerne an, deshalb hat sie Filetblöcke gewählt, die haben noch am wenigsten mit einem Tier zu tun. Evelina selbst isst gar keine Tiere. Sie kann es nicht. Kaum nimmt sie einen Bissen, sieht sie, wie das Tier getötet wurde, spürt seine Angst, seine Schmerzen. Sieht das Blut fließen. Die Augen brechen. Die Eingeweide heraushängen. Die Angst und das Entsetzen der anderen Tiere in der Schlachtungs-Warteschlange. Wenn man das alles sieht, schmeckt einem kein Fleisch. Bei Fisch fließt weniger Blut. Aber sie spürt sein Gezappel auf dem Deck eines riesigen Schiffs. Das Japsen nach Luft. Die verzweifelte Sehnsucht nach dem Meer, nach seinem Element. Der Erstickungs-Todeskampf dauert oft Stunden, wenn nicht vorher irgendein Rohling mit Netzhandschuhen aus Metall ihn bei lebendigem Leib filetiert.
Evelina hält sich lieber an Gemüse. Außerdem hat sie Naturreis gekocht, der schmeckt ihr. Herwig bevorzugt zwar weißen Reis, aber für die Verdauung von alten Leuten sind Ballaststoffe sehr wichtig. Das hat Evelina allerdings schon gewusst, bevor sie es in Bratislava auf der Pflegeschule gelernt hat. Sie nimmt eines der Silbertabletts, richtet einen Teller an, stellt ein Glas kalten Kräutertee dazu und geht durch das Wohnzimmer. Pardon, es ist der »Salon«, so heißt der Raum bei Julia. Sie spricht es französisch aus, der Salon mit dem offenen Kamin, den Hirsch- und Gams-Trophäen, den Ohrenfauteuils, dem Ledersofa, der Bücherwand, dem Bärenfell und den vier Perserteppichen, die trotz ihrer unterschiedlichen Farben und Muster zusammenpassen. Nach dem Salon kommt das Speisezimmer mit dem Erker, der einen Blick in den Garten eröffnet, pardon, es ist ein Park, so nennt Julia ihn.
»Herr Herwig, wo sind Sie?«, fragt Evelina, während sie das Tablett auf den Tisch stellt und die Stoffserviette aus der Kommode mit den Ebenholz-Intarsien holt. Für jeden Tag eine neue Serviette. H. Z. ist mit rotem Garn in das elfenbeinfarbene Leinen gestickt. »Herr Herwig«, das kann Evelina immer noch schwer aussprechen. Sie findet, es klingt auch nicht besonders gut.
»Herr Zillner? Das Essen wird kalt!«
Evelina geht durch einen langen Flur ins Fernsehzimmer. »Herr Zillner?«
Herwig Zillner sitzt in seinem Rollstuhl vor dem Fernsehgerät und kaut. Ertappt lässt er etwas in der Tasche seiner verschlissenen, übergroßen Wolljacke verschwinden, doch die Packung auf dem Beistelltischchen verrät ihn. Unter der Wolljacke trägt er ein Flanellhemd, darunter Unterwäsche aus Merino, außerdem eine Wollhose, darunter braune Wollstrümpfe und zwei paar dicke Socken.
»Ich habe keinen Hunger.« Herwigs Stimme klingt wie immer dünn und schwach, aber auch ein bisschen verschleimt.
»Das wundert mich nicht, Sie haben eine ganze Packung Mon Chéri gegessen!«
»Es war eine kleine Packung«, sagt Herwig und lächelt verschmitzt. Auf der Pflegeschule hat Evelina gelernt, man solle nie sagen, dass alte Leute wie Kinder werden. Das sei respektlos. Aber es stimmt. Sie werden wie kleine Kinder. Sie schiebt den Rollstuhl durch den Flur ins Speisezimmer und platziert Herrn Zillner vor seinem Teller. Umständlich drapiert der alte Mann die Serviette auf seinem Schoß und beginnt, im Reis herumzustochern.
»Soll ich Ihnen helfen?«, fragt Evelina.
»Wann bekomme ich wieder einmal Blutwurst? Oder Leberwurst? Mit Kraut! Früher habe ich immer normale Sachen gekriegt. Bei der Angelika war es am besten.«
»Aber Angelika ist nicht mehr da.«
Herwig Zillner sieht von seinem Teller auf. »Leider«, sagt er, seufzt und mustert Evelina. »Blonde Frauen können nicht kochen, hat man früher gesagt. Hübsche Frauen können nicht kochen, hat man früher gesagt. Sie war blond und hübsch. Sehr hübsch. Diese langen, blonden Haare! Und kochen konnte sie auch.«
»Wo ist sie jetzt?«, fragt Evelina. »Kommt sie wieder? Viele kommen doch wieder?«
Herr Herwig nickt und schüttelt den Kopf und nickt.
Ich muss das Foto machen, denkt sie. Jeden Tag soll Evelina per WhatsApp Fotos an Julia schicken, und sie versucht, möglichst positive Motive zu wählen: Herwig im Park, ein seltenes Motiv, weil Herwig große Angst davor hat, sich zu verkühlen, und draußen ist es entweder zu heiß, zu kalt oder zu windig; Herwig beim Nickerchen; Herwig beim Zeitunglesen; Herwig beim Telefonieren; Herwig beim Kaffee mit Forstmeister Moser, dem Verwalter; oder eben Herwig beim Essen. »Ein bisschen lächeln bitte.« Herwig lächelt brav, denn er weiß, wenn er unzufrieden wirkt, würde seine Schwiegertochter kommen und nach dem Rechten sehen, und das ist meistens sehr anstrengend, weil Julia eine besondere Gabe hat, innerhalb kürzester Zeit alles durcheinanderzubringen.
Evelina macht das Foto. Wie fast alle Fotos von Herwig sieht auch dieses sehr düster aus, was vor allem daran liegt, dass tagsüber die waldgrün gestrichenen Fensterläden des herrschaftlichen Anwesens halb geschlossen sein müssen, bevor sie nachts ganz geschlossen werden. Die alten Augen vertrügen die Sonne nicht, hat Adrian erklärt, Herwigs einziger Sohn. Anfangs hat sie auch ihm Fotos von seinem Vater geschickt, aber er hat in einer kurzen Nachricht zurückgeschrieben, er beziehungsweise sein Büro wären für das Bezahlen der Rechnungen zuständig, Fotos solle sie bitte ausschließlich an seine Frau schicken. Daran hält sich Evelina natürlich, denn Adrian Zillner ist zwar sehr charmant, aber er kann auch sehr bestimmt sein. Julia schickt manchmal auch Fotos zurück, die sie dann Herwig zeigen soll: Adrian, Julia, die Kinder Charlotte und Philipp auf der Terrasse des Hauses am Starnberger See, oder nur Charlotte und Philipp beim Baden oder beim Segelkurs oder nur Adrian und Julia als schönes Paar.
»Ich habe Bauchweh«, sagt Herwig, »ich kann das nicht aufessen.«
»Essen Sie wenigstens den Fisch«, sagt Evelina.
»Den Fisch kannst du der Katze geben.«
»Frau Julia sagt aber, wir sollen die Katze nicht anfüttern.«
»Aber wir können ja unser kleines Geheimnis haben, Frau Evelina, nicht wahr?« Herwig zwinkert ihr verschmitzt zu.
»Haben Sie mit Angelika auch kleine Geheimnisse gehabt?«, fragt Evelina. Herwig schiebt den Teller von sich. »Ilona, Darina, Sorana, Jitka … Ich kann mich doch nicht an alle erinnern. Die Nachrichten beginnen gleich.«
»Angelika war lange hier.«
»Und dann hat sie mich im Stich gelassen. Von heute auf morgen im Stich gelassen. Bringen Sie mich ins Fernsehzimmer, bitte.«
Evelina schiebt Herwigs Rollstuhl durch den Flur in das Zimmer und schaltet das Fernsehgerät ein. Während Herwig, meist kopfschüttelnd und missbilligend murmelnd, Nachrichten schaut, wird sie das Tablett abräumen, in der Küche ein paar Bissen Gemüsereis essen, abwaschen, die Fensterläden schließen, den Fisch für die Katze hinauslegen und alles für die Nachtruhe vorbereiten. Sie ist erst seit zwei Wochen hier, sie darf nicht zu viel fragen, das spürt sie. Schön langsam Vertrauen fassen. Die Sache umkreisen. Evelina geht in ihre Schlafkammer, Dienstbotenzimmer sagt Herwig dazu. Sie schlägt die Bettdecke zurück und holt Bruno hervor. »Du wirst mir helfen, nicht wahr, zlatko moje?« Er hilft ihr schon lange, ihr kleiner Schatz, aber sie hat gelernt, dass sie ihn nicht drängen darf. Sie legt den inzwischen ziemlich ramponiert aussehenden Stoffhund mit den Schlappohren auf den Kopfpolster. Vielleicht würde sie ja später auch Nachrichten sehen. Aber andere. Die seltsamen Nachrichten, die sie empfängt, kann sie nicht nach Belieben an- oder abschalten.
4
Ich scheue den Weg zum »Doktor«, wie er hier im Ort genannt wird, nicht nur wegen meines allgemeinen Misstrauens gegen Ärzte, das mir vor allem meine Frau, die Ärztin, eingeimpft hat, sondern auch, weil ich keine Lust habe, meine ehemaligen Schulkameraden wiederzusehen. Denn erstens macht es mich fassungslos, wie alt sie geworden sind; zweitens deprimiert mich die Art, wie sie mich fassungslos ansehen, weil ich so alt geworden bin; drittens bin ich fassungslos angesichts der Tatsache, dass die alten Rollenverteilungen, die Rangordnungen in der Klasse, die einschlägigen Witze und Schmähs in der Sekunde wieder auferstehen, als wäre nicht fast ein halbes Jahrhundert vergangen.
Naturgemäß habe ich mit ganz Stein am Gebirge die Volkschule besucht. Dr. Friedrich Wehner ist sogar in meine Klasse gegangen, er ist aus meinem Jahrgang, also heute ebenfalls dreiundfünfzig Jahre alt. Er hat nach der Volksschule dasselbe Internat im Stift am Rand der Stadt Salzburg besucht, und danach haben wir beide in Innsbruck studiert, bevor sich unsere Wege trennten.
Dr. Friedrich Wehner wurde in der Volksschule von allen »Wehni« genannt. Nach seinem Medizinstudium rief man ihn immer noch so, schrieb allerdings nun lateinisch »Veni«, wie es sich für einen Akademiker gehört. Er empfängt mich in der Tür seines Hauses, in dessen Erdgeschoss sich die Ordination befindet, die allerdings nur vormittags geöffnet hat.
»Quint!«, ruft er mir freundlich zu, »Veni!«, rufe ich, und dann umarmen wir uns mit herzhafter Distanziertheit. Er bittet mich ins Haus, sperrt seine Praxis auf und führt mich in eines seiner drei Behandlungszimmer.
»Riesig … und ganz schön modern, die Praxis«, stelle ich fest.
»Ja, da staunst du, was? … Ich hab jetzt sogar ein Ultraschallgerät.«
»Das wirst du für mich nicht brauchen.«
»Welcher Notfall führt dich zu mir?«
»Ich hoffe, ich störe dich nicht … Sonst komme ich morgen wieder!«
»Ich habe nur mit den Enkeln gespielt.«
»Du hast Enkelkinder?«
»Zwei Stück. Du weißt, am Land sind wir mit allem früher dran.«
»Mit allem nicht«, wende ich ein, »aber mit dem Kinderkriegen ist man schnell.«
Dr. Wehner sieht gut aus. Eigentlich sieht er genauso aus wie als Volkschulkind, nur größer, etwas drahtiger und grauhaarig.
»Für einen Großvater siehst du jung aus. Eigentlich siehst du aus wie damals, bei Frau Professor Schiefhuber.«
Veni lacht. »Ein verbreitetes Phänomen … Unser Gehirn lässt uns die Menschen, die wir schon lange kennen, als die gleichen wahrnehmen, die sie schon immer waren. Das führt auch dazu, dass wir uns selbst so sehen, als wären wir viel jünger. Wir verändern unsere Wahrnehmung, wir haben einen Jungbrunnen-Filter in unserer Psyche. Nach einer kurzen Schrecksekunde erscheint uns auch die Jugendliebe, die kurz vor der Rente steht, als dasselbe begehrenswerte Mädchen, das es einst war. A propos, wie geht es Lou?«
»Gut«, antworte ich. Ich habe meine Frau durch Veni kennengelernt. Eigentlich habe ich sie sozusagen von ihm geerbt. Louise, damals schon von allen Lou genannt, hat mit ihm Medizin studiert, die beiden hatten ein paar Wochen oder Monate lang eine Beziehung, bevor Lou bei einem Studentenfest aus mir bis heute unerklärlichen Gründen meinen schmachtenden Blicken nachgegeben hat.
»Macht sie noch immer diese Ethno-Medizin-Sache?«, fragt er etwas abschätzig.
»Sie arbeitet an einem neuen Buch. Das letzte war sehr erfolgreich.«
»Ich hab’s mitbekommen.«
»Jetzt ist sie gerade für zwei Monate in Südamerika und forscht über Schamanismus.«
»Während ich hier Antibiotika und Rheumamittel verschreiben darf. Und zwar weil du vor deiner Bestimmung geflüchtet bist.«
»Ich bin nicht vor meiner Bestimmung geflüchtet, sondern vor der Bestimmung, die mein Vater für mich bestimmt hat.«
»Die Leute trauern ihm immer noch nach.«
»Ich bin mir sicher, dass du ein sehr beliebter Arzt bist.«
»Ein Dorfarzt eben. Es gibt keinen anderen. Macht ja keiner mehr, dass er rund um die Uhr verfügbar ist …«
»Es tut mir leid, ich kann gerne morgen …«
»Also, was fehlt dir?«
»Mir fehlt nichts, aber ich habe was«, antworte ich und ziehe Schuh und Socke aus. Veni sieht sich die Fußsohle an, verzieht das Gesicht und zieht die Luft zwischen den Zähnen ein.
»Das sieht überhaupt nicht gut aus.« Er nimmt Tupfer und Desinfektionsmittel und beginnt, die Wunden zu reinigen.
»Echinoidea?«, fragt er, den Blick nicht vom Fuß wendend.
»Erraten.«
»Na immerhin warst du Glücklicher schon im Urlaub.«
»Es war nur ein verlängertes Wochenende. Ich habe mir eingebildet, ich muss ans Meer fahren, ganz allein, um mich zu erholen. Dann hab ich mir beim ersten Kontakt mit dem Wasser die Stacheln geholt und beim ersten Essen eine Muschelvergiftung. Waren tolle Tage.«
Veni schmunzelte. »Kann ich mir denken … Warst du unten beim Arzt?«
»Dazu war ich nicht in der Lage. Ein paar Stacheln hab ich mir selbst gezogen, aber alle konnte ich nicht erwischen.«
»Zugsalbe, irgendwas versucht?«
»Nein, ich …«
»Hör mal, Quint, der Fuß ist heiß wie ein Ofenrohr, da ist alles entzündet. Ich werde dir das jetzt noch mal reinigen und verbinden, und du musst vorsichtshalber Antibiotika nehmen.«
»Aber davon kommen die Stacheln nicht raus.«
»Nein. Seeigelstacheln haben einen Widerhaken und zerfallen gerne in ihre Einzelteile. Also ich kann dich nicht operieren. Ich mach so was nicht gern, sonst wäre ich Chirurg geworden.«
»Ich muss ins Krankenhaus?«
»Nein, zu Sabine. Die macht das öfter als die Kollegen, glaub mir. Vor allem wird dein Fuß am Ende noch dran sein.«
»Wer ist Sabine?«
»Du kennst Sabine nicht?«
»Nein.«
»Sie ist älter als wir. Uhl Sabine, kennst du nicht? Vom Tischler die Exfrau!«
»Und deshalb kann sie mir helfen? Kann sie mir einen günstigen Sarg beschaffen?«
»Hast du den Laden nicht gesehen? Am Ende der Hauptstraße. Richtung Salzburg. Sabine’s Fußpflege.«
Er malt einen Haken in die Luft.
»Sabine’s mit Idioten-Apostroph?«, frage ich. Er nickt und wir brechen in schallendes Gelächter aus. Der Idioten-Apostroph, von unserem Deutschlehrer Professor Lechensemmler so getauft, war unser beliebtestes Feindbild in der Gymnasialzeit, mit dessen Verspottung wir uns gerne über die anderen erhoben. Sonja’s Würstelstand. Leo’s Backstube. Conny’s Massagen. Beispiele gab es genügend.
»Sie ist vielleicht ein bisschen … wie soll ich sagen … anstrengend. Aber sie ist gut. Versprich mir, dass du hingehst.«
»Jaaa.«
»Nicht jaaa. Jawohlll!« Wieder lachen wir. Eine Anspielung auf Professor Wurzler, unseren Turnlehrer, dessen Vergangenheit als Offizier den Unterricht nicht unwesentlich beeinflusste.
»Bisschen Ruhe geben, mit dem Bein«, sagt Veni, als wir in den Empfangsraum der Ordination gehen, wo sich auch die Hausapotheke befindet. Er verschreibt mir ein Antibiotikum und drückt es mir mit den Worten in die Hand: »Eine morgens und abends, fünf Tage lang. Ich rufe morgen bei Sabine an und sage ihr, dass du ein Notfall bist, sonst bekommst du keinen Termin.«
»Ich war noch nie bei der Fußpflege«, sage ich, während ich bezahle.
»Das sieht man«, meint Veni und lacht.
»Darf man Alkohol trinken zu dem Antibiotikum?«, frage ich, als wir vor der Tür stehen. Der Regen hat zugelegt.
»Du bist wohl immer noch der alte Epikureer?«, fragt der Arzt.
»Weißt du, was Epikur wollte?«, frage ich zurück. »Was der Inhalt seiner Philosophie ist?«
»Soviel ich weiß: das Leben genießen! Essen, trinken …«, antwortet er.
Ich schüttle den Kopf. »Er wollte vor allem eins: Schmerz vermeiden.«
»Dann vermeide den Alkohol«, sagt Dr. Wehner und fügt hinzu: »Aber ein Bierchen zum Essen wird dich nicht umbringen.«
»Okay. Danke dir. Man sieht sich.«
»Man sieht sich«, sagt er. »Vor allem, wenn du Fieber bekommen solltest oder es nach den fünf Tagen nicht besser ist.«
»Jawohlll!«
Ich hinke zurück zu meinem Haus. Zum Glück liegt auch die Ordination des Arztes etwas außerhalb, sodass ich nicht durch den Ortskern gehen muss. Ich habe keine Lust auf Begegnungen, auf Fragen nach meinem Fuß, nach meiner Frau und nach den letzten fünf Jahren, in denen ich mich — abgesehen von Kurzbesuchen zu Weihnachten oder im Sommer — nicht in Stein am Gebirge habe blicken lassen.
Machtnix liegt auf dem Zufahrtsweg und blickt sehnsüchtig Richtung Gartentor. Als er mich erspäht, beginnt er überschwänglich zu wedeln, zu bellen und herumzuhüpfen, wobei Tropfen aus seinem nassen Fell spritzen. Ich habe Angst um meinen Fuß. »Geh Platz, lass mich in Ruhe.« Doch Machtnix denkt nicht daran, sich seine Freude verderben zu lassen, und begleitet mich hüpfend und bellend bis zur Haustür.
Ich habe Hunger. Ich öffne eine Dose Sardinen, altes Brot habe ich auch noch. Ein Bier, das hat er erlaubt. Ich schlucke mein Antibiotikum damit runter. Veni weiß ja nicht, dass es kleine Flaschen sind. Eine zweite wird kein Problem sein. Keine Mail von Lou. Nutz die Zeit, hat sie gesagt, bevor sie nach Brasilien geflogen ist. Die Abgeschiedenheit wird dir guttun. Überleg dir, was du willst. Sauf weniger. Oder am besten gar nicht. Komm zu dir.
Wobei von Saufen keine Rede sein kann. Ich fange normalerweise nie vor dem Abend an. Ich trinke keinen Schnaps. Prinzipiell lege ich Wert darauf, keinen Alkohol zu trinken. Nein, ich trinke Sauvignon blanc, Grünen Veltliner, Riesling, Burgunder und Chianti. Ab und zu ein Bierchen. Mich hat das Trinken am nächsten Tag noch nie am Arbeiten gehindert. Ich habe immer funktioniert. Aber ich merke auch, ich kann ohne Wein nicht mehr einschlafen und habe schlechte Laune … vor allem hier, in diesem Haus, in diesem Haus meiner Eltern, mit all seinen Geschichten.
»Also, wo ist das Problem?«, sage ich zu Machtnix und schenke ihm den Korken der Flasche Chianti, die ich gerade geöffnet habe. Er kaut gerne an Korken herum. »Rotwein ist antiseptisch, stimmt’s, Machtnix? Ein Gläschen hat noch keinem geschadet.«
Ich entfache ein Feuer im Kamin, das passt wunderbar zu dem verregneten, kühlen Abend und zum Rotwein. Ich setze mich in den lederbezogenen Ohrenfauteuil, den schon mein Vater so geliebt hat, und greife zu dem Buch, das auf dem Beistelltischchen liegt. Schopenhauer … der alte Miesepeter. Passt auch gut zum Wetter. »Die ersten vierzig Jahre unseres Lebens liefern den Text, die folgenden dreißig den Kommentar dazu, der uns den wahren Sinn und Zusammenhang des Textes, nebst der Moral und allen Feinheiten desselben, erst recht verstehen lehrt.« Was aber natürlich bedeuten würde, dass ein Plan hinter einem Leben steht, wenn der Text einen Sinn und einen Zusammenhang erkennen lässt. Ich lege das Buch in meinen Schoß. Machtnix räkelt sich wohlig zu meinen Füßen. Liegt ein Plan in den vierzig Jahren? Was heißt vierzig, es werden bald vierundfünfzig Jahre. Volksschule, Internat, Zivildienst, weg von zu Hause, Studium … wissenschaftliche Arbeiten, Hochzeit, Dozentenstelle, Geburt von Michaela. Professur … der Tod meiner Mutter … der Tod meines Vaters … Ich erinnere mich daran, dass ich vor ein paar Jahren mit Lou über den Umbau unserer Wohnung in Salzburg gesprochen habe. Ich war damals neunundvierzig Jahre alt und habe ihr gesagt, wir hätten noch zwanzig Jahre Zeit mit dem Umbau. In zwanzig Jahren bin ich sechzig, dann verdiene ich noch fünf Jahre gut bis zur Rente, dann können wir umbauen. Lou hat genickt, sie weiß ja, dass ich Veränderungen nicht besonders schätze. Aber sie hat mich dennoch darauf hingewiesen, dass ich in zwanzig Jahren nicht sechzig, sondern siebzig sein werde, was natürlich stimmte. Seitdem fühle ich mich alt. Ich stehe in der ersten Reihe, was das Sterben anbelangt. Und dann? Ich klappe den Schopenhauer wieder auf. »Wenn, was uns den Tod so schrecklich erscheinen lässt, der Gedanke des Nichtseins wäre, so müssten wir mit dem gleichen Schauder der Zeit gedenken, da wir noch nicht waren. Denn es ist unumstößlich gewiss, dass das Nichtsein nach dem Tode nicht verschieden sein kann von dem vor der Geburt, folglich auch nicht beklagenswerter.« Eine große Auslöschung im Nichts, vor der Geburt, nach dem Tod, das kurze Leben dazwischen nichts als eine Verknüpfung von Zellen, Synapsen und Proteinstrukturen mit dem seltsamen Willen zur Fortpflanzung … Wo soll da ein Zusammenhang liegen? Und vor allem ein Sinn?
Ich nehme einen großen Schluck Rotwein, wobei ich nicht gerade lautlos schlürfe. Machtnix sieht mich aus seinen Kulleraugen an, als wollte er sagen: Das hat aber auch keinen Sinn.
»Eh, Machtnix. Aber es tröstet.«
Der Hund rollt sich mit einem Seufzer auf dem Teppich ein. Kurz darauf beginnt er mit geschlossenem Mund kleine Bellgeräusche von sich zu geben. Die Pfoten strampeln ins Leere, und die Hundeseele träumt einen unergründlichen Traum.
Ich schließe die Augen, und ein Urlaub mit Lou fällt mir wieder ein, war es unsere erste gemeinsame Reise? Wir wohnten in einem kleinen Dorf auf der griechischen Insel Patmos und genossen die unglaubliche Ruhe der Vorsaison im Frühling. In der einzigen Taverne des Ortes saß jeden Abend ein lässig, aber gleichzeitig elegant gekleideter Mann, der das Menü aß und sich dann mit Ouzo betrank. Dabei wurde er keinesfalls laut, er betrank sich sehr gepflegt und durchaus systematisch. Eines Abends — ich hatte selbst schon ein bisschen getankt — sprach ich ihn an. Er war Engländer, fein und zurückhaltend. Ich fragte ihn, ob er auch Urlaub mache. Nein, antwortete er. »What else?«, fragte ich mit jugendlicher Unverschämtheit nach. Der Mann sah mich mit melancholischem Spott an und antwortete: »I’m learning to be an old man.« Ich habe gelacht damals, mit meinen zwanzig Jahren, verständnisvoll gelacht, aber ich habe gar nichts verstanden. Der Mann war — schätze ich heute — Anfang, Mitte fünfzig … so alt wie ich jetzt.
Ich nehme einen Schluck Rotwein, sehe ins Kaminfeuer und denke daran, wie wir damals jeden Tag zu unserer einsamen Bucht hinunterwanderten, im noch ziemlich kalten Meer herumplantschten und schnorchelten, uns in der Sonne räkelten, gescheite Bücher lasen, Oliven und Käse aßen, Sex hatten: und das Leben vor uns.
Am nächsten Tag erwache ich von einem merkwürdigen Geräusch.
Donnerstag, 5. Juli 2018
5
Machtnix hat seinen Kopf unter meine Hand gelegt und streichelt sich selbst, indem er den Kopf genüsslich hin- und herbewegt. Offensichtlich habe ich mich aus dem Fauteuil auf das Sofa sinken lassen und dort weitergeschlafen, ohne etwas davon bemerkt zu haben. Es regnet immer noch. Die Tropfen klatschen auf das Dach, als würde der Himmel Wasserbomben werfen. Beunruhigend. Ich rapple mich auf, vergesse meinen Fuß, der sich beim Auftreten mit stechenden Schmerzen in Erinnerung ruft. Ich hantle mich ächzend die Holztreppe hinauf und hinke zunächst ins Badezimmer. Alles in Ordnung bei den Wasserhähnen. Gästezimmer … Kinderzimmer … Schlafzimmer. Als ich die Tür öffne, kommt mir das Wasser entgegen. Ich blicke entsetzt auf den überschwemmten Boden, das triefnasse Bett, richte den Blick nach oben: Neben dem Dachschrägenfenster laufen auf beiden Seiten Bäche herab und ergießen sich tropfend ins Haus. Machtnix sieht sich die Bescherung ebenfalls an, dreht schnüffelnd eine Ehrenrunde im Zimmer, tappst mit nassen Pfoten in den Flur zurück, wedelt, sieht mich erwartungsvoll an und bellt. Ich seufze und mache mich auf die Suche nach Eimern, was allerdings nicht ganz leicht ist, weil ich mich zuletzt vor gut dreißig Jahren in diesem Haus ausgekannt habe.
Ich hinke wieder hinunter, finde mehrere Eimer, Wischtücher, einen großen Einmachtopf. Ich trage alles nach oben. Die Tropfen hallen bedrohlich in den leeren Gefäßen. So beginnen meine Lieblingstage: Überschwemmungen eindämmen und Termine mit Handwerkern ausmachen. Und mit einer Fußpflegerin.
Ich bewege mich ins Erdgeschoss, Machtnix heftet sich an meine kaputte Ferse und leckt im Vorbeigehen meine Hand ab.
»Herrgott, was willst du denn? Hör doch mal auf, Druck zu machen!« Der Hund läuft zur Tür und wedelt frenetisch. »Nein, wir können heute nicht spazieren gehen.« Beim Wort »spazieren« beginnt Machtnix mit freudigen Luftsprüngen. »Ich bin verletzt! Ich kann nicht gehen!« Ich beschließe, ihn zu ignorieren, und stelle Wasser auf. Jetzt brauche ich zuerst mal meinen Tee. Ich öffne die Tür, Machtnix fixiert mich und geht im Rückwärtsgang voraus. Ich hätte ihn vielleicht nicht so sehr an die täglichen Runden gewöhnen sollen. Aber was soll man tun, wenn man den Auftrag seiner Tochter hat?! Ich stelle die leere Rotweinflasche neben den Karton auf den Holzboden der Terrasse, denn im Karton hätte sie beim besten Willen keinen Platz mehr gefunden.
Als ich mich aufrichte und umdrehe, steht sie plötzlich vor mir auf der Veranda. Die Irre. Die Verrückte aus dem Wald. Sie hat nasse Haare und lächelt. Machtnix ist ganz wahnsinnig vor Freude, sie wiederzusehen, was man von mir nicht behaupten kann.
»Guten Tag«, sagt sie.
»Hallo.«
»Ich möchte mein Angebot erneuern, mit Ihrem Hund zu gehen«, sagt sie. Das Angebot erneuern … Sie spricht ein seltsames, aber schönes Deutsch.
»Aber ich kenne Sie doch gar nicht«, sage ich, »ich kann Ihnen doch nicht einfach meinen Hund anhängen.«
»Wenn Sie wollen, kann ich den Hund anhängen. Aber ich denke, er wird mir nicht davonlaufen. Ich bin Evelina. Hallo.« Sie streckt mir die Hand hin, die ich artig schüttle.
»Erlach. Quintus Erlach. Ich … ich muss zu meinem Teewasser.« Weil das aber doch zu unhöflich wäre, frage ich: »Wollen Sie auch eine Tasse?«
»Ein schöner Name, Quintus«, sagt sie. »Gerne eine Tasse Tee.« Das habe ich davon.
Ich gieße den Assam auf. In der Früh muss es Assam sein, nachmittags Darjeeling. Oder ausnahmsweise auch einmal Riesling. Der erdige Duft, der mir in die Nase steigt, erfüllt mich sogleich mit der Gewissheit, dass es mir bald besser gehen wird.
»Und … wohin gehen Sie spazieren?«, frage ich. Machtnix hält den Kopf schief, als er das Zauberwort hört.
»Den Bach entlang, auf dem Wanderweg«, sagt sie. »In den Wald möchte ich nicht mehr gehen, zu dieser Lichtung. Dort ist etwas Schreckliches passiert.«
»Ach so?«, sage ich, während ich den Tee abseihe und in zwei Gläser gieße.
»Ja«, antwortet sie und fügt ganz selbstverständlich hinzu: »Dort sind zwei Menschen ermordet worden.«
»Aha«, sage ich. »Wollen Sie Milch? Zucker?«
»Ein bisschen Milch, bitte.«
Ich sehe dem Wachsen der Stratocumulus-Milchwolke im Teeglas zu, der schönste Augenblick des Morgens. Nur heute kann ich ihn nicht so richtig genießen. Es regnet durch mein Dach. Mein Fuß tut höllisch weh. Und mein Hund ist drauf und dran, von einer Irren entführt zu werden. Der erste Eindruck hat mich nicht getäuscht. Wenn man mit ihr redet, wird ganz klar, dass sie ein Rad abhat.
»Und … wo sind die Menschen, die dort ermordet wurden?«
»Ihre Seelen sind dort. Die Körper wahrscheinlich auch, irgendwo verscharrt.« Sie nimmt einen Schluck Tee, sieht mich aus ihren riesigen blauen Augen an und lacht. »Schauen Sie nicht so drein! Das Ganze ist schon lange her, denke ich. Wissen Sie nichts darüber?«
»Nein«, antworte ich.
»Macht nichts.« Bei den Worten beginnt der Hund begeistert zu bellen. Evelina trinkt ihren Tee aus, steht auf und nimmt mit großer Selbstverständlichkeit die Leine von der Kommode. Jetzt gibt es bei Machtnix kein Halten mehr. »Spatzenhirn geht spazieren«, sage ich, denn nun gibt es ohnehin kein Zurück mehr. Soll sie eben mit ihm gehen. Sie hat zwar nicht alle Tassen im Schrank, aber für den Hund scheint sie ein gutes Händchen zu haben.
»Wann kommen Sie zurück?«
»In spätestens einer Stunde. Ich muss wieder arbeiten.«
»Darf ich fragen, wo Sie arbeiten?«
»Bei Herrn Zillner. Ich bin seine Pflegerin.«
»Der Zillner? Der im Rollstuhl sitzt? In dem riesigen Haus?«
»Ja.«
»Gehört ihm immer noch alles hier? Der Wald, der See, der Steinbruch, die Jagd, das Holz, die Schottergrube …«
Evelina hebt ratlos die Schultern. »Ich weiß es nicht. Aber arme Leute sind die sicher nicht. Komm, Machtnix.«
Mit diesen Worten und der allergrößten Selbstverständlichkeit verschwindet sie mit dem Hund im Nieselregen. Und ich muss jetzt Rainy anrufen. Auch er hat natürlich mit mir die Volksschule besucht, allerdings eine oder zwei Klassen unter mir. Rainy, wie das englische Wort für regnerisch ausgesprochen, heißt eigentlich Rainer. Schon sein Vater war Dachdecker, und der Vater seines Vaters, und für einen, dem es sozusagen in die Wiege gelegt ist, selbst Dachdecker zu werden, ist Rainy kein schlechter Name. Nicht zu ahnen war damals, dass Rainer eine Sonja heiraten würde, eine aus dem Nachbarort, und dass er mit ihr ein Gesangsduo bilden würde, das an Samstagen bei Zeltfesten Angst und Schrecken verbreitete, da weder Rainer noch Sonja singen können, geschweige denn ein Instrument beherrschen, was sie nicht davon abhält, unter dem Namen »Sunny & Rainy« selbstgedichtete Songs aus dem bäuerlichen Schlager-Segment darzubieten. Der einzige Grund dafür, dass sie auftreten dürfen beziehungsweise nicht von der Bühne geprügelt werden, liegt darin, dass niemand es sich mit dem einzigen Dachdecker der Umgebung verscherzen will.
Als Dachdecker singt Rainy zum Glück nicht. Er verspricht, am Nachmittag vorbeizukommen. So, und jetzt die Fußpflegerin, Doktor Veni hat mir ihre Nummer aufgeschrieben. Ihre Stimme klingt aufgeweckt und lustig. Der Doktor habe sie schon vorgewarnt. Sie könne am Abend einen Termin anhängen, sagt sie, wenn es denn ein Notfall sei. Aber ich solle ja pünktlich kommen, sie wolle dann auch mal Feierabend machen.
Ich humple hinauf, um die Eimer auszuleeren, bevor sie zu schwer werden. Ich untersuche die Matratze meines Betts, die sich mit Wasser vollgesogen hat, so wie die Kissen und die Decke. Trocknen ist wahrscheinlich sinnlos. Das werde ich alles zum Abfallentsorgungszentrum bringen müssen, einer vielbesuchten Attraktion in Stein am Gebirge. Immerhin werde ich nicht nur Leerflaschen zu entsorgen haben.
Ich bin gerade dabei, E-Mails zu beantworten, als es an der Tür klopft. Machtix mit hängender Zunge und Evelina mit einem Strahlen im Gesicht kommen herein. »Er ist so ein Braver«, sagt Evelina. »Haben Sie vielleicht etwas für ihn? Eine kleine Belohnung?« Ich deute auf die untere Lade der Kommode. Evelina nimmt ein Hundekeks heraus, Machtnix niest, sie lacht und gibt es ihm.
»Danke«, sage ich. »Für das Spazierengehen.«
»Gerne. Ich komme morgen wieder, wenn Sie wollen.«
»Warum machen Sie das?«
»Weil ich Hunde mag. Und weil Ihr Fuß nicht so schnell heilen wird.«
Woher will sie das wissen, denke ich mir, frage aber nicht nach.
»Wie kann ich mich erkenntlich zeigen?«
»Das weiß ich noch nicht«, antwortet Evelina. »Aber ich bin mir sicher, dass Sie mir bald helfen werden.«
»Aha. Also momentan bin ich nicht so gut zu Fuß, und mein Haus ist leck, und ich bin ganz allein, aber …«
»So allein sind Sie nicht«, sagt Evelina und lacht. »Sie haben ganz schön viele Mitbewohner.«
»Ach so? Machtnix und … Flöhe? Wanzen?«
Evelina wirft mir einen merkwürdigen Blick zu und sagt mit einer plötzlich veränderten, ausdruckslosen Stimme: »Einige Kinder sind hier. Und zwei alte Leute … ein Mann und eine Frau. Wahrscheinlich Ihre Eltern.«
»Sehen Sie Geister?«
»Der Mann trägt eine Brille mit runden Gläsern. Das sieht freundlich aus. Auf Wiedersehen, Herr Professor!«
Sie streichelt dem Hund über den Kopf und schwebt hinaus. Ich hinke zurück zum Schreibtisch, öffne die Lade und nehme die Brille meines Vaters heraus. Die Nickelbrille mit den runden Gläsern, aus denen er so freundlich in die Welt geblickt hat.
6
Ich schrecke aus dem Nachmittagsschläfchen auf, als Machtnix zu knurren beginnt.
Zuerst ist es ein brummendes Knurren, das sich zu einem bedrohlichen Bellen steigert, als Machtnix bemerkt, dass ich zu Tode erschrocken bin: Oben an der Treppe steht ein fremder Mann. Er sieht ziemlich athletisch aus, sein Kopf berührt fast den Plafond. Er trägt die langen, braun-grauen Haare zu einem Zopf gebunden. Sein Blaumann ist nass, und der große Schraubenzieher in seiner Hand wirkt alles andere als beruhigend.
»Tut der eh nichts?«, fragt der Mann.
»Kommt drauf an«, antworte ich, setze mich auf und tu so, als würde ich Machtnix zurückhalten. In Wahrheit halte ich ihn natürlich nur zurück, damit er den Eindringling nicht freudig begrüßt.
»Bin gleich von oben rein, damit ich mir die Sache ansehen kann. Du solltest die Balkontür und das Dachfenster ordentlich schließen, Quint.«
»Rainy?«, frage ich dümmlich, während ich mühsam aufstehe. Ja klar, das ist er. Auch an diesen ländlichen Schönlingen geht die Zeit nicht spurlos vorüber. Der Dachdecker kommt die Treppe herunter. Ich kann Machtnix nicht mehr zurückhalten. Er stürzt sich auf ihn, um ihm wedelnd die Hände abzulecken. Rainy schüttelt mir mit eisernem Griff die Hand.
»Ein Bier vielleicht?«, frage ich in der Hoffnung, einen Grund zu haben, aus Höflichkeit eines mitzutrinken, aber er lehnt dankend ab. Die Zeiten seien vorbei, wo man als Dachdecker seine Kiste Bier am Tag hatte, Versicherungshaftungen und der ganze Schmarren, aber vernünftiger wäre es ohnehin.
»Jaja, die Zeit … jaja, das Alter«, murmle ich.
»Geht an keinem spurlos vorüber«, meint Rainy jovial und klopft mir lachend auf die Schulter. »Auch an deinem Dach nicht, übrigens.«
Klein bin ich nicht, aber Rainy ist einen guten Kopf größer als ich. Er sieht mich an und nickt teilnahmsvoll, wie ein Arzt, der einem soeben eine üble Diagnose mitgeteilt hat.
»Du meinst, ich habe einen Dachschaden?«
»Ob du einen Dachschaden hast, kann ich nicht beurteilen, aber dein Dach hat einen … Zuerst hab ich ja geglaubt, es sind nur die Bleche. Außen am Fenster. Wer hat denn die gemacht? Ich sicher nicht. Die haben das so gefalzt, dass die Innenkante …«
»Bitte erspar mir die Details, ich verstehe sie eh nicht.«
Rainy seufzt: »Die Bleche um die Fenster sind das geringste Problem, ich hab das mal provisorisch erledigt. Hab mir erlaubt, gleich auf den Dachboden … der First und die meisten Sparren …«
»Bitte sag einfach, was los ist«, unterbreche ich ihn. Ich beherrsche zwar den wissenschaftlichen Jargon. Die Geheimsprache der Handwerker aber war mir immer schon ein Buch mit sieben Siegeln.
»Auf gut Deutsch?«, fragt er nach. Ich nicke. »Im Arsch«, sagt er. »Dein Dachstuhl ist im Arsch.« Mein Blick dürfte eine gewisse Fassungslosigkeit verraten haben, weshalb Rainy nachsetzt, als müsse er es einem Idioten erklären: »Dein Dach ist kaputt.«
»Was kostet die Reparatur?«
Jetzt lacht Rainy: »Das kannst du vergessen. Da ist nichts zu reparieren. Du brauchst ein neues Dach. Ein komplett neues Dach. Dachstuhl, Ziegel, Fenster, Bleche, Dachrinnen, das volle Programm.«
»Alles kaputt?«
»Alles nicht. Aber mit Reparieren kommst du nicht weit. Du musst das neu aufsetzen.«
»Was kostet das?«
»Viel.«
»Zahlt sich das aus? Lohnt es sich? Ich meine, außer für dich.«
Jetzt lacht Rainy schon wieder. Er dürfte ein zutiefst heiterer Mensch sein.
»Lohnt es sich? Ja, wenn dir alles wurscht ist, dann lass es, wie es ist. Ich kann dir nur sagen — auf gut Deutsch —, dein Haus ist auch bald im Arsch, wenn du nichts machst.«
Ich gehe im Kopf meine Kontostände und Ersparnisse durch. Was kann so etwas kosten? Ein bisschen etwas ist da. Nun ja, wird auch von Lou abhängen, wie viel dann wirklich noch da ist. Wie sie sich letztendlich entscheiden wird. Was soll ich mit dem Haus machen? Was ist es mir wert? Momentan nicht viel. Rainy geht zur Kommode und nimmt das gerahmte Foto meiner Eltern in die Hand, das darauf steht. »Es war ihr ganzer Stolz«, sagt er und seufzt. »Und der Garten … das war einmal der schönste Garten im Ort!« Er stellt den Fotorahmen wieder auf die Kommode. »Aber es ist natürlich deine Sache. Ich schick dir einmal einen Kostenvoranschlag, dann kannst du ja immer noch überlegen.« Er reicht mir seine Eisenhand, geht hinaus, schnappt sich die Leiter, die an der Dachrinne lehnt, und geht zu seinem Auto. Es schüttet immer noch. Ich schließe die Tür und sehe Machtnix an. Er hat eine Pfote über die andere gelegt, seinen Kopf darauf, er beobachtet mich.
»Jetzt brauchen wir mal ein Bier«, erkläre ich ihm, hole es aus dem Kühlschrank, öffne es und nehme einen tiefen ersten Schluck. Ich gehe zur Kommode, lehne mich an die Holzplatte und betrachte das Foto: meine Mutter, etwa vierzigjährig, die Haare streng nach hinten frisiert, der Ausdruck in ihrem Gesicht gütig und weich. Mein Vater mit Trachtenanzug und Krawatte … Ein wenig schalkhaft wirkt er, was vielleicht auch an der Brille mit den runden Gläsern liegt.