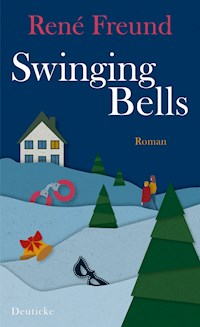Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nora hat ihren Vater verloren. Das wäre schon schlimm genug, doch dann erfährt sie seinen letzten Willen. Sie muss Paris und ihr schönes Leben in Frankreich verlassen, um mit der Asche ihres Vaters im Handgepäck und einem pedantischen jungen Notariatsgehilfen, der ihr täglich das nächste Etappenziel mitteilt, eine Wanderung zu unternehmen – durch Österreich, ein Land, das sie kaum kennt. Nora, die lebenslustige Chaotin, und Bernhard, der strenge Asket, folgen zwischen Regengüssen, Wortgefechten und allmählicher Annäherung einem Plan, der ihr Leben auf den Kopf stellen wird. Ein Roman über Liebe und Freundschaft und über eine ungewöhnliche Reise mit überraschendem Ziel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 323
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nora hat ihren Vater verloren. Das wäre schon schlimm genug, doch dann erfährt sie seinen letzten Willen. Sie muss Paris und ihr schönes Leben dort verlassen, um mit der Asche ihres Vaters im Handgepäck und einem pedantischen jungen Notariatsgehilfen, der ihr täglich das nächste Etappenziel mitteilt, eine Wanderung zu unternehmen – durch ein Land, das sie kaum kennt. Nora, die lebenslustige Chaotin, und Bernhard, der strenge Asket, folgen zwischen Regengüssen, Wortgefechten und allmählicher Annäherung einem Plan, der ihr Leben auf den Kopf stellen wird. René Freund nimmt seine Leser mit auf eine ungewöhnliche Reise. Was hinter der nächsten Wegbiegung wartet, ist immer wieder überraschend − und schließlich überraschend schön.
Deuticke E-Book
René Freund
Niemand weiß,
wie spät es ist
Roman
Deuticke
Mit freundlicher Unterstützung der Kulturabteilung der Stadt Wien und des Landes Oberösterreich.
ISBN978-3-552-06330-3
Alle Rechte vorbehalten
© Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 2016
Umschlag: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Motive: © fotolia.com/Jenny Sturm, fotolia.com/blinik, fotolia.com/tunedin, fotolia.com/todoryankov, fotolia.com/ratatosk, fotolia.com/
torsakarin, fotolia.com/Focus Pocus LTD,
fotolia.com/ghoststone; Rückseite: fotolia.com/siraphol, fotolia.com/emer
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Für Babu
Teil I
Paris
1
Wellenartig entfaltete sich die Wärme in ihrem Schoß, breitete sich aus, die Beine entlang und in den Bauch hinauf. Nora empfand die Heftigkeit der Glut als unheimlich, aber sie hielt still.
Der Taxifahrer fuhr abrupt an, beschleunigte fünfzehn Meter lang auf Hochtouren und bremste ab wie ein Irrer.
»Doucement, s’il vous plaît«, sagte Nora.
Der Fahrer sah missmutig in den Rückspiegel. Ein typischer Pariser Taxifahrer, selbst in seiner Unfreundlichkeit unverbindlich, dachte Nora und sah der Seine beim Fließen zu, scheinbar das Einzige, was sich bewegte im Verkehrsstillstand des Freitagnachmittags. Es regnete in Strömen.
»Was haben Sie gesagt?«, fragte Bernhard.
»Dass er nicht so wild fahren soll«, antwortete Nora.
»Das bringt auch überhaupt nichts«, sagte Bernhard. »Sagen Sie ihm, der Benzinverbrauch steigt um etwa sechzig Prozent, und der sinnlose Verschleiß der Bremsen verringert deren Lebensdauer um bis zu hundert Prozent.«
Nora ignorierte ihn und sah wie ein trotziges Kleinkind zum Fenster hinaus.
Die Hitze in ihrem Schoß wurde unerträglich.
»Hier, nehmen Sie«, sagte Nora plötzlich.
»Ich würde es vorziehen, wenn er hier zwischen uns säße«, sagte Bernhard. »Sie wissen, dass eine Überhitzung des Genitalbereichs bei Männern zu Unfruchtbarkeit führen kann.«
Nora überlegte eine schnelle Antwort, aber zu Genitalbereich und Unfruchtbarkeit fiel ihr in diesem Augenblick nichts Schlagfertiges ein. Erst jetzt wurde ihr so richtig bewusst, dass sie sich mit diesem Typ auf eine Reise begeben musste! Eine Reise, die mehrere Tage, wenn nicht Wochen dauern würde. Es war so unfassbar!
»Was haben Sie da?«, fragte der Taxifahrer streng. Ein typischer Pariser Taxifahrer, dachte Nora, paranoid bis dorthinaus.
»Das ist eine Urne«, sagte Nora. »Die Urne mit der Asche meines Vaters.«
»Ganz frisch?« Jetzt war der Taxifahrer besorgt.
»So frisch, wie Asche sein kann«, antwortete Nora. »Sie müssen es doch wissen, Sie haben uns beim Père Lachaise mitgenommen.«
»Sie kamen direkt aus dem Krematorium?«
»Jedenfalls mein Vater. Aber keine Sorge, wir machen keine Brandlöcher in Ihre Sitze.«
»Mein Beileid«, sagte der Taxifahrer. Ein typischer Pariser Taxifahrer, dachte Nora, weiches Herz unter der rauen Schale. Und sicher kommt jetzt noch ein Witz, denn der typische Pariser Taxifahrer hat auch Humor.
»Muss ein heißer Typ gewesen sein, Ihr Vater«, sagte der Taxifahrer.
»Kann man so sagen«, murmelte Nora, und einen Augenblick lang glaubte sie, die Wassertropfen, die über die Spiegelung ihres Gesichts die Scheibe hinabliefen, wären ihre Tränen.
2
Tags zuvor hatte das ganze Schlamassel begonnen. Nora wusste, wenn der Wecker schon vor sieben Uhr schrillt, ist das selten ein gutes Zeichen. Sie hatte einen merkwürdigen Termin vor sich. Und das am anderen Ende der Stadt. Genau genommen schrillte ihr Wecker nicht, sondern das Handy meldete sich mit einem Harfenton. Den hatte sie eingestellt, weil es der sanfteste Klingelton war, doch sie hatte ihn im Laufe der Zeit zu hassen gelernt. Der Kaffee und die Dusche halfen nicht viel. Schlaftrunken wankte sie durch das Labyrinth der U-Bahn-Schächte.
Im prunkvollen Eingangsbereich des Stadtpalais kam sich Nora winzig und hilflos vor. Sie drehte sich erschrocken um, als der Portier sie ansprach.
»Madame, Sie wünschen?« Der Hüter der Himmelspforte sah auf sie herab. Gottes Leibwächter. Sie stammelte einen etwas konfusen Satz, in dem der Name Maître Didier vorkam. Neun Uhr, das war definitiv nicht ihre Zeit. Immerhin, sie war pünktlich.
Notare gehören in Frankreich zur obersten Kaste anbetungswürdiger Halbgottheiten, das wusste Nora. Sie lebte ja nun schon lange genug in Paris. Charles Didier residierte in der Rue du Faubourg Saint-Honoré, einen Steinwurf vom Élysée-Palast entfernt, was die Wichtigkeit seiner Person noch zusätzlich unterstrich. Das hier war nicht Noras Paris. Sie hauste in einem winzigen Appartement im zweiten Arrondissement, einem Viertel, das mit seinen verwinkelten Straßen und charmanten, kleinen Läden wie ein Dorf wirkte, jedenfalls im Vergleich zum Prunk im Zentrum der Macht.
Sie folgte dem roten Teppich auf der von Handläufen aus Messing gesäumten Marmorstiege. Die Vorzimmerdame geleitete sie in ein Wartezimmer. Nora setzte sich auf einen der Fauteuils, die wohl nicht nur im Stil Ludwig des Sechzehnten gefertigt waren, sondern tatsächlich aus dem 18. Jahrhundert stammten. Dieses Wartezimmer war fast so groß wie Noras Wohnung. Sie fühlte sich elend.
Nach wenigen Minuten kam ein Mann bei der Tür herein. Er trug eine schwarze Lederjacke über dem offenen blauen Hemd.
»Hallo, meine Kleine«, sagte er. »Mon Dieu, sind Sie groß geworden!«
Nora stand auf und schüttelte artig die Hand, die ihr hingestreckt wurde. Das konnte doch kein Notar sein! Gut, das Hemd war wohl von Yves Saint Laurent und die Lederjacke von Prada, aber …
»Verzeihen Sie, Mademoiselle, ich bin Charles Didier …«
»Bonjour, Maître!«
»Lassen Sie den Maître getrost weg. Nennen Sie mich Charles!«
Er geleitete sie in das Besprechungszimmer. Dieses war definitiv größer als ihre Wohnung.
»Nora«, sagte der Notar, wobei er ihren Namen in französischer Manier nicht auf dem O, sondern auf dem A betonte, »ich möchte Ihnen zuerst mein Beileid aussprechen. Und zwar wirklich von Herzen. Wissen Sie, als Sie und Ihr Vater nach Paris kamen, hat Ihr Vater den Kauf der Wohnung im sechzehnten Arrondissement über mich abgewickelt. Wann war das? Neunzehnhundert…«
»Vierundachtzig«, sagte Nora.
»Das war damals einer meiner ersten schönen Aufträge. Er hat mir Glück gebracht. Die Kanzlei ist gediehen und gewachsen. Sie werden sich nicht an mich erinnern. Sie waren ein kleines Mädchen.«
»Ich war vier, Maître.«
»Charles. Sagen Sie bitte Charles zu mir. Seitdem war ich mit Ihrem Vater immer wieder in Kontakt. Sie wissen ja, beruflich hat er manchmal einen juristischen Rat gebraucht. Er war ein feiner Mensch. Ein Mann von Welt. Ein-, zweimal im Jahr haben wir im Bistro unten gemeinsam zu Mittag gegessen. Nun ja, und vor ein paar Monaten hat Ihr Vater mit meiner bescheidenen Unterstützung sein Testament verfasst.«
»Das habe ich den Unterlagen entnommen«, sagte Nora. »Ehrlich gesagt hat mich das gewundert. Immerhin, ich bin das einzige Kind.«
Der Notar nickte nachdenklich. Da schoss es Nora plötzlich durch den Kopf – was, wenn ich nicht das einzige Kind bin? Vielleicht hat mein Vater noch andere Kinder? Vielleicht habe ich Dutzende Geschwister! Was heißt Dutzende, eines reicht ja schon! Vielleicht hat er seine Wohnung dem Tierschutzverein vererbt? Obwohl, gerade das würde ihm nicht ähnlich sehen. Für Tiere hatte er eigentlich nur in gekochtem Zustand etwas übriggehabt, und zu boshafter Originalität hatte er auch nicht geneigt.
»Wissen Sie, es schadet nie, ein ordentliches Testament zu machen. Aber Ihr Herr Vater war doch nicht krank, oder?«, wollte Maître Didier wissen.
»Eigentlich nicht. Er ist in der Früh auf dem Weg zu seinem Zeitungskiosk tot umgefallen. Herzversagen.«
»O Nora, es tut mir so leid …«
»Er war fünfundsiebzig, immerhin.« Wie schon in den letzten Tagen hatte Nora den Eindruck, dass sie die anderen trösten musste, nicht umgekehrt. Sie schaffte das auch ganz gut, denn es ermöglichte ihr, die eigene Trauer zu verstecken. Darin war sie ohnehin geübt. Nora weinte nie. Nora konnte nicht weinen.
»Wollen Sie etwas trinken, Mademoiselle Nora? Einen Kaffee?«
»Ein Glas Wasser, bitte.«
Der Notar nahm sein Telefon zur Hand: »De l’eau, s’il vous plaît.«
Wenig später kam die Vorzimmerdame herein, ein Tablett mit einer altmodischen Karaffe und zwei Gläsern balancierend. Sie stellte es auf dem Tisch ab.
»Ist Herr Strumpfenkrautdings schon da?«, fragte der Notar.
Die Sekretärin lächelte: »Oui, Monsieur.«
»Dann führen Sie ihn doch bitte herein.«
Zwar hätte Nora gerne gewusst, ob es sich bei Herrn Strumpfenkrautdings womöglich um den Überraschungs-Universalerben handelte, doch die Höflichkeit verbot es ihr, nachzufragen. Und doch, eines wollte sie wissen: »Warum haben Sie mir gesagt, ich solle mir eine Zeitlang freinehmen?«
»Nun, ja, das ist so eine Sache … Ich hoffe, es ist Ihnen gelungen, Ihren Terminkalender freizuschaufeln?«
»Ja«, antwortete Nora, »ich konnte das einrichten.« Sie errötete ein wenig, weil sie verschwieg, wie leicht es ihr gefallen war, das einzurichten.
»Und die Einäscherung hat stattgefunden?«, fragte Maître Didier.
»Morgen Vormittag.«
»Morgen erst?« Seine Stirn legte sich kurz in Falten. »Nun ja, das sollte dennoch kein Problem sein.«
Nora verstand gar nichts, aber es war nicht ihre Art, ungeduldig zu werden. Leider, dachte sie oft. Die Leute haben mehr Ungeduld verdient.
3
Nora war von der Arbeit der letzten Tage müde: Freunde, die spärlichen Verwandten, Behörden, Banken und Versicherungen mussten informiert werden. In der Wohnung ihres Vaters hatte sie die nötigsten Arbeiten verrichtet, die Papiere gesucht und die Post umleiten lassen. Zu mehr wäre sie nicht in der Lage gewesen, ohne in ein schwarzes Loch zu fallen. Schränke, Bücher, die Küche, der Schreibtisch mussten auf später warten.
»Bitte, meine Liebe, nehmen Sie Platz. Wissen Sie, eine Testamentseröffnung ist kein Staatsakt, das ist im Prinzip eine sehr einfache Sache. Und ich kann Ihnen jetzt schon versichern, dass es im Falle dieser Verlassenschaft im Grunde keine Komplikationen gibt. Nun ja, vielleicht gibt es da eine nicht ganz alltägliche … wie soll ich sagen … Besonderheit? Kuriosum wäre zu viel gesagt. Nein, es ist eher so etwas wie eine Eigenheit.«
Die Sekretärin kam mit einem jungen Mann herein. Er trug das Haar brav gescheitelt. Anzug und Krawatte saßen zwar recht gut, strahlten aber ganz im Gegensatz zur Kleidung des Notars die Billigkeit konfektionierter Massenware aus.
»Bonjour!«, rief der junge Mann. Nora staunte, wie viel grauenhafter teutonischer Akzent in einem einzigen Wort stecken konnte.
»Maître«, flüsterte die Sekretärin dem jungen Mann zu.
»Maître?«, wiederholte er ratlos. Da war der Maître schon aufgestanden und hatte dem jungen Mann die Hand geschüttelt. »Gutän Dag«, sagte er freundlich. Warum, dachte Nora, klingt »Guten Tag« mit französischem Akzent so charmant und »Ponschur« mit deutschem so schrecklich?
»Darf ich vorstellen«, sagte Maître Didier, »das ist Monsieur …«
»Petrovits«, sprang die Sekretärin ihm zur Seite. Es klang wie Bädrowiss.
»Nun ja …«
Maître Didier lächelte bedauernd. Franzosen nehmen zwar freiwillig Käse im fortgeschrittenen Verwesungszustand, Frösche und Schnecken in den Mund, nicht aber einen Namen wie Petrovits.
»Monsieur ist ein Kollege von Maître Didier aus Wien«, erklärte die Sekretärin.
Nora reichte ihm die Hand. Der junge Mann verneigte sich steif und deutete einen Handkuss an. »Magister Bernhard Petrovits. Es ist mir eine Ehre, gnädige Frau«, sagte er. Nora war überzeugt, im Laufe der Jahre so ziemlich jede Art des Kusses kennengelernt zu haben. Aber einen Handkuss hatte sie noch nie erlitten.
»Bitte nehmen Sie Platz«, sagte der Notar, »wir schreiten nun zur Testamentseröffnung. Anwesend sind außer meiner Wenigkeit Mademoiselle Nora Weilheim und als Zeugen le cher collègue de Vienne und Sie, Madame Catherine Lachaud, die ich bitte, das Protokoll zu führen. Die Anwesenheit von zwei Zeugen ist hiermit gewährleistet.«
Er wartete, bis die Sekretärin die Namen notiert hatte. Dann nahm er einen versiegelten Umschlag zur Hand und zeigte ihn beiläufig der Runde.
»Nun, ich breche somit das Siegel. Der Umschlag enthält, wie Sie sich überzeugen können, den letzten Willen des Herrn Klaus Weilheim, geboren 1940 in Bad Godesberg, Stadt Bonn, und, wie wir wissen, und wie die hier anwesende Frau Nora Weilheim, laut Geburtsurkunde Tochter des Erblassers, anhand der von ihr eingebrachten Sterbeurkunde der Mairie de Paris, Acte de décès numéro 2650 vom 7. April 2015, bestätigen kann, am 5. April 2015 um 9.30 Uhr in 47, Avenue Théophile Gautier, Paris 16ème, verstorben.«
Bravo, dachte Nora, diesen Satz haut mir jeder Chefredakteur so oft um die Ohren, bis mindestens fünf Sätze daraus geworden sind.
Der Notar sah besorgt auf: »Cher collègue de Vienne, können Sie den Ausführungen überhaupt folgen?«
»Falls es Probleme gibt, Maître, werde ich ihm beistehen«, sagte Nora. »Ich denke«, wandte sie sich an den jungen Mann, »Sie haben verstanden, dass nicht ich am 5. April verstorben bin, sondern mein Vater. Sein Testament wird nun verlesen.«
»Danke, gnädige Frau«, sagte Magister Petrovits.
»Ich«, fuhr der Notar fort, »also ich, Herr Klaus Weilheim, geboren 1940 in Bad Godesberg, Stadt Bonn, verwitwet, wohnhaft in 75016 Paris, 4, Avenue de l’Abbé Roussel, ernenne zu meiner Erbin meine Tochter Frau Nora Weilheim, geboren am 18. März 1980, wohnhaft in 75002 Paris, 23, Rue de La Michodière.«
Na eben, dachte Nora. Man kann nicht sagen, dass sie erleichtert war, sie hatte sich eigentlich nichts anderes erwartet. Sie hatte an so etwas wie »Testament« oder »Erbe« gar keinen Gedanken verschwendet. Es folgte eine Aufzählung von Wertgegenständen sowie einzelner Bilder von Maurice Utrillo oder von Max Ernst, auf die Klaus so stolz gewesen war, die aber sicher nicht so viel wert waren, wie er immer geglaubt hatte. Es gab ein Wertpapierdepot mit etwa achtzigtausend Euro – und die Wohnung im sechzehnten Arrondissement. Dort war Nora aufgewachsen, dort war »ihre« Gegend, dort würde sie wohl hinziehen – und auf einen Schlag dreimal so viel Platz haben. Sie war ihrem Vater sehr dankbar, dass er diese Wohnung einst gekauft hatte, denn die Miete hätte sich Nora nicht einmal im Traum leisten können. Danke, Klaus.
Nun also, das war’s dann wohl. Oder gab es da nicht noch eine Kleinigkeit? Besonderheit … Kuriosum … Eigenheit?
»Hören Sie mich, Mademoiselle?«
»Jaja, natürlich.«
Maître Didier fuhr mit der Verlesung fort: »Das Erbe kann erst dann angetreten werden, wenn die Alleinerbin meinen letzten Willen erfüllt hat: Frau Nora Weilheim soll die Urne mit meinen sterblichen Überresten von Paris über Wien an einen von mir zu bestimmenden Ort in Österreich transportieren, wo meine Asche ihre letzte Ruhe finden wird. Ein Teil der Reise soll ausschließlich zu Fuß erfolgen, und zwar unter notarieller Aufsicht. Die Etappenziele werden von Maître Charles Didier jeweils am Vortag telefonisch oder per Mail durchgegeben.«
Die restlichen, eher floskelhaften Formulierungen hörte Nora nicht mehr richtig. In ihrem Kopf focht sie einen immer heftiger werdenden Streit mit ihrem Vater aus: Wieso hatte er ihr das angetan? Er wusste, dass sie nicht gerne in Österreich war. Er wusste, dass sie nicht gerne wanderte! Und überhaupt, was sollte das mit der notariellen Aufsicht? Hatte es nicht einmal so etwas wie Vertrauen zwischen ihnen gegeben?
4
»Mademoiselle?«
»Ja?«
»Ich habe gefragt, ob Sie das Erbe annehmen wollen.«
»Charles … darf ich Sie einen Augenblick allein sprechen?«
»Aber bitte, sehr gerne. Madame Lachaud, wollen Sie unserem Gast inzwischen eine Tasse Kaffee anbieten?«
Madame Lachaud deutete dem etwas verwirrt wirkenden Gast aus Österreich, ihr zu folgen. Kaum war die schwere Tür hinter ihnen zugefallen, platzte es aus Nora heraus: »Was ist meinem Vater da eingefallen? Ich kann es einfach nicht fassen! Und ehrlich, ich finde das auch irgendwie … unwürdig. Kann ich gegen so ein Testament nicht Protest einlegen?«
»Mademoiselle, ich kann Ihre momentane Verwirrung verstehen, aber glauben Sie mir: Sie können das Testament nicht anfechten. Jedenfalls nicht erfolgreich. Ich habe es formuliert. Es ist juristisch einwandfrei.«
»Juristisch, juristisch … Ich finde, es ist eine Beleidigung.«
»Sie können das auch gerne im Gesetzestext nachlesen. Die Bindung einer Erbschaft an Bedingungen und Auflagen ist nichts Außergewöhnliches.«
»Und was heißt unter notarieller Aufsicht? Gehen Sie jetzt mit mir wandern, mit der Urne im Rucksack?«
»Aber nein. Meine Aufgabe ist es, die Wanderung sozusagen von hier aus zu leiten. Ich habe von Ihrem Herrn Vater sehr genaue Direktiven dazu bekommen. Zur notariellen Aufsicht habe ich Ihnen unseren jungen Freund aus Wien beigestellt. Er ist Notariatskandidat und, wie man mir versichert hat, ein verlässlicher und angenehmer Zeitgenosse.«
»Was? Ich soll mit Strumpfenkrautdings wandern gehen?! Ich kenne den doch gar nicht!«
»Sie werden ihn kennenlernen.«
»Nein. Das werde ich nicht!«
»Wissen Sie, Sie könnten das Testament anfechten, wenn es etwas verlangen würde, das gegen das Gesetz oder gegen die guten Sitten verstößt, also etwa, wenn es verlangen würde, dass Sie Strumpfenkrautdings heiraten sollen.«
»Ha! Das fehlt noch! Dass ich Strumpfenkrautdings heirate!!«
»Mademoiselle, bitte nicht so laut. Davon ist ja keine Rede. Sie sollen einen Spaziergang mit ihm machen.«
»Spaziergang! Zu irgendeinem Ort in Österreich! Das ganze Land besteht doch nur aus Bergen und Wäldern! Ich werde das Testament nicht annehmen.«
»Nora, das ist Ihr gutes Recht. Aber ich gebe zu bedenken, achtzigtausend Euro, das ist nicht wenig Geld. Und die Wohnung ist zwar nicht riesig, aber Sie wissen, im Sechzehnten haben wir Quadratmeterpreise von zehntausend Euro und mehr. Sie werfen gerade eine Million weg.«
»Ich bin nicht käuflich. Wenn mein Vater versucht, mich zu einer Kokotte zu degradieren, sein Problem. Oder vielleicht Ihres. Ich konnte bis jetzt sehr gut ohne die Hilfe meines Vaters leben. Es wird mir auch weiterhin gelingen.«
»Ich bin ein Vermittler ohne Interessen und ohne Emotionen, Mademoiselle. Wenn Sie das Erbe ablehnen, müssen Sie nur ein Blatt Papier unterschreiben, niemand wird Ihnen Vorwürfe machen. Im Gegenteil. Wenn ich nun doch eine Meinung äußern darf: Ich finde Ihre Haltung äußerst respektabel.«
»Danke. Wo darf ich unterschreiben?«
»Das entsprechende Formular müsste ich erst aufsetzen.«
»Ich bitte Sie darum.« Nora hatte Lust, sich jetzt eine Zigarette zu drehen. Zehn Uhr vormittags, höchste Zeit für die erste. »Dauert das lange?«
»Nein.«
»Gut. Dann bitte ich Sie, das vorzubereiten. Darf man hier irgendwo rauchen?«
»Sie können auch eine längere Bedenkzeit nehmen. Es gibt keine Eile. Vielleicht wollen Sie aber wissen, was mit dem Erbe im Falle Ihrer Nichtannahme geschieht.«
»Es wird wohl an den Staat fallen. Fragt sich nur, an welchen. Mein Vater wurde in Deutschland geboren, hatte eine österreichische Frau und seinen Hauptwohnsitz in Paris.«
»Für den Fall, dass Sie das Erbe nicht annehmen, habe ich hier ein weiteres, sozusagen sekundäres Testament.«
»Das beruhigt mich. Immerhin hat er damit gerechnet, dass ich nicht käuflich bin.«
»Das sozusagen zweite, nachrangige Testament setzt im Fall Ihres Verzichts die Firma Glixomed als Alleinerben ein.«
»Wen?«
»Glixomed.«
»Das ist doch dieser riesige Pharmakonzern?«
»Aus dem Erlös des Wohnungsverkaufs sollen der Firma Glixomed Versuchstiere für pharmazeutische Experimente zur Verfügung gestellt werden.«
»Das ist nicht Ihr Ernst.«
»Ich dürfte Ihnen das nicht sagen. Aber inoffiziell, unter uns: Es ist so.«
»Warum?«, fragte sie vollkommen fassungslos.
»Versuchstiere sind heutzutage sehr teuer, besonders Primaten wie Schimpansen und …«
»Hören Sie auf! Hören Sie bitte auf!!«
»Ja, ich gebe Ihnen recht, es ist nicht schön, wie diese Tiere leiden müssen, und meiner Meinung nach oft völlig sinnlos, aber …«
»Bitte hören Sie auf! Es gibt also zwei Möglichkeiten: Entweder ich wandere mit Sie-wissen-schon durch Österreich, eine Urne unter dem Arm … oder Tiere werden gequält, und ich bin daran schuld?«
»Mademoiselle, Ihre analytische Art, die Dinge auf den Punkt zu bringen, gefällt mir.«
»Das ist doch reinste, böse Erpressung! Das widerspricht doch den guten Sitten!«
»Es mag so aussehen, aber rechtlich ist alles korrekt.«
»Wo darf ich rauchen?«
»Auf dem Balkon, Mademoiselle, wenn ich bitten darf.«
5
Der Notar führte Nora auf einen schmalen Balkon mit einem Geländer aus Schmiedeeisen. Für ihren Geschmack und vor allem für ihre ausgeprägte Höhenangst war der Balkon eindeutig zu schmal. Sie holte die Utensilien aus ihrer Jackentasche und drehte sich routiniert eine Zigarette aus Bio-Tabak, Bio-Filter und Bio-Papier. Sie sah auf die Kreuzung hinab, kurz nur, denn das war doch alles sehr tief unten, die altmodische Litfaßsäule und, etwas höher und deshalb beruhigender, das frische, zarte Grün der Platanenblätter.
Warum, warum, warum? Warum hatte Klaus das gemacht? Sie hatte ihren Vater nie Vati oder Papa genannt, immer Klaus, schon als kleines Kind, aber jetzt dachte sie: Vater!! Wie muss ein Vater ticken, um seiner Tochter so etwas anzutun? »Mein kluges Mädchen«, hatte er immer zu ihr gesagt, und sie hatte es gehasst, denn für sie hatte es immer wie »dummes Mädchen« geklungen, aber vielleicht war sie da auch etwas überempfindlich gewesen. Egal, ihr Vater ließ sie nun wie ein dummes Mädchen aussehen.
Als sie ihren Zigarettenstummel in den kleinen, mit Regenwasser gefüllten Aschenbecher warf, ärgerte sie sich, dass sie nicht mit Genuss geraucht hatte. Wenn schon rauchen, hatte sie sich vorgenommen, dann bewusst! Und außerdem hatte sie nicht nachgedacht! Aber was gab es denn nachzudenken? Bilder von gequälten Schimpansen tauchten vor ihr auf. Dafür wollte sie bestimmt nicht verantwortlich sein. Da gab es nicht viel nachzudenken. Sie musste diese Reise einfach so schnell wie möglich hinter sich bringen.
Nora stürmte zurück in das Büro des Notars. Er sah sie an.
»Es bleibt mir ja nichts anderes übrig, ich mache es«, sagte Nora.
Scheinbar unbewegt nahm der Notar den Hörer zur Hand: »Madame Lachaud, bitte kommen Sie zur Unterfertigung des Nachlassaktes. Und nehmen Sie … Monsieur mit.«
Als die Sekretärin mit Herrn Magister Bernhard Petrovits hereinkam, wechselten Nora und der Notar einen kurzen Blick. Sie versuchten beide, ein Schmunzeln zu unterdrücken, was ihnen nicht wirklich gelang. Nora musste ihre Vorurteile gegen Notare überdenken. Zumindest dieser hier war ein guter Typ. Auch wenn sie ihm eigentlich grollen sollte, weil er ihrem Vater beim Verfassen dieses abstrusen Testaments geholfen hatte.
Maître Charles Didier klärte Magister Petrovits über seine Pflichten auf und bat anschließend alle Beteiligten, ihre Unterschrift auf das Papier zu setzen. Er informierte Nora, dass er auf Anweisung ihres Vaters dreitausend Euro für anfallende Spesen auf ihr Konto überwiesen habe.
»Nun«, sagte er abschließend, »dann wünsche ich Ihnen eine gute Reise. Und glauben Sie mir, ich weiß selbst nicht, wohin diese führt. Ich habe sieben Nachrichten, die ich erst nach und nach versenden darf. Der erste Weg führt Sie nach Wien. Madame Lachaud war so liebenswürdig, Ihnen zwei Flugtickets für morgen Abend zu organisieren. Ich hoffe, Sie können das einrichten, Mademoiselle Nora?«
»Morgen Abend schon?«
»Wir können auch noch umbuchen«, sagte Madame Lachaud.
»Ich werde es einrichten können«, sagte Nora eilig und dachte: Dann habe ich es wenigstens schnell hinter mir.
6
Draußen auf der Straße blieb sie mit Bernhard Petrovits stehen. Der junge Mann schien verlegen. Eigentlich sieht er ja nicht schlecht aus, dachte Nora, aber er wirkt so schrecklich brav.
»Und jetzt?«, fragte sie.
»Ich werde Sie auf allen Ihren Wegen begleiten«, antwortete Bernhard.
Gott soll abhüten, dachte sie mit einer Floskel, die ihr Vater gerne verwendet hatte, obwohl er kein bisschen religiös gewesen war.
»Das wäre wohl sehr langweilig für Sie. Ich muss einige Mails beantworten, meine Katze zu einer Freundin bringen und packen. Haben Sie eine Ahnung, wie lange wir unterwegs sein werden?«
»Nein, ich weiß es nicht. Aber was das Packen betrifft, kann ich Ihnen einige Tipps geben.«
»Danke, das schaffe ich schon. Ich bin ein großes Mädchen und bis jetzt ohne notarielle Aufsicht durchs Leben gekommen.«
»Gut, gnädige Frau.«
»Das möchte ich Sie aber bitten … Ich bin zwar schon ein großes Mädchen, aber noch keine gnädige Frau. Wenn Sie gnädige Frau sagen, sehe ich mich mit Pelzhut und Perlenkette in der Oper sitzen.«
»Wie Sie wünschen.«
»In welchem Hotel wohnen Sie, Herr Magister?«
»Ihrerseits können Sie gerne meinen akademischen Titel weglassen.«
»Gerne. Wissen Sie, hier in Frankreich pfeift man darauf, sieht man vielleicht vom ehrwürdigen Maître ab.«
»Ich wohne im Hotel Jasmin in der Nähe von Radio France. Die U-Bahn-Linie 10, Station Mirabeau, befindet sich in der Nähe.«
»Sehr gut«, sagte Nora, »das ist gleich bei der Wohnung meines Vaters. Bevor ich verreise, sollte ich den Kühlschrank leerräumen. Wenn Sie wollen, könnten Sie mir dabei helfen.«
»Gerne.«
»Ich hole Sie gegen vier Uhr ab, ist Ihnen das recht?«
»Sechzehnhundert«, bestätigte Bernhard.
»Bis dann!«, rief Nora und suchte das Weite. »Sechzehnhundert«, hallte es in ihrem Kopf wider. Und: »Die U-Bahn-Linie 10, Station Mirabeau, befindet sich in der Nähe.« Das klang so, als hätte der Typ einen Stadtplan auswendig gelernt! Wahrscheinlich hatte er das auch. »Ihrerseits können Sie gerne meinen akademischen Titel weglassen.«
O ja, dachte Nora, da liegt wohl eine ganz tolle Zeit vor mir …
7
Auf dem Weg zu ihrer winzigen Wohnung kaufte sich Nora zwei Pains au chocolat und verschlang sie im Gehen. Die Lust währte allerdings nur so lange wie der Akt des Verschlingens. Danach spürte sie einen Klumpen im Magen und schwor sich, nächstes Mal bei Monsieur Chen Kanton-Gemüse-Reis mit Stäbchen zu essen und dazu grünen Tee zu trinken. Hätte Nora ihren Vorsatz, bei Monsieur Chen Kanton-Gemüse-Reis mit Stäbchen zu essen und dazu grünen Tee zu trinken, auch nur annähernd so oft in die Tat umgesetzt, wie sie ihn gefasst hatte, Monsieur Chen wäre heute ein wohlhabender Mann.
Weil es aber auch schon egal war, trank sie in ihrem Stammcafé einen gewaltigen Café au lait, im Freien, denn da konnte sie rauchen. Ivan setzte sich zu ihr. Ihm gehörte die kleine russische Buchhandlung gegenüber.
»Ich hab gehört von deinem Vater, tut mir echt leid, Nora.«
»Immerhin, er war fünfundsiebzig.«
»Ist doch egal, wie alt er war. Eltern zu verlieren heißt, ein Stück Heimat zu verlieren.«
Für Sätze wie diesen liebte sie Ivan, den kraushaarigen jungen Literaturnarren mit seinem Hipster-Bart, den er schon getragen hatte, als noch kein Mensch wusste, was ein Hipster ist. Dann setzte sich Catherine dazu, die Krankenschwester, die um die Ecke wohnte. Sie versorgte den ganzen Häuserblock mit medizinischen Ratschlägen, sah mal vorbei, wenn jemand Fieber hatte, und verabreichte manchmal auch Spritzen oder Infusionen. Catherine liebte Ivans brachiale Flirtversuche. Sie lachte schrill und laut, wenn dieser riesige Kerl über Schmerzen an allen möglichen und unmöglichen Körperstellen klagte und eine eingehende Untersuchung forderte. Catherines Heiterkeit war ansteckend. Weil es so lustig war, gesellte sich auch Nicolas zu der Runde, später kamen noch Clothilde und Eric. Irgendwann holte Ivan eine Flasche Wodka aus seinem Laden, was Pierrot, dem das Café gehörte, gerne tolerierte, weil er erstens wusste, dass keiner von diesen Leuten Geld hatte, und weil zweitens nach dem Wodka erfahrungsgemäß noch das eine oder andere Glas Bier oder Wein getrunken wurde. Wodka zu Mittag, so hatte ihn die Erfahrung gelehrt, sorgte für eine gute Abendkassa.
Stunden später stolperte Nora in ihre Wohnung. Monster stürzte sich sogleich auf sie und strich um ihre Beine. Sie schlüpfte erleichtert aus den um eine Spur zu engen eleganten Schuhen und streichelte ihn. Beim Händewaschen betrachtete sie ihr Gesicht mit einigem Wohlgefallen. Nach ein paar Gläsern Wodka konnte sie sich meistens recht gut leiden. Die markanten Backenknochen, das glänzende brünette Haar, die großen, hellen Augen. »Puppenaugen«, sagte sie leise. Ihr Vater hatte oft von ihren Puppenaugen gesprochen, was sie ebenso oft schrecklich gefunden hatte, denn welche Frau will schon eine Puppe sein? Aber in diesem Moment fand sie, dass er im Prinzip recht hatte. Oder gab sie ihm nur recht, weil er jetzt tot war und es sich nicht gehörte, einem Toten zu widersprechen? Sie klimperte ein paarmal mit den Wimpern und kicherte wieder. Es hatte so gutgetan, nicht an den Tod und nicht an die Einäscherung und nicht an die Zukunft zu denken. Wenn Ivan in Form war, konnte er eine Runde stundenlang zum Lachen bringen. Seine Spezialität waren Geschichten aus seiner russischen Heimat, die freilich allesamt erfunden waren, weil Ivan zwar eine russische Mutter hatte, aber selbst noch nie in Russland gewesen war.
Nora sah auf ihr Handy. Mein Gott, erst drei! Mein Gott, schon drei! Was heißt drei, fünfzehnhundert! Fünfzehnhundert vorbei! Sie setzte sich an ihren Schreibtisch und rief ihre Mails ab. Monster nutzte wie immer seine Chance und rollte sich auf ihrem Schoß ein. Er war ein mächtiger roter Kater, und Nora musste sich zusammennehmen, ihn nicht kugelrund zu füttern, denn das wäre nicht gesund für Monster, auch wenn es ihr gefallen hätte. Riesig und fett, so sollte ein roter Kater eigentlich sein. Sie streichelte ihm über den Kopf, Monster erwiderte glückselig mit leichtem Gegendruck und begann zu schnurren. Nora wäre nie auf die Idee gekommen, sich in der winzigen Wohnung ein Tier zu halten, aber das kleine, unterernährte Kätzchen war ihr eines Nachts einfach gefolgt, hatte sich nicht abschütteln lassen, sondern es sich mit der allergrößten Selbstverständlichkeit bei ihr gemütlich gemacht, um in den Monaten darauf monsterhaft zu wachsen.
Sieben neue Mails: Nora erwartete sich viel von ihrem engagierten Artikel über altes Handwerk in Paris. Sie hatte einen armenischen Schuhmacher interviewt, der nebenher Operettenabende gab, eine neunzigjährige Schnitzkünstlerin porträtiert sowie einen Wagner und einen Schmied aufgetrieben. Ihre beste Freundin Lilly hatte die Fotos gemacht, die Reportage war im Prinzip druckfertig, und zwar auf Deutsch und auf Französisch. Immerhin, dachte sie, die Deutschen sind höflich, bei der Zeit»passte das in kein Ressort«, die Süddeutsche hatte »bedauerlicherweise erst vor zwei Wochen« einen Paris-Schwerpunkt, und für Landlust war das alles »ein klein wenig zu urban«. FigaroMagazine, Le Point und Terroirs & Artisans hatten auf ihr Angebot nicht einmal geantwortet. Und mit ihren ehemaligen Arbeitgeberinnen von Elle redete sie sowieso nicht mehr. Dort hatte sie eine einzige Kolumne den Job gekostet. Eine einzige blöde Kolumne!
Sie sah noch kurz bei Libération vorbei, ob es etwas Neues gab auf der Welt. »Kurz mal gucken, ob der Papst gestorben ist«, hatte ihr Vater immer dazu gesagt. Klaus war bis zuletzt stets auf dem neuesten Stand der Technik gewesen. iPhone und MacBook gehörten zu ihm wie Calvados von Père Jules und Gitanes brunes sans filtre. Warum ausgerechnet der Papst, das wusste Nora nicht. Es war wohl Klaus’ ironische Art, anzudeuten, dass sich durch Nachrichten nur selten etwas am Weltenlauf ändert.
»Hallo Lilly … Nichts Neues von der Pressebande … Sag mal, bist du da … ich meine, jetzt, am Nachmittag, und in der nächsten Woche … vielleicht in den nächsten zwei Wochen?«
Wie immer ließ sich Monster auch von den schönsten Käse-Stücken nicht in die Transportbox locken, er war ja nicht blöd. Aber zum Glück war er gutmütig, deshalb stopfte ihn Nora einfach in die Box und machte sich auf den Weg zu Lilly. Nun näherte sich sechzehnhundert zwar schon bedrohlich, aber was sollte schon sein, dachte Nora, der Typ soll eben auf seinem Zimmer fernsehen, da kommt es auf eine Stunde mehr oder weniger auch nicht an. Und Lillys Wohnung lag direkt auf dem Weg.
8
»Es ist ganz einfach«, sagte Lilly, »entweder, er ist an Geld interessiert, das findest du raus, dann versprichst du ihm einen Tausender aus dem Erbe. Oder du machst ihm schöne Augen und küsst ein bisschen mit ihm rum, und dann nehmt ihr den Zug oder ein Taxi und fahrt wie moderne Menschen zu diesem Grab, wo auch immer das sein mag!«
Nora lachte. Typisch Lilly. »Mach-dir-das-Leben-nicht-zu-schwer« war ihr zweiter Vorname. Sie kannten sich aus der deutschen Schule, waren acht Jahre lang in derselben Klasse gewesen und hatten alle Abenteuer und Schrecknisse des Erwachsenwerdens entweder gemeinsam oder zumindest fast gleichzeitig erlebt.
»Erstens will ich nicht mit ihm rumküssen, und zweitens ist diese … Wanderung … der letzte Wille meines Vaters«, sagte Nora.
»Ach Wille, Wille«, entgegnete Lilly, »ich finde, so einen männlichen Willen darf man nicht überschätzen. Und warum willst du nicht mit ihm rumküssen?«
»Magister Bernhard Petrovits repräsentiert alles, was ich an Österreich verachte: Spießigkeit, Engstirnigkeit und Provinzialität.«
»Klingt, als hättest du den Satz lange eingeübt.«
»Ach komm einfach mit und sieh ihn dir an, dann weißt du es.«
»Aber du hast doch gesagt, er sieht nicht mal schlecht aus.«
»Ja. Aber man muss sich dazu denken, dass er nicht schlecht aussieht, und dafür braucht man nicht zu knapp Phantasie.«
Jetzt war es Lilly, die lachte. »Wenn du dich dem Männerwillen beugen willst, viel Spaß! Von mir aus kannst du wochenlang fortbleiben, dann habe ich Monster länger bei mir!« Der Kater lag nun auf ihrem Schoß und sah Nora triumphierend an. »Wegen Monster muss ich mir keine Sorgen machen, so viel steht fest«, sagte Nora.
»Du warst immer schon eifersüchtig«, entgegnete Lilly trocken. »Und geh jetzt endlich, du bist schon viel zu spät! Und melde dich! Und wenn du Hilfe brauchst, ich hol dich da raus!«
Die beiden Freundinnen umarmten einander. Nora küsste Monster auf den Kopf und ging schnell hinaus. Sie hasste Abschiede. Das hatte sie von ihrem Vater.
9
Die Sonne stand schon zwischen Saint-Cloud und Auteuil, als Nora aus dem U-Bahn-Schacht emporkam. Die leichte Wodka-Benebelung war leider verschwunden, stellte sie fest, was immerhin die Chance zu einem kleinen Neuanfang bot. Sie würde mit Bernhard bei Monsieur Cheng einkehren und dort Kanton-Gemüse-Reis mit Stäbchen essen und dazu grünen Tee trinken und ganz früh schlafen gehen. Immerhin würde sie am nächsten Tag ihren Vater auf seinem letzten Weg begleiten müssen. Nun ja, eigentlich war es sein vorletzter. Der letzte würde sie alle an irgendeinen geheimnisvollen Ort führen.
Als Nora sich dem Hotel Jasmin näherte, sah sie bereits von weitem Magister Bernhard Petrovits vor dem Eingang stehen. Die Krawatte hatte er nicht abgelegt, die Haare frisch gescheitelt, über dem Arm hing ein akkurat zusammengelegter dünner Mantel.
»Bonjour«, sagte Nora, »Sie warten hier unten?«
»Seit über einer Stunde.«
»Warum?«
»Sechzehnhundert, hatten Sie gesagt.«
»Ich habe gesagt, gegen vier, wenn ich mich richtig erinnere.«
»Jetzt ist es zwanzig nach fünf«, sagte Bernhard. »Und auf Sommerzeit wurde auch schon letztes Wochenende umgestellt.«
»Wäre ich nicht zu früh gekommen, wenn noch Winterzeit wäre?«, fragte Nora.
»Zu früh sicher nicht!«
»Ich kenne mich jedes Jahr nicht aus mit der Zeitumstellung«, versuchte Nora abzulenken, »und ich kenne niemanden, der das jemals verstanden hätte! Kommen Sie, es ist nicht weit zur Wohnung meines Vaters.« Sie gingen los, und da Bernhard nichts sagte, fragte sie ihn, um ein Gespräch anzuknüpfen:
»Woher haben Sie das mit dem Sechzehnhundert?«
»Diese Form der genauen Zeitangabe ist praktisch und äußerst präzise. Jedenfalls, wenn man sich daran hält.«
»Sind Sie mit Ihrem Zimmer zufrieden?«, fragte Nora, um das Thema zu wechseln.
Das erwies sich als genau die falsche Frage, um Bernhards Laune ein wenig zu heben.
»Die undichten Fenster des Zimmers lassen den Straßenlärm fast ungefiltert durchdringen«, sagte er, und es klang, als würde er aus einer bereits schriftlich formulierten Beschwerde vortragen. »Der Spannteppich-Boden stammt aus den späten siebziger Jahren und ist so dreckig, dass ich mir mit Handtüchern Stege gebaut habe, um ihn nicht mit den nackten Füßen berühren zu müssen.«
Nora musste lachen. »Sie haben Angst vor Fußpilz?«
Bernhard lachte nicht. »Ja, denn das ist ein unsichtbarerer, schwer zu bekämpfender Feind! Aber wissen Sie, was das Schlimmste ist? Diese entsetzliche Kombination von Leintuch und schmuddeliger Wolldecke! Diese kratzige Wolldecke über dem Leintuch, beides unter der Matratze eingeklemmt, und in der Nacht gerät das alles durcheinander, und irgendwann wacht man auf und hat alles um den Hals gewickelt!«
Nora lachte noch mehr. »Stimmt! Aber man gewöhnt sich dran!«
»Ich denke nicht daran, mich daran zu gewöhnen! In Österreich wäre dieses sogenannte Hotel bereits sanitätsbehördlich geschlossen worden!«
»Warum hat man Ihnen denn so ein billiges Hotel bestellt?«
»Billig?« Jetzt wurde Bernhard fast laut. »Das Ganze kostet 128 Euro ohne Frühstück!«
»Wir sind in Paris«, sagte Nora und zeigte mit beiden Händen um sich. Unterhalb von ihnen floss träge die Seine vorbei. Hinter dem Gebäude von Radio France ragte triumphal die Spitze des Eiffelturms hervor. »Paris ist zunächst einmal strahlend und großartig. Wenn Sie ein paar Tage länger hier sind und genauer hinsehen, bemerken Sie, das ist Fassade. In Wahrheit ist Paris schäbig, unverschämt und teuer. Wenn Sie allerdings hier leben, gehen Sie noch einen Schritt weiter und erkennen: Auch das Schäbige und das Unverschämte sind nur Fassade. Das wahre Paris leuchtet golden und hat ein zärtliches Herz.«
»Haben Sie diese Rede schon oft gehalten?«
»Sie können ja richtig zynisch sein«, sagte Nora anerkennend.
»Entschuldigen Sie bitte, aber sehen Sie da hinunter auf den Quai«, rief Bernhard aus. »Da leben Menschen in billigen Zelten! Da tummeln sich die Obdachlosen!«
»An die gewöhnt man sich.«
»Das finde ich zynisch!«
»Kommen Sie, wir müssen da hochlaufen«, sagte Nora und zupfte Bernhard am Ärmel.
»Was müssen wir?«
»Da hoch.«
»Hinauf?«
»Ja. Hinaufgehen. Sie müssen entschuldigen, mein Vater ist Deutscher … mein Vater war Deutscher. Und ich habe die deutsche Schule besucht. Da hatten wir nicht viele Lehrer aus Österreich.«
»Wir werden schon miteinander zurechtkommen«, brummte Bernhard.
»Ist Ihnen aufgefallen, dass wir seit einer Viertelstunde herumzanken?«, fragte Nora.
»Ja. Es tut mir leid. Ich war wohl unleidlich, weil ich so lange gewartet habe.«
»Das war meine Schuld. Ich hatte noch so viel um die Ohren, und wir haben unsere Handynummern nicht ausgetauscht.«
»Das sollten wir später nachholen«, meinte Bernhard. »Wie es aussieht, verbringen wir ja nun einige Zeit miteinander.«
»Ja«, sagte Nora und versuchte, nicht zu seufzen.
10
Am Haustor in der Avenue de l’Abbé Roussel gab Nora den Code ein und hielt Bernhard die Tür auf. Sie nahmen den Lift in den vierten Stock, und Nora zitterte ein wenig, als sie den Schlüssel in das Sicherheitsschloss der Wohnung steckte. Hier war sie aufgewachsen, hier hatte sie sechzehn Jahre lang mit ihrem Vater gelebt, und nun war er nicht mehr da. Würde nie wieder mit ausgebreiteten Armen im Vorzimmer stehen. Würde nie wieder in seinem Ohrenfauteuil sitzen und schwierige Bücher lesen, würde ihr nie wieder Vorträge über das Französisch des Victor Hugo und die Syntax bei Thomas Mann halten. Würde nie wieder mit seiner »Drei-Hauben«-Schürze in der Küche stehen, in Töpfen rühren und Kochbücher bekleckern.
»Es ist eigenartig für mich, hierherzukommen, und keiner ist da«, sagte Nora und schlich wie eine Einbrecherin in die Wohnung.
Bernhard zog sich im Vorzimmer die Schuhe aus.
»Sie müssen sich die Schuhe nicht ausziehen! Mein Vater hat es gehasst, wenn sich jemand die Schuhe ausgezogen hat!«
»Bei uns macht man das so.«
Bernhard ging weiter und sah sich im Wohnzimmer um, staunend. »So viele Bücher!«, sagte er. »Hat Ihr Vater die alle gelesen?«
Was für eine Frage, dachte Nora, und sie antwortete: »Ich denke schon.«
Sie ging durch einen kurzen Flur weiter und öffnete eine Tür: »Sehen Sie, das war früher mein Zimmer. Jetzt ist es das Gästezimmer. Oder war das Gästezimmer. Wenn man selten Besuch hat, werden Gästezimmer zu Rumpelkammern.«
»