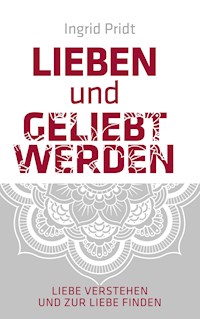
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Die glücklich machende und andauernde Liebe kann JEDER finden. Über eine ausführliche Definition von Liebe und die Beschreibung jener Voraussetzungen, ohne die Liebe nicht gedeihen kann, führt die Autorin zu Lösungsansätzen, wie man zu einem Leben in Liebe, Glück und Freude findet. Dabei geht es nicht um "Tu-dies-und-tu-das"-Empfehlungen, sondern es wird vielmehr versucht, über das Verständnis von Zusammenhängen eine bessere Grundlage zu vermitteln, um den eigenen, persönlich richtigen Weg zu finden. Das längste Kapitel befasst sich mit der Selbstliebe als eine der sehr wichtigen Voraussetzungen - nicht nur, um selbst lieben zu können, sondern auch um die Liebe, die einem Menschen von einem anderen entgegengebracht wird, empfangen und spüren zu können. Aber auch die anderen wichtigen Voraussetzungen für Liebe, wie zum Beispiel innere Nähe und Vertrauen, werden ausführlich behandelt, wie auch der Umgang mit Schwierigkeiten und Konflikten in der Partnerschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In Liebe für unsere Kinder und Enkelkinder und all ihre Nachkommen
Inhalt
Vorwort
Teil – Was ist Liebe?
Das Grundprinzip der Liebe
Liebe und Beziehung
Lieben und geliebt werden
Teil – Die wesentlichen Voraussetzungen für Liebe
Nähe und Zeit
Vertrauen und Verantwortung
Selbstliebe
Selbstliebe bedeutet …
Selbstliebe im Zusammenspiel mit Fehlern und Schwächen
Selbstliebe ist nicht Egoismus
Sein, Schein und Träumereien
Was ist ein Fehler?
Stärken und Schwächen
Fehler und Schwächen akzeptieren
Wie sich Selbstliebe entwickelt und wie sie geschwächt wird
Die Auswirkungen einer geschwächten Selbstliebe
Wie erkenne ich, ob meine Selbstliebe intakt ist?
Selbstzweifel
Und all die anderen negativen Gefühle
Lebensfreude, innere Geborgenheit und die Leichtigkeit des Seins
Wie kann ich meine Selbstliebe stärken?
Eigenverantwortung und Freiheit
Großzügigkeit
Teil – Das Zusammenspiel von Liebe und Beziehung
Sex
In einer idealen Welt …
Liebe und Beziehungen in der wirklichen Welt
Vom Hässlichen zum Schönen
Aber mein Partner …
Nachwort
Danke
Vorwort
Dies ist kein wissenschaftliches Buch. Es ist vielmehr eine Zusammenfassung dessen, was ich im Laufe meines Lebens über die Liebe gelernt habe. Erkenntnisse, die meinem Leben eine wunderbare Wendung gegeben haben und die mir sehr geholfen hätten, wären sie mir schon in jungen Jahren zugänglich gewesen. Sie hätten mich wohl vor einigem Seelenleid bewahrt.
Meine ersten beiden Ehen sind kläglich gescheitert, weitere Liebesbeziehungen sind gescheitert, bevor ich meinen jetzigen Mann kennenlernte. Mit ihm bin ich nun bald 30 Jahre glücklich verheiratet, liebe ihn noch immer – und er mich auch –, und ich würde ihn jederzeit wieder heiraten. Rückblickend habe ich mich irgendwann gefragt, was denn in den vorigen Beziehungen falsch gelaufen ist. Begonnen haben sie ja alle mit einem schönen Gefühl. Und woran liegt es, dass meine dritte Ehe so glücklich und, vor allem, schon so lange glücklich ist? Heute weiß ich, dass es primär eine Frage der inneren Bereitschaft ist, die Liebe in unser Leben auch wirklich einzulassen – tief einzulassen. Denn Liebe, die an der Oberfläche hängen bleibt, wird nicht lange halten. Dieses Buch geht der Frage nach, wie sich jene inneren Voraussetzungen schaffen lassen, die wirkliche Liebe erst ermöglichen, denn allein nur der Wunsch und die Sehnsucht nach Liebe sind dafür bei Weitem nicht ausreichend.
Ich habe dieses Buch für unsere Kinder und Enkelkinder geschrieben, in der Hoffnung, es möge ihnen helfen, in ihrem Leben dauerhafte Liebe und Glück zu finden und sich dabei den ein oder anderen schmerzhaften Umweg zu ersparen. Aber auch möglichst vielen anderen Menschen möchte ich mit diesem Buch einen Weg zeigen, der sie Schritt für Schritt zur Liebe hinführt. Einen Weg, den jeder unabhängig von seinem äußeren Umfeld gehen kann, weil es ein Weg der inneren Einstellung ist. Ich bin überzeugt davon, dass für jeden die wunderbare, große Liebe erreichbar ist – man muss nur den Weg gehen.
Noch ein paar Worte zur geschlechtergerechten Formulierung:
Ich weiß, dass in der heutigen Zeit die geschlechtergerechte Formulierung als sehr wichtig angesehen wird, weil sie die Gleichstellung von Mann und Frau zum Ausdruck bringen soll. Als ich begonnen habe, dieses Buch zu schreiben, habe ich mich deshalb auch redlich darum bemüht. Über viele Kapitel hinweg habe ich zuerst einmal sehr konsequent die weibliche und männliche Form nebeneinander verwendet. So hieß es immer »Partnerin oder Partner«, »sie oder er«, »ihr oder ihm« usw. Der Text wirkte dadurch an vielen Stellen schwerfällig, und manchmal war es schwierig, den inhaltlichen Fokus über den vielen Sie-oder-er-Formulierungen nicht zu verlieren.
Doch alle meine Probeleserinnen und Probeleser haben mich gebeten, auf die geschlechtergerechte Formulierung zu verzichten, um den Lesefluss nicht unnötig zu stören. Was ich denn auch – einigermaßen erleichtert – getan habe. Es gab nämlich einige Textstellen, die ich trotz größten Bemühens nicht geschlechtergerecht formulieren konnte, ohne dadurch die inhaltliche Aussage zu verändern. Wenn Sie also in diesem Buch von Partnern lesen, sind damit gleichermaßen weibliche wie männliche Partner gemeint. Wenn ich von »ihm – dem Menschen« oder von »ihr – der Person« spreche, bezieht sich das in beiden Fällen immer sowohl auf Frauen wie auch auf Männer. Gleiches gilt natürlich auch für alle anderen generisch maskulinen und generisch femininen Wörter.
1. Teil Was ist Liebe?
Das Grundprinzip der Liebe
Liebe gibt es in den unterschiedlichsten Erscheinungsformen, aber das Grundprinzip ist immer das gleiche.
Man kann geliebt werden, oder man kann selbst jemanden lieben, und in den meisten Fällen wünschen wir uns, dass diese Liebe auf Gegenseitigkeit beruht. Für meine Definition von Liebe möchte ich zuerst einmal mit dem Geliebtwerden beginnen.
Das Geliebtwerden, nach dem wir uns so sehr sehnen, ist dieses wunderbare, beglückende Gefühl, wenn wir ganz genau so sein können, wie wir wirklich sind, ganz ohne Verstellung; wenn wir nicht so tun müssen, als wären wir besonders gescheit oder besonders geschickt; es wäre sogar absolut egal, wenn wir tatsächlich dumm und durch und durch ungeschickt wären, es ist dann auch völlig bedeutungslos, ob wir schön oder hässlich sind, und es ist egal, ob wir reich sind oder arm. Das einzig Wichtige für den anderen ist, dass wir da sind und dass es uns gut geht. – Wenn wir so viel Vertrauen zu dem anderen haben, dass wir ihm erlauben, unser wahres, innerstes Sein zu sehen und zu spüren. Wenn wir unsere Seele öffnen, den anderen ganz tief in uns hineinschauen lassen und uns verstanden, akzeptiert und allumfassend wertgeschätzt fühlen, so wie wir wirklich sind. Wenn wir spüren, dass sich der andere Mensch aus tiefstem Herzen wünscht, dass es uns gut geht und dass wir glücklich sind, und uns nie wieder missen möchte. So fühlt sich Geliebtwerden an.
Können Sie sich mit meiner Definition von Geliebtwerden identifizieren? Ist es das, was Sie sich wünschen, wenn Sie sich nach Liebe sehnen? Vielleicht fehlt Ihnen in meiner Definition das sexuelle Begehren? Abhängig von der Art der Beziehung gehört natürlich auch Sex zur Liebe. Aber das ist eine zusätzliche Komponente, die über das allgemeingültige Grundprinzip der Liebe hinausgeht und worauf ich deshalb erst in einem späteren Kapitel eingehen werde.
Wenn also Geliebtwerden bedeutet, vom anderen in unserem wahren, unverfälschten Sein wahrgenommen zu werden, verstanden, insgesamt akzeptiert und wertgeschätzt zu werden, genau so, wie wir sind, wenn es bedeutet, dass der andere uns aus tiefstem Herzen wünscht, dass es uns gut geht und dass wir glücklich sind, und uns nie wieder missen möchte, dann muss Lieben das genaue Gegenstück dazu sein. Dann bedeutet Lieben, den anderen in seinem wahren, unverfälschten Sein wahrzunehmen, ihn zu verstehen, insgesamt zu akzeptieren und wertzuschätzen, genau so, wie er ist, und ihm aus tiefstem Herzen zu wünschen, dass es ihm gut geht und dass er glücklich ist, und dass wir ihn nie wieder missen möchten.
Zum Geliebtwerden muss ich nichts aktiv tun, ich muss einfach nur sein. Es ist der passive Teil der Liebe, während das aktive Gegenstück dazu das Lieben ist. Etwas, was man tut, eine Aktivität!
In einer idealen Welt würden wir als geliebte Babys geboren, von unseren Eltern und allen, die uns nahestehen, uneingeschränkt geliebt, und lernten so, dass wir absolut okay, liebenswert und wichtig sind. Dass Fehler, die wir machen, normal sind und nichts an unserem Okay-Sein, nichts an unserer Liebenswertigkeit, nichts an unserem Wert ändern. Wir erlebten das wunderbare Gefühl des Geliebtwerdens, ohne auch nur irgendetwas dafür tun zu müssen. Auf diese Weise könnten wir eine gesunde Selbstliebe entwickeln und, darauf basierend, die Fähigkeit, andere in der gleichen Weise zu lieben.
In dieser idealen Welt, in der es nur liebesfähige Menschen gäbe, würden wir andere lieben, und andere Menschen würden auch uns lieben – nicht nur vielleicht, sondern ganz, ganz sicher.
Wenn wir uns aber die reale Welt anschauen, dann haben fast alle Menschen in ihrer Kindheit nicht nur uneingeschränkte Liebe erfahren, sondern auch gegenteilige Erfahrungen gemacht. Erfahrungen, in denen sie sich ungeliebt gefühlt haben – und hier geht es nicht darum, ob man tatsächlich nicht geliebt wurde, sondern um das Gefühl des Nichtgeliebtwerdens. Erfahrungen, die die Selbstliebe erschüttert oder sie sogar komplett zerstört haben. Dann aber sind wir auch eingeschränkt in unserer Fähigkeit, andere zu lieben. Und weil die Selbstliebe von sehr, sehr vielen Menschen nicht intakt ist, ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr reduziert, jemanden kennenzulernen, mit dem wir dieses wunderbare, beglückende Gefühl des Geliebtwerdens dauerhaft erleben können. Also sind wir immer wieder auf der Suche. Bemühen uns. Wollen, dass sich auch der andere bemüht. Manche geben sich mit Kompromissen zufrieden, andere lassen sich auf einen Versuch nach dem anderen ein, wieder andere resignieren und geben auf.
Dabei klingt der Weg so einfach. Erstens die Selbstliebe in Ordnung bringen – nicht nur die eigene, sondern auch die vom anderen, den man lieben möchte, von dem man geliebt werden möchte. Und dann sollte es auch mit der gegenseitigen Liebe funktionieren.
Sehr grob betrachtet, ist es auch so einfach. Jedoch wie immer liegt der Teufel im Detail. Und deswegen braucht es doch ein ganzes Buch und nicht nur ein paar Seiten.
Auch wenn es nicht einfach ist, so bin ich überzeugt davon, dass die große, beständige Liebe für jeden erreichbar ist. Man muss nur ein kleines bisschen mutig sein und sich auf den Weg dorthin einlassen.
Wenn ich im ersten Teil dieses Buches erkläre, was genau ich unter Lieben und Geliebtwerden verstehe, dann sollte dabei gleichzeitig deutlich werden, warum es so schwer ist, sich wirklich auf die Liebe einzulassen. Und auch im zweiten Teil, wenn ich die unverzichtbaren Voraussetzungen für Liebe bespreche, werden Sie feststellen, dass vieles im ersten Moment selbstverständlich und einfach klingt, dass wir aber bei der Umsetzung oft mit einer Vielzahl von Hindernissen konfrontiert sind. Und so ähnlich verhält es sich auch im dritten Teil des Buches, der sich vor allem damit auseinandersetzt, wie Beziehungen durch Liebe beeinflusst werden und wie sich umgekehrt Beziehungen auf die Liebe auswirken.
Aber lassen Sie sich nicht entmutigen, denn ich zeige Ihnen auch den Weg, wie Sie es trotz aller Schwierigkeiten schaffen können, Glück, Freude und die Liebe in Ihr Leben zu holen.
Liebe und Beziehung
Bevor ich noch genauer darauf eingehe, was Liebe ist, möchte ich ein häufiges Missverständnis klären. In unserer Vorstellungswelt sind die beiden Begriffe Liebe und Beziehung zu eng miteinander verwoben. Liebe kann aber weder richtig verstanden noch wirklich gelebt werden, wenn Beziehung und Liebe im Verständnis zu sehr miteinander verschmelzen. Liebe und Beziehung sind zwei verschiedene Ebenen, und es ist überaus wichtig, zwischen beiden deutlich zu unterscheiden.
Damit meine ich nicht etwa die Unterscheidung verschiedener Beziehungsformen, zum Beispiel Geschäftsbeziehung und Liebesbeziehung.
Mir geht es vielmehr darum, dass ein »Ich liebe dich« so oft interpretiert wird als »Ich möchte mit dir in einer Ehe oder einer ‚richtigen Beziehung‘ leben«. Das laut artikulierte Gefühl der Liebe zieht sofort diesen Beziehungsrattenschwanz nach sich, von dem viele nicht genau wissen, ob sie das wirklich wollen. Da ist zwar dieses starke Gefühl der Liebe, aber man ist sich nicht sicher, ob der andere tatsächlich unsere Erwartungen an einen Lebenspartner und eine Ehe oder einfach an eine langfristige »gute Beziehung« erfüllt. Man weiß vielleicht nicht einmal, ob man überhaupt jemals mit irgendjemandem so eine Beziehung eingehen möchte. Und wer weiß schon, ob die beiden Liebenden auch nur annähernd ähnliche Erwartungen an eine Liebesbeziehung haben? Auch wenn das Gefühl der Liebe sehr stark ist, wie soll man sich da guten Gewissens zu einer vorgegebenen Beziehungsform verpflichten, wenn all diese Fragen offen sind?
Ich vermute, es liegt unter anderem an diesem Gleichsetzen von »Liebe« und »Beziehungserwartung«, dass sich viele Verliebte so sehr davor scheuen, »Ich liebe dich« zu sagen. Allerdings, wenn dieser Satz in unserem allgemeinen Sprachgebrauch tatsächlich ein relativ klares Beziehungsversprechen inkludiert, dann ist es wohl gut, dass man »Ich liebe dich« nicht so freimütig ausspricht. Dann jedoch fehlt uns einfach die richtige Ausdrucksweise für ein »Ich liebe dich« ohne Beziehungsversprechen, für ein »Ich liebe dich, und ich bin gespannt, wohin genau sich unsere Beziehung weiterentwickelt«. Nicht dass ich glaube, dass es Liebe ohne Beziehung gibt. Die Frage ist nur, ob unsere Liebe gedeihen kann im Rahmen von vorgegebenen, relativ starren Beziehungserwartungen oder ob sie nur wachsen kann, wenn sie sich frei entfalten und ihre ganz eigene Beziehungsart entwickeln darf.
Einige Leser werden jetzt vielleicht erleichtert aufatmen. Endlich weg mit dem Beziehungsdruck, weg mit der Forderung nach einer ganz bestimmten Beziehungsform. Vielleicht denken Sie sogar, endlich freie Liebe ohne Verpflichtungen. In dem Fall muss ich hier gleich richtigstellen, dass ich zwar den Beziehungsdruck von der Liebe trennen möchte, dass es aber wirkliche Liebe ohne Verantwortung nicht gibt. Und mit der Verantwortung ergeben sich wohl auch Verpflichtungen. Die Frage ist nur, welche Art von Verpflichtungen zwischen zwei Liebenden möglich, sinnvoll und schön sein können – und das Ergebnis kann weit weg von der in unserer Gesellschaft üblichen Ehe oder eheähnlichen Beziehung sein.
Der Beziehungsdruck entsteht nicht durch die Liebe, sondern durch Erwartungen, die zu einem großen Teil durch gesellschaftliche Normen geprägt sind. Wir sind keine normierten Menschen, wir sind Individuen. Und die Liebe kann nur dann von Dauer sein, wenn die Beziehung zwischen den beiden Liebenden jenen individuellen Freiraum lässt, den jeder Mensch braucht, um er selbst sein zu können. Hier passt kein Zwangskonzept, hier passen keine vorgefassten, unverrückbaren Erwartungen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns erlauben, in aller Innigkeit zu lieben und das auch auszudrücken, selbst wenn wir noch nicht wissen, in welche Beziehungsform sich diese Liebe weiterentwickeln wird.
Während einige sehr froh darüber sein werden, dass ich die Liebe vom Beziehungsdruck befreien möchte, gibt es viele andere, die das wohl gar nicht schätzen. Viele sehnen sich einfach nach einer »guten Beziehung« und glauben, dass dies ohnehin das automatische Ergebnis, der Ausdruck von Liebe ist. Dann wird alles vehement verteidigt, was ihrer Meinung nach eine »gute Beziehung« ausmacht, und damit setzen sie sowohl den anderen wie auch sich selbst massiv unter Druck. Denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man über kurz oder lang Verhaltensweisen bei seinem Partner entdeckt, die nicht den eigenen Erwartungen von einer »guten Beziehung« entsprechen. Dann soll der andere plötzlich Erwartungen erfüllen, mit denen er sich nicht identifizieren kann. Und man selbst braucht ungeheuer viel Energie, um den anderen endlich »zur Einsicht« zu bringen. Wenn man verkrampft an der eigenen Vorstellung festhält, führt das entweder zum Ende der Beziehung oder immer wieder zu Streit, mit einem Gewinner und einem Verlierer – und das bedeutet unter Garantie das Ende der Liebe, denn in der Liebe gibt es keine Verlierer! Kann sein, dass die Beziehung bleibt, aber die Liebe ist futsch.
Sie glauben das nicht? Nun, dann betrachten Sie das Beispiel von der anderen Seite:
Auch Ihr Partner hat eine sehr konkrete Vorstellung von einer »guten Beziehung«. Auch er verteidigt vehement alles, was eine solche seiner Meinung nach ausmacht. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er über kurz oder lang Verhaltensweisen bei Ihnen entdeckt, die nicht seinen Erwartungen entsprechen. Jetzt sollen Sie plötzlich Erwartungen erfüllen, mit denen Sie sich nicht identifizieren können. Und Ihr Partner setzt seine ganze Energie ein, um Sie zur Einsicht – wohlgemerkt zu seiner Einsicht – zu bringen. Sind Sie bereit, in einer Beziehung zu bleiben, in der Ihr Partner krampfhaft an seinen Erwartungen festhält? Wie wird es Ihnen gehen, wenn Sie der Verlierer sind? Werden Sie Ihren Partner noch lieben können, wenn er Sie zum Verlierer gemacht hat? Wie wird es Ihnen gehen, wenn es immer wieder zu Streit kommt, weil jeder unverrückbar an dem festhält, was er richtig findet? Solche Beziehungen gibt es viele, aber die Liebe hat sich dort davongeschlichen.
Deswegen ist es so wichtig, zwischen Beziehung und Liebe deutlich zu unterscheiden. Lassen Sie daher den Beziehungsdruck weg, denn die Liebe zeigt uns den Weg zur Beziehung! Und nicht umgekehrt.
Lieben und geliebt werden
Rufen wir uns ins Gedächtnis, wie ich Lieben und Geliebtwerden definiert habe, und betrachten wir die einzelnen Aussagen, eine nach der anderen, ganz genau:
Geliebt werden bedeutet, vom anderen in unserem wahren, unverfälschten Sein wahrgenommen zu werden …
Lieben bedeutet, den anderen in seinem wahren, unverfälschten Sein wahrzunehmen …
Aber wer kennt uns denn wirklich in unserem wahren, unverfälschten Sein?
Wie oft tun wir, als ob? Als ob uns etwas gefiele, obwohl es uns nicht gefällt. Als ob wir mit etwas einverstanden wären, obwohl sich in unserem Inneren etwas dagegen wehrt. Als ob wir etwas verstünden, wüssten, könnten, fühlten, obwohl wir es nicht wirklich verstehen, wissen, können, fühlen. Wie oft geben wir etwas vor, um bei anderen besser anzukommen, um mehr wertgeschätzt zu werden, um Konflikte zu vermeiden, um den anderen nicht zu verlieren? Gibt es wenigstens einen Menschen, der Sie wirklich so kennt, wie Sie tatsächlich sind, bis hinein in Ihr innerstes Selbst? Dem Sie sich so öffnen, dass er Sie in Ihrem wahren, unverfälschten Sein überhaupt erkennen kann? Kennen Sie sich selbst, so wie Sie in Ihrem wahren, ehrlichen, innersten Sein tatsächlich sind? Haben Sie den Mut, sich selbst so ehrlich, ohne jegliche Beschönigung wahrzunehmen?
Die meisten Menschen haben diesen Mut nicht, denn sie befürchten, dass das, was dort zum Vorschein käme, gar nicht vorteilhaft wäre, womöglich nicht liebenswert, nicht bewunderungswürdig, nicht fähig genug, vielleicht sogar böse und verabscheuungswürdig. Wer kann schon jemanden mit solchen Mängeln lieben und wertschätzen?
Aber genau das ist eines der Geheimnisse, eine der Grundbedingungen der Liebe. Liebe ist durch und durch ehrlich und dabei unendlich gütig. Solange Sie sich nicht öffnen und zeigen, wie Sie wirklich sind in Ihrem wahren, unverfälschten Sein, so lange können Sie auch gar nicht geliebt werden. Sie können natürlich vorgeben, dass Sie zum Beispiel künstlerisch interessiert sind, weil Sie glauben, sonst von Ihrer Angebeteten oder Ihrem Angebeteten nicht geliebt werden zu können. Aber was passiert dann? Die- oder derjenige liebt dann vielleicht tatsächlich diesen Menschen, den Sie darstellen, aber nicht Sie, wie Sie wirklich sind. Und Sie werden sich auch nie wirklich geliebt fühlen, werden sich nach immer mehr Liebesbeweisen sehnen und sich der Liebe trotzdem nicht sicher sein. Und Sie haben recht, denn Sie werden tatsächlich nicht geliebt, sondern immer nur das, was Sie zeigen und darzustellen versuchen. Solange Sie sich nicht öffnen und so zeigen, wie Sie wirklich sind, kann Sie die stärkste Liebe einfach nicht erreichen. Sie stehen sich selbst im Weg.
Solange Sie sich nicht selbst ehrlich betrachten können, wie Sie wirklich sind bis hinein in Ihr tiefstes Inneres, solange Sie sich nicht selbst uneingeschränkt lieben, genau so, wie Sie sind, so lange werden Sie auch nicht den Mut haben, sich anderen so zu zeigen, wie Sie wirklich in Ihrem wahren, unverfälschten Sein sind, und so lange werden Sie auch nicht wirklich und vollkommen geliebt werden können. Ohne Selbstliebe – und damit meine ich nicht Egoismus! –, ohne Selbstliebe geht es nicht.
Eine gesunde Selbstliebe zu entwickeln ist nicht einfach. Die Probleme dabei und den Weg dorthin werde ich ausführlich im zweiten Teil des Buches behandeln. An dieser Stelle möchte ich nur betonen, dass die Selbstliebe eine unumgängliche Voraussetzung ist sowohl für unsere Fähigkeit, andere zu lieben, wie auch dafür, dass wir das Gefühl des Geliebtwerdens uneingeschränkt und in seiner beglückenden Vollkommenheit erleben können.
Neben einer gut entwickelten Selbstliebe brauchen wir als Voraussetzung für die Liebe Vertrauen. Vertrauen zu dem Menschen, von dem wir geliebt werden wollen, aber auch Vertrauen zu uns selbst, dass wir damit umgehen können, wenn dieser andere Mensch unser Vertrauen doch nicht zu schätzen und zu achten weiß.
Denn wenn wir jemandem unser wahres, unverfälschtes Sein zeigen, ihn ganz tief in unsere Seele schauen lassen, dann geben wir unser Innerstes preis ohne Garantie, dass der andere mit uns und unserer offenen, verletzlichen Seele verantwortungsbewusst umgeht. Solch ein Vertrauen kann man nicht leichtfertig schenken. Aber es wäre auch unendlich traurig, die Liebe aus unserem Leben auszuschließen, weil wir solch ein Vertrauen – aus welchem Grund auch immer – überhaupt nie entwickeln können oder wollen. Im zweiten Teil des Buches habe ich daher auch dem Vertrauen ein eigenes Kapitel gewidmet.
Doch nicht nur das Zeigen der eigenen Seele erfordert Mut, auch das Hineinschauen in die Seele, das wirkliche Wahrnehmen eines anderen Menschen ist schwierig. Denn dazu gehört nicht nur ein intellektuelles, sondern auch ein emotionales Erfassen. Wenn Sie sich mit vollem Gefühl auf das Wahrnehmen des anderen einlassen, wenn Sie ihn und das, was er gerade erlebt oder erlebt hat, nicht nur sinngemäß erfassen, sondern sich auch erlauben, die Gefühle mitzuspüren, die der andere dabei hat oder hatte, dann erst werden Sie ihm so nahe sein, dass Liebe möglich ist.
Je länger und öfter man jemanden so aufmerksam und gefühlsintensiv wahrnimmt, desto mehr wird man auch Zusammenhänge erkennen, zum Beispiel zwischen Gefühlen, die aus der Vergangenheit resultieren, und heutigen Verhaltensweisen. Aus diesen Zusammenhängen wird sich, wenn wir es zulassen, ganz automatisch auch Verständnis für diesen Menschen entwickeln.
Geliebt werden bedeutet, vom anderen … verstanden, insgesamt akzeptiert und wertgeschätzt zu werden, genau so, wie wir sind …
Lieben bedeutet, den anderen … zu verstehen, insgesamt zu akzeptieren und wertzuschätzen, genau so, wie er ist …
Voraussetzung fürs Verstehen ist natürlich, wie oben beschrieben, den anderen so wahrzunehmen, wie er wirklich ist, bis hinein in sein tiefstes Inneres. Denn nur dann haben Sie auch die Möglichkeit, den anderen wirklich zu verstehen. Verstehen ist nämlich unmöglich, wenn man nicht richtig wahrnimmt oder wenn einem etwas vorgegaukelt wird.
Mit Verstehen meine ich aber nicht, dass Sie das, was Sie erkennen, auch gutheißen müssen. Verstehen hat nichts zu tun mit Urteilen. Beim Verstehen geht es lediglich darum, einzelne Komponenten nicht nur unabhängig voneinander wahrzunehmen, sondern auch Verbindungen und Zusammenhänge zu erkennen. Zum Beispiel, dass jemand vermutlich deswegen verschlossen ist, weil er schon so viele Enttäuschungen erlebt hat. Das heißt aber nicht, dass Sie es gut finden müssen, dass dieser jemand verschlossen ist. Und Sie müssen auch nicht den Eigenanteil gutheißen, den dieser jemand vielleicht beim Verursachen manch dieser Enttäuschungen gehabt hat. Sie müssen weder mit etwas einverstanden sein, noch sollten Sie etwas negativ sehen. Sie sollen überhaupt nicht bewerten. Es geht zuerst einmal nur ums Verstehen.
Ich verwende hier absichtlich Wörter wie »vermutlich« und »vielleicht«. Denn natürlich ist es illusorisch zu glauben, dass Ihnen die Interpretation von Zusammenhängen absolut korrekt und auch nur annähernd vollständig gelingen wird. Diese in ihrer ungeheuren Komplexität voll und ganz zu durchschauen gelingt wohl nicht einmal dem besten Therapeuten. Darauf kommt es aber auch gar nicht an. Wichtig ist das ehrliche Bemühen, und damit meine ich kein krampfhaftes Bemühen, sondern ein offenes Zugehen auf den anderen. Eine Offenheit, die uns erlaubt, den anderen (und auch uns selbst!) urteilsfrei und intensiv wahrzunehmen. Und zu wissen, dass das, was wir an Zusammenhängen zu verstehen glauben, richtig sein kann oder vielleicht auch nicht. Höchstwahrscheinlich liegen wir mit einigen Interpretationen richtig und mit anderen eben nicht.
Die Voraussetzung fürs Verstehen ist also urteilsfreies, wertfreies Wahrnehmen des anderen Menschen, so wie er wirklich ist, ein gefühlsintensives Wahrnehmen, mit dem wir die Seele des anderen spüren und erkennen können, ein Wahrnehmen, das auf innerer Nähe beruht.
Aber aus eigener Erfahrung wissen Sie wahrscheinlich sehr gut, dass es nicht einfach ist, beim Wahrnehmen und Verstehen jegliche Form des Urteilens und Bewertens zu unterlassen. Ganz besonders schwer ist es, wenn Sie an diesen Menschen (oder auch an sich selbst) Erwartungen oder Wünsche haben.
Wenn dieser Mensch zum Beispiel Ihr Kind ist und Sie erwarten, dass es genauso klug oder geschickt oder interessiert oder unternehmungslustig oder brav oder was auch immer ist, wie Sie es in diesem Alter waren, dann fällt es sehr, sehr schwer, zu erkennen und nicht als negativ zu bewerten, dass Ihr Kind dieser Vorstellung nicht entspricht. Viel leichter ist das, wenn es sich um das Kind des Nachbarn handelt. Der soll sich doch wegen so etwas keine Sorgen machen. Wenn das Kind nicht so gut ist in Mathematik, wird es seine Talente sicher auf anderen, vielleicht sogar nützlicheren Gebieten haben. Diese Erkenntnis über das Kind des Nachbarn fällt uns leicht, weil wir keine entsprechenden Erwartungen und Wünsche haben. Aber für unser eigenes Kind wollen wir nur das Allerbeste, und davon haben wir meist sehr konkrete Vorstellungen. Alles, was diesen zuwiderläuft, gefährdet doch das Glück unseres geliebten Kindes – das glauben wir jedenfalls sehr oft. Dabei ist es umgekehrt. Tatsächlich gefährden wir das Glück unseres Kindes, wenn wir versuchen, es in unsere Vorstellungen und Erwartungen hineinzupressen. Spätestens dann, wenn das Kind die Enttäuschung der Eltern spürt, weil es Erwartungen nicht erfüllt, spätestens dann empfindet es einen Liebesverlust, fühlt sich nicht angenommen und akzeptiert in seinem wahren, unverfälschten Sein und wird in der Entwicklung seiner Selbstliebe gestört.
Genauso schwierig ist das bewertungsfreie Verstehen, wenn es um den Partner geht. Auch hier sind Erwartungen und Wünsche im Spiel, und wenn dessen Eigenschaften und Verhaltensweisen diese nicht erfüllen, bewerten wir das beinahe automatisch negativ.
Und genau das befürchten wir auch von anderen Menschen: dass sie uns negativ bewerten, wenn wir uns öffnen und ihnen unser wahres, unverfälschtes Sein zeigen. Selbst wenn der andere versteht, warum wir die eine oder andere unangenehme Eigenschaft entwickelt haben, haben wir doch Angst, dass er uns oder zumindest Teile von uns ablehnt.
Wir stehen hier also vor dem Dilemma, dass wir für uns selbst wünschen, nicht bewertet und schon gar nicht abgewertet zu werden für das, was wir wirklich sind – und uns andererseits extrem schwer damit tun, andere nicht zu bewerten. Und doch ist das bewertungsfreie, urteilsfreie Erkennen und Verstehen des anderen eine der Grundvoraussetzungen für Liebe und, auf uns selbst angewendet, für die Selbstliebe.
Das heißt nicht, dass wir Situationen nicht mehr bewerten dürfen oder sollen. Wenn mein Kind zum Beispiel in seiner Sprachentwicklung deutlich hinter dem Durchschnitt liegt, dann wird mir das als liebevoller Elternteil natürlich auffallen, ich werde so eine Situation als potenziell kritisch bewerten, mit einem Arzt darüber sprechen, klären, was die Ursache ist, ob es Anlass zu Sorge gibt, ob und in welcher Weise das Kind Hilfe braucht und so weiter. Das alles wird aber nichts am Wert meines Kindes ändern – und zwar meine ich damit nicht nur den Wert meines Kindes für mich als liebender Elternteil, sondern den generellen Wert meines Kindes für jeden und alle! Beim bewertungsfreien, urteilsfreien Verstehen geht es darum, den grundsätzlichen Wert eines Menschen unumstößlich anzuerkennen und jeden Versuch, diesen Wert zu beurteilen, zu unterlassen. Dies macht uns aber nicht zu urteilsschwachen Wesen, die nicht fähig sind, Situationen richtig einzuschätzen und entsprechend zu handeln.
Zwischen der Bewertung einer Situation und der Bewertung der involvierten Menschen zu differenzieren ist oft nicht einfach. Um einen anderen Menschen urteilsfrei verstehen zu können, müssen wir zuerst einmal unsere persönlichen Wünsche und Erwartungen weglassen und auch die Auswirkung auf uns selbst und auf andere Menschen beiseiteschieben. Zu einem späteren Zeitpunkt, dann, wenn es um die Beziehung geht, oder darum, wie wir unser Kind optimal in seiner Entwicklung unterstützen können, erst dann ist es wichtig, auch unsere eigenen Wünsche und Erwartungen in unsere Überlegungen einzubeziehen.
In der Praxis werden diese beiden Schritte, nämlich das urteilsfreie, wertfreie Verstehen einerseits und das Berücksichtigen unserer eigenen Wünsche und Erwartungen andererseits, sehr oft zeitlich eng beieinanderliegen. Wichtig ist, dass das eine nicht das andere verdrängt, dass beiden Raum gegeben wird. Unsere eigenen Wünsche und Erwartungen drängen sich meistens ganz von allein in unsere Gedanken und Gefühle, und sie sind ja auch wesentlich für die Art der Beziehung, die wir mit einem anderen Menschen entwickeln können. Die Liebe kann sich aber nur eröffnen, wenn wir unsere Aufmerksamkeit mit gleich starker Intensität auch dem urteilsfreien, wertfreien Verstehen des anderen zuwenden.
Beim urteilsfreien Verstehen schlüpfen wir in die Schuhe respektive in die Seele des anderen. Wenn wir seinem wahren, unverfälschten Sein bis hinein in sein innerstes Selbst einmal so nahe gekommen sind, dass wir diesen Menschen verstehen, ohne zu urteilen, dann entsteht daraus auch ganz automatisch Akzeptanz und Wertschätzung. Dann wissen wir, wer dieser Mensch wirklich ist, wie er sich bemüht und vielleicht auch gekämpft hat, um den Herausforderungen des Lebens gewachsen zu sein. Wir kennen seine Qualitäten und wie sich diese in Stärken und Schwächen äußern. Wir verstehen vielleicht auch, wie er zu dem geworden ist, was er heute ist. Wir spüren mit ihm, wie es ihm geht, was ihn freut oder quält, was ihm wichtig und vielleicht auch, warum ihm etwas wichtig ist, warum er vielleicht nicht anders kann. Wir spüren diesen Menschen in seinem innersten, individuellen Sein und erkennen hinter all den äußeren Erscheinungsformen den einzigartigen, wunderbaren Menschen, so stark und gleichzeitig schwach und verletzlich, so liebenswert, wie die Natur jedes Lebewesen liebenswert gemacht hat, so liebenswert, wie Gott diesen Menschen geschaffen hat. Wir akzeptieren und wertschätzen diesen Menschen mit seiner einmaligen Persönlichkeit, respektieren, was er ist, mit seiner Geschichte und seinem Potenzial.
Sie bezweifeln, dass man einen Menschen so insgesamt akzeptieren und wertschätzen kann? Und überhaupt jeden Menschen, nur wenn man sich tief genug, gefühlsintensiv und urteilsfrei auf ihn einlässt? Wie ist das denn mit den Schwächen, die ein jeder hat? Und gibt es da nicht auch »Schwächen«, die ganz und gar schlimm sind und sogar verabscheuungswürdig? Vielleicht kann man gerade noch verstehen, warum jemand so geworden ist, aber akzeptieren und wertschätzen?
In der Praxis erweist es sich oft als schwierig, einen anderen Menschen insgesamt zu akzeptieren. Denn wir differenzieren nicht zwischen der prinzipiellen Akzeptanz und Wertschätzung eines Menschen und dem Hinnehmen und Akzeptieren von konkreten Verhaltensweisen. Fast jeder Mensch zeigt ab und zu Verhaltensweisen, mit denen wir, aus welchem Grund auch immer, Probleme haben und die wir nicht bereit sind zu akzeptieren. Es ist aber ein großer Unterschied, ob man nicht bereit ist, eine bestimmte Verhaltensweise zu akzeptieren, oder ob man aufgrund dessen einen Menschen insgesamt ablehnt, ihn nicht akzeptiert und wertschätzt.
Ich möchte das an einem praktischen Beispiel veranschaulichen:
Stellen Sie sich vor, Sie haben jemanden kennengelernt, wirklich kennengelernt, denn dieser Mensch verstellt sich nicht und hat den Mut, sich so zu geben, wie er tatsächlich ist. Sie haben viel Zeit miteinander verbracht – schöne Zeit; Sie haben interessante Gespräche geführt, Sie fühlen sich wohl, wenn Sie zusammen sind. Sie verstehen die Werte und Prioritäten dieses Menschen. Sie verstehen zum Beispiel auch, warum ihm Kunst und Ästhetik so überaus wichtig sind, und ebenso, dass es manchmal gerade aufgrund dieser sonst so wunderbaren Hingabe zu Problemen in den Dingen des täglichen Lebens kommt. So passiert es zum Beispiel immer wieder, dass dieser ansonsten absolut liebenswerte Mensch zu spät zu Verabredungen kommt, weil er so versunken war in ein Kunstwerk, dass er die Zeit übersehen hat. Wenn Sie Ihre eigenen Wünsche und Erwartungen zuerst einmal ausblenden, wird es Ihnen leichtfallen, diesen Menschen zu verstehen und ihn insgesamt zu akzeptieren und wertzuschätzen, denn in der Summe ist er einmalig und wunderbar. Wenn Sie dann – in einem zweiten Schritt, ich nenne ihn den »Beziehungsschritt« – bereit sind, Ihre eigenen Wünsche und Erwartungen hinzuzunehmen, dann werden Sie vielleicht feststellen, dass Sie mit dieser übermäßigen Unpünktlichkeit nicht können, dass diese Eigenschaft für Sie nicht akzeptabel ist – wie wunderbar dieser Mensch insgesamt auch sein mag. Sie werden daher das Problem auch ansprechen, und Ihre Beziehung wird sich, je nachdem, zu welchem Ergebnis das Gespräch geführt hat, weiterentwickeln. Möglichkeiten dafür gibt es unzählige. Vielleicht einigen Sie sich darauf, dass Ihre Freundin oder Ihr Freund eine Methode findet – zum Beispiel die Verwendung eines Weckers –, wirklich wichtige Termine verlässlich einzuhalten. Sie wiederum können dann bei weniger wichtigen Terminen flexibler sein und die gewonnene Zeit nützen, indem Sie zum Beispiel die Zeitung oder ein Buch lesen. Vielleicht kommen Sie aber auf gar keinen gemeinsamen grünen Zweig, und Ihre weitere Beziehung schränkt sich dann ein auf Ausstellungen, Vernissagen und zufällige Treffen im gemeinsamen Bekanntenkreis. In beiden Varianten bleibt die Akzeptanz und Wertschätzung insgesamt für diesen Menschen erhalten, obwohl es eine Verhaltensweise gab, die Sie nicht zu akzeptieren bereit waren – auf jeden Fall nicht in der Form, wie sie sich ursprünglich zeigte. Das ist natürlich ein sehr einfaches Beispiel. Aber auch bei wirklich problematischen Verhaltensweisen gilt dasselbe Prinzip.
Wenn wir vorerst einmal unsere Wünsche und Erwartungen und sogar unsere Wertvorstellungen wegschieben und uns tatsächlich nur auf die innere Nähe zu dem anderen einlassen, dann werden wir diesen Menschen einerseits verstehen, ihn insgesamt akzeptieren und wertschätzen, genau so, wie er ist, und uns gleichzeitig abgrenzen können gegen einzelne Verhaltensweisen, die wir nicht zu akzeptieren bereit sind. Die Akzeptanz und Wertschätzung, die ich einem Menschen insgesamt entgegenbringe, wird also nicht von einer einzelnen unangenehmen Eigenschaft abhängig sein, sehr wohl aber die Art der Beziehung, die ich mit ihm eingehen möchte.
Geliebt werden bedeutet … dass der andere uns aus tiefstem Herzen wünscht, dass es uns gut geht und dass wir glücklich sind …
Lieben bedeutet … dem anderen aus tiefstem Herzen zu wünschen, dass es ihm gut geht und dass er glücklich ist …
Bei der Mutter- und Elternliebe ist es wohl so, dass dieser Aspekt der Liebe als Allererstes empfunden wird und zur Wirkung kommt. In dem Moment, in dem dieses neue Wesen da ist, sind wir von dem tiefen Wunsch durchdrungen, dass es ihm gut geht, dass es glücklich wird, und wir wollen alles, alles nur in unserer Macht Stehende tun, um diesem neuen Menschlein ein glückliches Leben zu ermöglichen. Dieses Gefühl beginnt sich schon zu entwickeln, wenn das Baby noch im Bauch der Mutter ist, und ist spätestens mit der Geburt in voller Kraft da. Das Wahrnehmen- und Verstehenwollen wird getrieben von diesem Wunsch, alles für das Glücklichsein dieses neuen Menschenkindes zu tun. Selbstverständlich wird das kleine Menschlein beobachtet, damit wir es ja bestens versorgen. Jede Kleinigkeit wird wahrgenommen, damit wir entsprechend reagieren können. Wir bemühen uns mit aller Kraft zu verstehen, warum es jetzt weint und was es denn braucht, damit es ihm ganz bestimmt gut geht. Und selbstverständlich akzeptieren wir unser Kindlein, so wie es ist – Glatzkopf oder viele Haare, kräftig oder zart, aufgeweckt oder verschlafen, die Augen hat es von Mama oder Papa – ganz egal. Wir akzeptieren und wertschätzen es, ganz genau so, wie es ist. Die meisten Babys jedenfalls bekommen zumindest am Anfang diese umfassende Zuwendung.
Während die Liebe zu einem Baby mit dem herzenstiefen Wunsch beginnt, dass es ihm gut geht und dass es glücklich ist, entwickelt sich eine »erwachsene« Liebesbeziehung meistens nicht mit diesem Schritt. Mit »erwachsen« meine ich eine jede Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen, die, um überleben zu können, nicht mehr unbedingt auf die Unterstützung eines anderen angewiesen sind, also auch Liebesbeziehungen von Jugendlichen und Heranwachsenden.
Bei einer »erwachsenen« Liebesbeziehung entwickelt sich dieses intensive Gefühl, dass man dem anderen aus tiefstem Herzen alles Gute wünscht und dass er glücklich ist, oft erst, nachdem innere Nähe durch urteilsfreies, gefühlsintensives Wahrnehmen und Verstehen aufgebaut wurde und Akzeptanz und Wertschätzung bereits ein gefestigter Beziehungsbestandteil sind.
Dieser herzenstiefe Wunsch, dass es dem anderen gut geht und dass er glücklich ist, enthält auch die Bereitschaft, selbst etwas zum Wohlergehen und Glücklichsein des anderen beizutragen. Deswegen habe ich die Formulierung »aus tiefstem Herzen« gewählt. Denn es ist sehr einfach, jemandem oberflächlich Glück und alles Gute zu wünschen, ohne bereit zu sein, für diesen Menschen auch etwas zu tun. Auch dann, wenn es nicht nur ganz leicht und nebenbei geht. So ein oberflächlicher Wunsch hat noch nichts mit Lieben zu tun. Vielleicht mag man den anderen, vielleicht mag man ihn sogar sehr, aber wirklich tiefe, persönliche Liebe ist das noch nicht. Wenn ich jemanden wirklich liebe, nicht nur im Sinne der allgemeinen Nächstenliebe, dann bin ich auch ganz selbstverständlich bereit, für ihn viel Kraft und Zeit aufzubringen, denn sein Wohlergehen und Glücklichsein ist mir ein ganz starkes inneres, eben ein herzenstiefes Bedürfnis.
Als Eltern belassen wir es ja auch nicht nur beim Wunsch, dass es unserem Kind gut geht und dass es glücklich ist. Wir sind selbstverständlich auch bereit, etwas dazu beizutragen, unsere ganze Kraft und Energie dafür einzusetzen. Babys werden herumgetragen, wenn sie weinen. Auch wenn wir selbst schon müde sind, tragen wir sie weiter herum, damit es ihnen besser geht. Wenn wir unserem Kind damit eine Freude machen können, spielen wir auch noch zum fünften Mal hintereinander Mensch-ärgere-dich-nicht, obwohl uns das Spiel selbst so ganz und gar nicht interessiert. Wenn unser Kind ernsthafte gesundheitliche Probleme hat, scheuen wir keine Mühe und kein Geld, den richtigen Arzt zu finden und die richtige Behandlung sicherzustellen. Generationen von Eltern haben sich abgemüht mit Überstunden und zusätzlichen Jobs, um ihren Kindern eine gute Ausbildung und ein besseres Leben zu ermöglichen. Für unser Kind sind wir bereit, sehr, sehr viel zu tun und sehr, sehr viel Anstrengung auf uns zu nehmen.
Auch bei der ganz einfachen Nächstenliebe wünschen wir natürlich, dass es einem anderen Menschen gut geht. In einer Notsituation sind wir auch zu zusätzlicher Anstrengung und zusätzlichem Aufwand bereit, spenden zum Beispiel Geld oder leisten Erste Hilfe. Aber danach geben wir uns damit zufrieden, dass die weitere Versorgung durch andere, nämlich die dafür Zuständigen, übernommen wird. Wir wenden nicht noch mehr Zeit und Energie dafür auf, sicherzustellen, dass eine gute Unterbringung, optimale medizinische Versorgung und ein liebevolles Umfeld wirklich gewährleistet sind. Wir bleiben nicht selbst an der Seite des anderen, um ihn liebevoll gesund zu pflegen, so wie wir das für einen von uns innig geliebten Menschen ganz selbstverständlich täten.
Natürlich ist jeder erwachsene Mensch selbst für sein Glück und Wohlergehen verantwortlich. Und ich möchte hier keinesfalls vorschlagen, dass Sie dem geliebten Menschen diese Eigenverantwortung abnehmen. Das funktioniert so und so nicht, denn es ist tatsächlich jeder seines eigenen Glückes Schmied. Niemand kann das Glück eines anderen Menschen sicherstellen. Eltern können und sollten dem Kind helfen, seine Glücksfähigkeit zu entwickeln, unter anderem, indem sie die Selbstliebe des Kindes fördern! Aber glücklich werden, über das Baby- und Kindesalter hinaus, muss jeder durch seine eigenen Entscheidungen und Initiativen, durch sein ganz eigenes Tun.
Mir geht es vielmehr darum, dass Liebe nicht funktioniert, wenn man sie rein hedonistisch leben möchte, lediglich dem Pfad der eigenen Freude, des eigenen Vergnügens folgend, ungeachtet dessen, wie es dabei dem anderen geht. Natürlich ist es lustiger, sich mit Freunden zu einem Tennismatch zu treffen, als für den geliebten Partner einkaufen zu gehen, wenn er auf Hilfe angewiesen ist, zum Beispiel in einer besonders intensiven und kritischen Berufsphase. Ein Tennismatch mit Freunden ist auch lustiger, als nochmals mit dem Partner gemeinsam einen ungeklärten kritischen Konflikt aufzuarbeiten. Nichts gegen das Tennismatch mit Freunden. Natürlich ist auch die eigene Freude sehr, sehr wichtig. Aber wenn Sie den anderen wirklich lieben, dann werden Sie das Tennismatch gar nicht richtig genießen können, wenn sich währenddessen Ihr Partner allein mit etwas Wichtigem abquält, das nur mit Ihrer Mithilfe vernünftig bewältigt werden kann. Oder wenn Sie Ihren Partner allein mit einem Schicksalsschlag fertig werden lassen, ohne ihm beiseitezustehen.
Klingt so, als wäre Liebe nicht nur schön, sondern auch mit Verzicht verbunden. Ich möchte das auch gar nicht abstreiten, ich möchte diesen Verzicht nur in die richtige Perspektive rücken. Wenn Sie selbst krank oder rekonvaleszent sind oder sich auf einen sehr wichtigen beruflichen Termin besonders gut vorbereiten wollen, dann müssen Sie womöglich auch auf das eine oder andere Tennismatch mit Ihren Freunden verzichten. Es tut Ihnen dann wahrscheinlich zwar leid, dass Sie einen Termin absagen müssen, auf den Sie sich schon sehr gefreut haben, aber insgesamt wird Ihnen Ihre Gesundheit beziehungsweise Ihr Bestehen im Beruf wichtiger sein. Sie verzichten also auf eine schöne Sache, weil es etwas anderes gibt, das Ihnen mehr wert ist. Genauso ist es mit dem Verzicht in der Liebe. Man verzichtet auf etwas, weil es etwas anderes gibt, das einem mehr wert ist.
In einer gesunden, starken Liebesbeziehung wird die Freude den Verzicht mehr als wettmachen. Manche werden sogar das Wort »Verzicht« in diesem Zusammenhang zurückweisen, denn es handelt sich um nicht mehr und nicht weniger, als man auch für sich selbst zu tun bereit ist. So wie ich für mein eigenes Wohlergehen und Glücklichsein bereit bin, extra Kraft, Aufwand und Zeit aufzubringen, so bin ich auch bereit, dies für den geliebten Menschen zu tun, denn sein Wohlergehen und Glücklichsein sind mir ein herzenstiefes Bedürfnis.
Geliebt werden bedeutet …, dass uns der andere nie wieder missen möchte.
Lieben bedeutet …, dass wir den anderen nie wieder missen wollen.
Unser Kind möchten wir nie wieder verlieren, sobald es einmal in unser Leben getreten ist. Bei einem erwachsenen Partner ist das nicht selbstverständlich so. Erst wenn wir spüren, dass das Zusammensein mit jemandem für uns so gut, so aufbauend, so bereichernd ist, dass wir das Gefühl haben, wunderbar aufzublühen und zu wachsen, so wie wir das allein nie könnten, dann erst qualifiziert sich dieser Mensch in unserem Gefühl als wahrer Liebes- und Lebenspartner, den wir nie wieder missen möchten. Erst durch das Gefühl, mit diesem Menschen wachsen und blühen zu können, wird er so wichtig für uns.
Und nur wenn uns ein anderer Mensch wirklich wichtig ist, wird der Wunsch, dass es dem anderen gut geht und dass er glücklich ist, so groß, so herzenstief, dass wir auch bereit sind, erhebliche Anstrengungen auf uns zu nehmen, um das Glück und Wohlbefinden dieses Menschen sicherzustellen, und nicht nur unser eigenes Glücklichsein in den Vordergrund stellen.
Allein das Wahrnehmen, Erkennen, Verstehen, Akzeptieren und Wertschätzen eines anderen Menschen ist dafür sicherlich nicht ausreichend. Innere Nähe, Akzeptanz und Wertschätzung kann im Grunde ein jeder für jeden empfinden, wenn beide bereit sind, sich zu öffnen, aufeinander eingehen und genug Zeit miteinander verbringen. Die Fähigkeit, sich in andere hineinzudenken und mitzufühlen, sowie generelle Akzeptanz und Wertschätzung sind ein Kennzeichen der allgemeinen Nächstenliebe. Die Nächstenliebe beinhaltet wohl auch, dass man dem anderen ehrlich alles Gute wünscht. Aber das ist nicht dieser herzenstiefe Wunsch, der die ganz persönliche, individuelle Liebe zwischen zwei Menschen auszeichnet. Erst wenn uns ein Mensch auch auf einer ganz persönlichen Ebene wirklich wichtig ist, sind wir auch bereit, für ihn besonders viel Aufwand, Energie und Zeit einzusetzen und auf eigene Freuden zu verzichten, um das Glücklichsein dieses Menschen mit all unserer Kraft zu unterstützen.
Die persönliche Wichtigkeit, die ein Mensch für uns hat, hebt die intensive, persönliche Liebe zwischen zwei Menschen von der allgemeinen Nächstenliebe ab.
Offensichtlich hat uns die Natur mit einigen Trieben und Instinkten ausgestattet‚ um unser Überleben, das des Einzelnen wie auch das der Menschheit insgesamt, sicherzustellen. Die Mutter- und Elternliebe gehört dazu, genauso wie die sexuelle Anziehungskraft und die Liebe zwischen Liebes- und Lebenspartnern. Ohne Babys und Kinder würden weder unsere ganz persönlichen Gene weitergegeben werden, noch könnte die Menschheit weiterbestehen. Ohne Fortpflanzungsakt gäbe es keine Babys, und ohne Partnerschaft wäre das Überleben, sowohl des Individuums wie auch der Menschheit insgesamt, weitaus unsicherer.
Das Wohl und Glück ihres Kindes hat für die Eltern von Anfang an eine ungeheure Wichtigkeit, ohne dass das Baby dazu irgendeine Leistung bringen müsste oder irgendwelche bestimmte Eigenschaften haben müsste. Es ist einfach nur durch sein Da-Sein für die Eltern unermesslich wichtig und etwas absolut Wunderbares. Bei der Liebe zwischen Erwachsenen ist das schon anders. Hier ist unser persönliches Interesse an diesem Menschen, die Frage, ob er uns wichtig ist, sehr wohl von konkreten Eigenschaften abhängig. Diese sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich und können sich auch im Laufe einer Beziehung ändern. Aber die Wichtigkeit, die dieser Mensch für uns bekommt, ist abhängig davon, wie sehr wir glauben, fühlen, hoffen oder wissen, dass er ein guter Sexual-, Liebes- und Lebenspartner ist oder sein könnte.





























