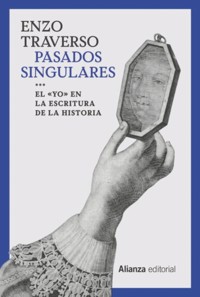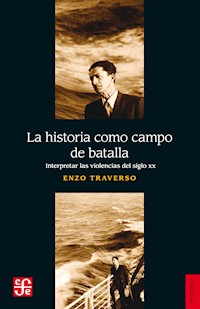17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unrast Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Enzo Traverso verleiht einer verborgenen Tradition ihren gebührenden Platz in den aktuellen Auseinandersetzungen: der linken Melancholie. Latent war die in der linken Geschichtsschreibung und Kultur zwar immer schon präsent, ihre Kraft für heutige Kämpfe hat bisher aber niemand so deutlich herausgestellt wie Traverso. Um eine neue konkrete Utopie des 21. Jahrhunderts beschreiben zu können, analysiert er Werke der bildenden Kunst, Filme, Theorietraditionen sowie die gescheiterten und verratenen Revolutionen und Revolten des 19. und 20. Jahrhunderts. Traverso zeigt in seinem Essay, dass Verlust und Hoffnung gar nicht so weit auseinanderliegen. Das Verständnis für die erlittenen Niederlagen der Vergangenheit, so Traverso, könne der Linken dabei helfen, ihre Krise zu überwinden. Er plädiert dafür, der linken Melancholie endlich einen Platz in der Tradition einzuräumen und dann zu neuen Ufern aufzubrechen. »Das Buch gehört in jeden linken auch radikaldemokratischen Diskussionszusammenhang …« – Arnold Schmieder, socialnet
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Für Michael Löwy
Enzo Traverso lehrt Ideengeschichte an der Cornell Universität in Ithaca, USA. Vorher lebte er lange Zeit in Paris und war dort in der radikalen Linken aktiv. Zahlreiche Veröffentlichungen zur linken und jüdischen Geschichte und zur Kritischen Theorie.
Enzo Traverso
Linke Melancholie
Über die Stärke einer verborgenen Tradition
Aus dem Französischen von Elfriede Müller
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Enzo Traverso: Linke Melancholie
1. Auflage, März 2019
eBook UNRAST Verlag, November 2020
978-3-95405-071-0
Das Original erschien 2016 zeitgleich auf Französisch beim Verlag La Découverte (Paris) unter dem Titel Mélancolie de gauche.La force d’une tradition cachée (XIXe-XXIe siècle) und auf Englisch als Left-Wing Melancholia. Marxism, History, and Memorybei Columbia University Press.
Copyright der Originalausgabe:
Enzo Traverso: Left-Wing Melancholia. Marxism, History, and Memory.
© Columbia University Press 2016.
© UNRAST-Verlag, Münster
www.unrast-verlag.de – [email protected]
Mitglied in der assoziation Linker Verlage (aLiVe)
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: Felix Hetscher, Münster
Satz: Andreas Hollender, Köln
Inhalt
Einführung
1. Kapitel: Die Melancholie der Besiegten
Schiffbruch mit Zuschauer
Die besiegte Linke
Die Dialektik der Niederlage
Ahnenforschung
Walter Benjamins Antinomien
Die melancholische Wette
2. Kapitel: Marxismus und Erinnerung
Aufkommen der Erinnerung, Verabschiedung des Marxismus
Erinnerung an die Zukunft
Mythos und Erinnerung
Die vergangene Zukunft
3. Kapitel: Melancholische Bilder. Das Kino der besiegten Revolutionen
Die geschichtliche Kamera
Die Restauration der Nachkriegszeit
Koloniale Revolutionen
Erinnerungsorte
Rote Schatten
Spanische Phantome
Erinnerungen an Santiago
U-topie
4. Kapitel: Die Boheme: Zwischen Melancholie und Revolution
Soziologie
Marx
Gustave Courbet
Walter Benjamin
Leo Trotzki
Boheme und Revolution
Bewegungen und Personen
5. Kapitel: Gespenster des Kolonialismus
Marx und der Okzident
Die Hegel’sche Matrix
»Geschichtslose Völker«
Gewalt und Revolte
Erbschaften
Spaltungen
6. Kapitel: Adorno und Benjamin. Ein Briefwechsel, als es Mitternacht schlug im letzten Jahrhundert
Zeugnisse
Konstellation
Hierarchien
Exil
Politik
Surrealismus
Massenkultur
7. Kapitel: Die Zeitenfolge
Portbou
Paris
Marx neu interpretieren
Synchronien: 1940 und 1990
Historismus
Revolutionen
Utopie
Danksagungen
Anmerkungen
Einführung
»Im Match des Jahrhunderts zwischen Sozialismus und Barbarei,hat die Barbarei etwas Vorsprung gewonnen.Zu Beginn des 21. Jahrhundert haben wir weniger Hoffnungen,als unsere Ahnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten.«
Daniel Bensaïd, Jeanne de guerre lasse (1991)[1]
Dieses Werk will die melancholische Dimension der linken Kultur des 19. und 20. Jahrhundert erforschen. ›Linke Kultur‹ ist ein heterogener und offener Begriff, schwer einzugrenzen. Die Linke, von der hier die Rede sein wird, ist nicht in rein topologischen Begriffen definiert, einer üblichen Herangehensweise der Politikwissenschaften; sie wird eher in ontologischen Begriffen definiert: die Bewegungen, die in der Geschichte für Gesellschaftsveränderung gekämpft und das Prinzip der Gleichheit ins Zentrum ihrer Projekte und Kämpfe gestellt haben.[2] Ihre Kultur schließt nicht nur eine Vielheit von politischen Strömungen ein, sondern auch eine Pluralität von intellektuellen und ästhetischen Sensibilitäten. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, Texte und Bilder zu analysieren. Die in theoretischen Werken fest gehaltenen Ideen, die politischen Dokumente und die in autobiografischen Berichten entwickelten Zeugnisse oder die Briefwechsel weisen Berührungspunkte mit Propagandaplakaten, Gemälden und Filmen auf. Dem Marxismus wird dabei ein bedeutender Platz eingeräumt, da er die Kultur der revolutionären Bewegungen des 20. Jahrhunderts dominierte. Der Begriff der ›linken Kultur‹ deckt in diesem Essay ein Ensemble an Theorien und Erfahrungen ab, an Ideen und Gefühlen, an Leidenschaften und Utopien. Die linke Erinnerung ist ein großer Kontinent aus Siegen und Niederlagen: die ersten begeisternd, aber meistens kurzlebig, die zweiten oft dauerhaft. Die Melancholie ist ein Gefühl, ein seelischer Zustand und eine geistige Disposition. Um die linke Kultur zu verstehen, muss man notwendigerweise über Ideen und Konzepte hinausgehen.
Zu Beginn der Achtzigerjahre traf die Thematisierung der Erinnerung in den Sozialwissenschaften mit der Krise des Marxismus zusammen, der im typischen ›Erinnerungsmoment‹ zu Anfang des 21. Jahrhunderts quasi abwesend bleibt. Die marxistische Geschichtskonzeption implizierte eine Erinnerungsvorschrift: man musste die vergangenen Ereignisse im historischen Bewusstsein einschreiben, damit sie in die Zukunft projiziert werden konnten. Es handelte sich um eine ›strategische‹ Erinnerung an die vergangenen Kämpfe, eine auf die Zukunft orientierte Erinnerung. Das Ende des Kommunismus hat diese Dialektik zwischen Vergangenheit und Zukunft zerschlagen, und das Verschwinden der Utopien, die unsere ›präsentische‹ Epoche begleiten, führte zur fast vollständigen Auslöschung der marxistischen Erinnerung. Die Spannung zwischen Vergangenheit und Zukunft ist zu einer beschädigten »negativen Dialektik« geworden. Dieser Kontext begünstigte die Wiederentdeckung einer melancholischen Geschichtsvision als Eingedenken, als Wiedererinnerung an die Besiegten – Walter Benjamin war ihr bedeutendster Interpret –, die zu einer verborgenen marxistischen Tradition gehört.
Während fast eines Jahrhunderts hat sich die radikale Linke von der berühmten elften Feuerbachthese von Marx inspirieren lassen: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt darauf an, sie zu verändern.[3] Als die Linke 1989 ohne ›geistigen Schutzraum‹ dastand, nachdem sie sich bewusst wurde über das Scheitern der vergangenen Versuche, die Welt zu verändern, waren es die Ideen selbst, mit denen man versucht hatte, die Welt zu interpretieren, die infrage zu stellen waren. Und als ein Jahrzehnt später neue Bewegungen auftauchten, die »eine andere Welt ist möglich« proklamierten, mussten sie ihre intellektuellen und politischen Identitäten neu erfinden. Sie mussten sich neu erfinden, indem sie völlig neue Praktiken herausbildeten – und sogar in mancher Hinsicht, Theorien – in einer Welt ohne sichtbare, denkbare oder vorstellbare Zukunft. Sie konnten nicht, im Unterschied zu anderen Waisengenerationen, die ihnen vorausgingen, »eine Tradition erfinden«. Der Übergang von einem verwüsteten Zeitalter, das trotz seiner unzählbaren Niederlagen verständlich blieb, zu einer neuen Epoche globaler Drohungen ohne voraussehbaren Ausweg, hat eine melancholische Färbung angenommen. Das bedeutet nicht notwendigerweise den Rückzug in ein geschlossenes Universum der Trauer und Erinnerungen; es handelt sich eher um ein Ensemble von Emotionen und Gefühlen, die den Übergang zu einer neuen Ära umhüllen. Das ist die einzige Art, wie die Suche nach Ideen und Projekten für morgen mit der Trauer und der Traurigkeit, die das Verschwinden der revolutionären Erfahrungen der Vergangenheit hinterlassen hat, koexistieren können. Das ist die Melancholie einer Linken, weder archaisch noch ohnmächtig, die den Ballast der Vergangenheit nicht abwerfen will, auch wenn er manchmal schwer zu tragen ist. Es ist die Melancholie einer Linken, die, auch wenn sie sich in den Kämpfen der Gegenwart engagiert, sich nicht der Bilanz der akkumulierten Niederlagen entzieht. Eine Linke, die nicht vor der vom Neoliberalismus gezeichneten globalen Ordnung resigniert, aber die ihre kritischen Waffen nur schärfen kann durch die emphatische Identifikation mit den Besiegten der Geschichte, diese große Multitude, der sich am Ende des 20. Jahrhunderts die letzte Generation der geschlagenen Revolutionen anschloss. Um fruchtbar zu werden, muss diese Melancholie jedoch anerkannt und akzeptiert werden, und die üblichen Strategien der Umschiffung, die klassische List der Verdrängung sind dabei zu vermeiden. Es gab eine Zeit, während derer die Erstürmung des Himmels als beste Form erschien, die Trauer über die verlorenen Genoss*innen zu tragen. Diese Zeit ist vorbei, der sublimierte Schmerz durch die Steigerung des Kampfes ist nicht mehr oder noch nicht auf der Tagesordnung.
In dieser bekannten wie auch ›unbekannten‹ Vergangenheit, die gelebt, übermittelt, dann verdrängt und schließlich den neuen Generationen fremd wurde, vermischen sich die intellektuellen Debatten mit den weniger formalisierten kulturellen Erfahrungen. Die Spuren dieser linken Melancholie sind in den verschiedenen Äußerungen der revolutionären Vorstellung leichter erkennbar als in den doktrinären Produktionen und theoretischen Kontroversen. Letztere verweisen auf mehrere verborgene Bedeutungsschichten, wenn sie über das kollektive Imaginäre, das sie begleitet, neu interpretiert werden. Deshalb schwankt dieser Essay ständig ohne Hierarchie zwischen Konzepten und Bildern hin und her, die beide als gleich bedeutend betrachtet werden, um die linke Kultur zu definieren und auszudrücken. Er führt sie zusammen und begreift ihre gegenseitige Resonanz, zeigt, was eine Anzahl klassischer Werke mit der Malerei, der Fotografie und dem Film gemeinsam haben. Er stützt sich auf unterschiedliche Quellen, die man mit Walter Benjamin als Denkbilder bezeichnen könnte. Es geht nicht darum, ein Monument zu errichten oder ein Epitaph zu verfassen, sondern eine vielgestaltige Erinnerungslandschaft voller Kontraste zu erforschen. Im Unterschied zum dominanten humanitären Diskurs, der der Erinnerung an die Opfer einen sakralen Charakter verleiht, indem er ihre Aktivitäten ignoriert oder ablehnt, wirft die revolutionäre Melancholie ihren Blick auf die Besiegten. Sie betrachtet die mit den verlorenen Schlachten verknüpften Tragödien als Last und eine Schuld, die auch das Versprechen einer Wiedergutmachung in sich tragen.
Diese melancholische Konstellation wird hier unter verschiedenen Gesichtspunkten untersucht: indem die Züge einer Kultur der Niederlage skizziert werden, indem die marxistische Konzeption der Erinnerung rekonstituiert wird und in schriftlichen und bildlichen Zeugnissen der Trauer. Dieses Buch konzentriert sich auf Figuren, die wie Karl Marx bis Walter Benjamin über Gustave Courbet und Leo Trotzki diese linke Melancholie verkörpern. Es erwähnt fruchtbare, konfliktgeladene, verspätete oder verpasste Begegnungen zwischen marxistischen Denker*innen, indem ihre unterschiedlich eingeschlagenen Wege der Melancholie aufgezeigt werden. Die marxistische und die postkoloniale Melancholie – entstanden aus den gescheiterten kolonialen Revolutionen – zeugen von einer schwierigen Allianz, mal bestehend aus tiefem Unverständnis, mal aus tiefen Unterschieden, besiegelt von den verratenen Versprechen des Kommunismus und der Dekolonialisierung. Belebend dagegen war die posthume Begegnung zwischen Daniel Bensaïd und Walter Benjamin, möglich geworden durch die Resonanz zwischen zwei bedeutenden Wendepunkten des 20. Jahrhunderts: 1939 und 1989. In der Tat wurde in den Revolten der Sechziger- und Siebzigerjahre nach dem Fall der Berliner Mauer eine Geschichtskonzeption entdeckt, die aus den Niederlagen der Dreißigerjahre entstanden war, beladen mit einer Melancholie, die wieder aktuell wurde und die stark in die Gegenwart hineinwirkt.
***
Die linke Melancholie ist nicht neu. Sie tauchte nicht zu Beginn des 21. Jahrhunderts plötzlich auf wie etwas Unerwartetes, das zu entziffern, zu begrüßen oder zu bedauern ist. Sie ist keine linke Krankheit – eine pathologische Trauer – wie eine oberflächliche Anwendung Freud’scher Kategorien nahelegen könnte. Der historische Wendepunkt von 1989 hat sie schlicht zutage gebracht, nicht erfunden. Die linke Melancholie hat schon immer existiert, diskret, schamhaft, oft unterirdisch, in den meisten Fällen aus den offiziellen Diskursen verbannt, zensiert von der Propaganda und immer ohne sich preiszugeben. Ich habe sie als eine »verborgene Tradition« bezeichnet, indem ich diese Definition von Hannah Arendt übernahm. 1944 definierte sie die Geschichte des Judaismus als »Paria«, nicht zurückführbar auf einen religiösen oder politischen Konformismus, unbeugsam auch gegenüber der Synagoge oder der etablierten Macht. In ihren Augen waren die besten Repräsentanten dieser Tradition Heinrich Heine und Bernard Lazare, zwei häretische Juden, Charlie Chaplin, ein Künstler, der die Figur des Schlehmil ins Kino einführte, Vagabund und Marginalisierter, und Franz Kafka, unklassifizierbarer und gequälter Schriftsteller.[4] Nach Art dieser »verborgenen Tradition« gehört die linke Melancholie nicht zum Kanon von Sozialismus und Kommunismus. Sie teilt fast nichts mit der glorreichen Epoche, in den meisten Fällen illusorisch und falsch, der Triumphe und großen Eroberungen, der wehenden Fahnen, der verehrten Held*innen, des Vertrauens in die Zukunft. Sie schreibt sich eher in die Tradition der Niederlagen ein, die – Rosa Luxemburg hat daran kurz vor ihrem Tod erinnert – die Revolutionsgeschichte kennzeichneten. Es ist die Melancholie von Blanqui und Louise Michel nach der blutigen Repression der Pariser Commune; von Rosa Luxemburg, die in ihrem Gefängnis in Wronke, über das Blutbad des Ersten Weltkrieges meditierte und über die Kapitulation des deutschen Sozialismus; von Gramsci, der in einem faschistischen Gefängnis das Verhältnis zwischen »Stellungskrieg« und »Bewegungskrieg« nach dem Scheitern der europäischen Revolutionen überdachte; von Trotzki in seinem letzten mexikanischen Exil, eingeschlossen hinter den Mauern eines bunkerähnlichen Hauses in Coyoacan; von Walter Benjamin, der im Pariser Exil, die Geschichte vom Standpunkt der »geknechteten Vorfahren« erforschte; von C.L.R. James, der auf Ellis Island, wo er in Quarantäne war, über Melville schrieb – enemy alien in den Vereinigten Staaten des Mccarthyismus; der indonesischen Kommunist*innen, die das große Massaker von 1965 überlebten; von Che Guevara in den Bergen Boliviens, sich bewusst, dass der kubanische Weg in eine Sackgasse geraten war.
Dieses Buch versucht, dieser verborgenen Tradition ein Gesicht zu verleihen, einige prägende Momente zu erfassen und die wichtigsten Interpreten in der Theorie wie in der Malerei und im Film zu nennen. Die Traurigkeit und die Trauer, das überwältigende Gefühl des Scheiterns, der verlorenen Freund*innen und Genoss*innen, der verpassten Gelegenheiten, der zerstörten Errungenschaften, des gestohlenen Glücks haben die Geschichte des Sozialismus von Anfang an begleitet, wie das dialektische Double der revolutionären Ekstase, in der alles möglich wird, wenn man die Freude empfindet, gemeinsam zu agieren, und die Erfüllung der kollektiven Aktion, wenn man den Eindruck hat, im Himmel zu schweben, von aller Schwere befreit und in der Lage zu sein, der Geschichte einen Sinn zu verleihen. Diese linke Melancholie wurde verborgen, verdrängt oder sublimiert durch die Repräsentationen, die sie überragten, indem sie das Bild einer befreiten Zukunft zeichneten. So durchläuft sie die Geschichte der revolutionären Bewegungen wie ein unterirdischer Fluss, wie eine starke aber unsichtbare Flut, ausgetrieben oder neutralisiert durch erbauliche beruhigende Erzählungen. Walter Benjamin zitierend, könnte man sagen, dass die linke Kultur von Melancholie geprägt ist, wie ein Löschblatt vollgesaugt ist mit Tinte: »Ginge es aber nach dem Löschblatt, so würde nichts, was geschrieben ist, übrig bleiben.«[5] Es ist dieser verborgene Text, dieses intellektuelle Substrat aus Emotionen und Erinnerung, den dieses Buch vorschlägt, an die Oberfläche zu bringen.
***
Das Ende des Kommunismus rief eine Welle an Enthusiasmus hervor und während eines kurzen Augenblicks auch die Hoffnung auf einen authentisch demokratischen Sozialismus. Sehr schnell jedoch wurde klar, dass die ganze Repräsentation des 20. Jahrhunderts einstürzt. Alle linken Strömungen waren beunruhigt, darunter eine große Anzahl antistalinistischer Bewegungen. Christa Wolf, die berühmteste dissidente Schriftstellerin der DDR beschrieb dieses seltsame Gefühl in ihrem autobiografischen Bericht Stadt der Engel: Sie hatte den Eindruck »schutzlos« geworden zu sein, exiliert aus einem Land, das aufgehört hatte zu existieren.[6] Neben der offiziellen ›monumentalen‹, bereits diskreditierten Geschichte des Kommunismus gab es eine andere, geboren mit der Oktoberrevolution, in der mehrere andere Ereignisse sich natürlich eingeschrieben haben, vom Spanischen Bürgerkrieg bis zum Mai 1968. Diese andere Geschichte vermittelte das Bild eines Jahrhunderts, dominiert durch die symbiotische Verbindung zwischen Revolution und Barbarei, immer bereit, entweder auf die eine oder andere Seite zu kippen. Aber der Schock vom November 1989 hat diese Erzählung ausgelöscht und unter den Trümmern der Berliner Mauer begraben. Die Dialektik des 20. Jahrhunderts war auf einmal zerbrochen. Statt neue Energien freizusetzen, hat das Ende des Staatssozialismus die Umlaufbahn des Sozialismus selbst erschöpft. Die ganze Geschichte des Kommunismus wurde auf seine totalitäre Dimension reduziert und unter dieser Form erschien sie wie eine kollektive und übertragbare Erinnerung, bis sie zu einer geteilten Repräsentation, zur Doxa des Beginns des 21. Jahrhunderts, mutierte. Sicher ist die antikommunistische Erzählung der Revolution nicht neu, sie existierte mindestens seit 1917, aber sie verwandelte sich in ein geteiltes historisches Bewusstsein, in eine herrschende und unwidersprochene Repräsentation. Nachdem er auf der Bühne des Jahrhunderts wie ein Versprechen der Befreiung erschien, verlässt der Kommunismus sie als ein Symbol der Entfremdung und Unterdrückung. Die Bilder der Demolierung der Berliner Mauer erschienen wie ein umgekehrter Ablauf von Oktober, dem Meisterwerk Eisensteins: der Film der Revolution wurde definitiv wieder zurückgespult. Als der Realsozialismus zusammenbrach, war die kommunistische Hoffnung bereits erschöpft. 1989 haben sich die beiden überlagert und ihr Zusammenstoß erschuf ein gemeinsames Narrativ, das die Geschichte der Revolution unter die Kategorie des Totalitarismus subsumierte. So wurde die konservative Historiografie des Kommunismus – deren emblematischer Ausdruck François Furet darstellt[7] – kanonisiert.
Im Herbst 1989 schienen die ›samtenen Revolutionen‹ eine Rückkehr zu 1789 zu markieren, indem sie zwei Jahrhunderte Kampf für den Sozialismus übergingen. Die Freiheit und die demokratische Repräsentation schienen ihr einziger Horizont zu sein, in Einverständnis mit dem klassischen Modell des Liberalismus: 1789 gegen 1793 und 1917, oder auch 1776 gegen 1789–1793: Freiheit gegen Gleichheit.[8] Revolutionen produzierten immer Utopien und neue Ideen. Sie haben immer Hoffnungen geweckt, neue Horizonte definiert und die Zukunft aufgebaut. Die ›samtenen Revolutionen‹ sind die Ausnahme der Regel. Gleichsam haben sie nichts erfunden; sie sehnten sich vielmehr nach ihrer nationalen Vergangenheit – hartnäckig ›wiederangeeignet‹ nach einigen Jahrzehnten sowjetischer Beschlagnahmung – als nach ihrer Zukunft, die sie den Kräften des westlichen Marktes anvertrauten. Ein Dramaturg und Kritiker wie Vaclav Havel, der zu Zeiten der Dissidenz der Charta 77 Bewunderung erheischte, wird zur blassen Kopie eines westlichen Staatsmannes, nachdem er zum Präsidenten der Tschechischen Republik gewählt wurde.[9] Die ostdeutsche Kultur bewies einen außergewöhnlichen Reichtum, als sie unter der erdrückenden Kontrolle der Stasi in allegorischen und vielsagenden Werken eine Kritik der Macht produzierte, die zwischen den Zeilen stand. Heute ist sie energielos. In Polen entstand nach der Wende 1989 eine nationalistische Welle, der sich kein Jacek Kuron, Krystof Kieslowski oder Zygmunt Bauman entziehen konnte … Statt sich in die Zukunft zu projizieren, haben diese Revolutionen Gesellschaften hervorgebracht, die von der Vergangenheit besessen sind. Überall in Osteuropa entstanden Museen und patrimoniale Institutionen, die auf die Wiederaneignung einer durch den sowjetischen Sozialismus gekidnappten Vergangenheit zielen.[10]
2011 wirbelte eine neue revolutionäre Welle die arabische Welt auf und stürzte die Diktaturen in Tunesien und Ägypten, bevor bis sie in der libyschen Wüste und im jemenitischen und syrischen Bürgerkrieg versandete. Diese Flutwelle, die noch nicht erloschen ist, war mächtig und voller Hoffnung. Gleichwohl wussten diejenigen, die sich gegen die Diktaturen von Ben Ali und Moubarak auflehnten und diese absetzten, nicht recht, wie und durch was sie zu ersetzen sind. Alle vergangenen Modelle, vom Nationalismus zum Panarabismus, vom Islamismus zum Sozialismus waren diskreditiert. Die Grenzen dieser Revolutionen sind die unserer Epoche. Sie sind die Frucht der Niederlage der Revolutionen des 20. Jahrhunderts, die den Aufständischen der ganzen Welt eine schwere Last aufbürdeten. Die Aufstände im Frühjahr 2011 hatten weder ein Modell noch einen Horizont: sie konnten sich weder durch die Vergangenheit inspirieren lassen, noch sich die Zukunft vorstellen, für die sie kämpften.
Auch der Feminismus ging nicht unbeschädigt aus dieser historischen Mutation hervor. Auch wenn er mehrere Axiome des klassischen Sozialismus infrage gestellt hatte – vor allem seinen ›genderspezifischen‹ Universalismus implizit mit einer ›männlichen‹ Vision der Geschichte und Handlungsfähigkeit (agency) identifiziert –, teilte er mit ihm eine Konzeption der Emanzipation, die auf die Zukunft gerichtet war. Der Feminismus betrachtete die Revolution als einen globalen Befreiungsprozess, der über die Klassen hinausgeht und die Genderbeziehungen wie die Formen der sozialen Organisation vollkommen neu konfiguriert. Er hat den Kommunismus als egalitäre Gesellschaft neu definiert, in dem nicht nur die Klassenausbeutung und die sexuellen Hierarchien abgeschafft wären, sondern die Gleichheit auch die Anerkennung der Differenzen in Bezug auf Gender impliziert.[11] Seine utopische Imagination kündete von einer Welt, in der das Geschlecht, die sexuelle Arbeitsteilung und die Beziehungen zwischen öffentlich und privat vollkommen neu definiert würden. Im Umfeld des Feminismus wollte die sozialistische Revolution auch eine sexuelle Revolution sein, das Ende der Entfremdung des Körpers und der Befriedigung unterdrückter Bedürfnisse. Der Sozialismus bedeutete nicht nur eine radikale Veränderung der Strukturen, sondern auch die Erfindung neuer Lebensformen. Die feministischen Kämpfe wurden häufig als emanzipatorische Erfahrungen erlebt, die die Zukunft vorwegnehmen und eine befreite Gemeinschaft andeuten. In der kapitalistischen Gesellschaft fordern sie gleiche Rechte und die Anerkennung der Genderdifferenzen; innerhalb der Linken kritisieren sie das männliche Paradigma, verantwortlich für die militaristische Konzeption der Revolution, das vom Kommunismus der Zwanzigerjahre geerbt wurde; in der Frauenbewegung bildeten sie neue Subjektivitäten heraus.
Aber dieses Ensemble an Praktiken und Erfahrungen scheint in Vergessenheit geraten zu sein nach dem Ende des Kommunismus, der ›geliebten/gehassten‹ Alliierten. Die Erschöpfung der Kämpfe und feministischen Utopien, die die Wende von 1989 begleitet haben, produzierte ihre eigene Melancholie. Wie die Linke – und innerhalb – der Linken unternahm der Feminismus seine eigene Trauerarbeit und kombinierte den verpufften Traum einer befreiten Zukunft und die Erschöpfung der transformierenden Erfahrungen der Vergangenheit. Heute proklamieren die liberale Demokratie und die Marktgesellschaft ihren Triumph mit der Verwirklichung der juristischen Gleichheit und der individuellen Selbsterfüllung. Das Ende des sozialistischen Feminismus, der mit dem Aufschwung der Gender Studies zusammentraf, hat eine Bandbreite an regressiven Identitätspolitiken hervorgebracht. Auch wenn der veränderte Blick der Gender Studies sich als sehr fruchtbar erwies, manifestierten die Identitätspolitiken eine starke Neigung, die Begriffe von Geschlecht und Race als Marker einer historischen Unterdrückung zu betrachten, gegen die zu kämpfen ist, um sie in unveränderbare und verdinglichte Kategorien zu transformieren – Rosi Braidotti bezeichnet sie als »metaphysisch«[12] –, die in letzter Instanz zu einer verdinglichten Anerkennung der Differenz führen. Wendy Brown zufolge wird Gender als etwas betrachtet, das »gebeugt, zerstreut, gestört, umgedeutet, mutiert, inszeniert, parodiert, gespreizt, entgegengesetzt, imitiert, reguliert …, aber nicht emanzipiert«[13] werden kann.
Der marxistische Philosoph Ernst Bloch unterschied zwischen trügerischen, prometheischen Träumen, die eine Gesellschaft heimsuchen, die historisch nicht in der Lage ist, sie zu realisieren (die abstrakten, visionären Utopien, wie die in der Renaissance ausgedachten fliegenden Objekte), und den zukunftsorientierten Hoffnungen, die revolutionäre Transformationen in der Gegenwart inspirieren (die konkreten Utopien wie der Sozialismus im 19. und 20. Jahrhundert). Heute können wir leicht das Erlöschen der einen und die Metamorphose der anderen beobachten. Einerseits unter unterschiedlichen Formen wie der Science-Fiction oder Ökologie haben dystopische Visionen einer grauenhaften Zukunft den Traum einer befreiten Menschheit ersetzt und das soziale Imaginäre ins Innere beengter Grenzen verlagert. Andererseits sind die konkreten Utopien der kollektiven Emanzipation hauptsächlich zu individuellen Impulsen geworden, die den unerschöpflichen Prozess des Warenkonsums alimentieren. Nachdem die ›warmen Strömungen‹ der befreienden Massenaktion verabschiedet wurden, führte der Neoliberalismus die ›kalte Strömung‹ der ökonomischen Vernunft ein. Die Utopien wurden durch ihre Privatisierung in einer verdinglichten Welt zerstört.[14]
Reinhart Koselleck zufolge ist es die Gegenwart, die der Vergangenheit Sinn verleiht. Gleichzeitig bietet sie den Akteuren der Geschichte ein Reservoir an Erinnerungen und Erfahrungen, die es ihnen ermöglicht, ihre Erwartungen zu formulieren. Anders ausgedrückt, interagieren Vergangenheit und Zukunft, geeint durch eine symbiotische Verbindung.[15] Die Utopie scheint eine Kategorie der Vergangenheit geworden zu sein – die imaginierte Zukunft einer längst vergangenen Zeit –, denn sie hat die Gegenwart verlassen. Die Geschichte erscheint als Erbe des Leids, der immer noch offenen Wunden. Bestimmte Historiker*innen, vor allem François Hartog, bezeichnen das Regime der Geschichtlichkeit, das 1990 auf den Plan trat, als »Präsentismus«: eine ausgedehnte Gegenwart, die sowohl die Vergangenheit wie die Zukunft absorbiert und in sich auflöst.[16] Der »Präsentismus« hat eine doppelte Dimension. Er ist die durch die Kulturindustrie verdinglichte Vergangenheit, die jegliche vermittelte Erfahrung zerstört und auch die Zukunft durch die neoliberale Zeitlichkeit abschafft: nicht nur die »Tyrannei der Uhren«, beschrieben von Norbert Elias, sondern die Diktatur der Börse, eine durch eine ständige Beschleunigung gekennzeichnete Temporalität, aber jeglicher »prognostischen Struktur« entbehrend, um die Worte von Koselleck wieder aufzunehmen.[17]
Es ist 25 Jahre her, als das Ende des Realsozialismus auf gewisse Art die utopische Imagination untersagte, indem es den vorübergehenden Erfolg einer eschatologischen Vision des Kapitalismus als ›unüberschreitbaren Horizont‹ der menschlichen Gesellschaften aufwarf.[18] Der Kapitalismus soll die beste aller zukünftigen Welten absichern. Er wurde, nach der Definition von Walter Benjamin, eine ›Religion‹, die Religion des Geldes, der wichtigste säkulare Glauben unserer Epoche.[19] Wie der Philosoph Giorgio Agamben mahnt, besitzt das Wort ›Bank‹ (Kreditinstitut, trapeza tes pisteos) auf griechisch dieselbe Etymologie wie das Wort ›Glauben‹ (pistis).[20] Heute ist diese Religion in eine Krise geraten und erzeugt keine Illusionen mehr: den Banken das Schicksal der Menschheit anzuvertrauen, beruhigt nicht; im Gegenteil, es beunruhigt. Seit der Krise von 2008 hat der Neoliberalismus sicherlich sein hässliches Gesicht gezeigt, aber er ist nicht zusammengebrochen. Er hat sich sogar radikalisiert: keine neue befreiende Utopie hat bislang das Tageslicht erblickt. Die Idee eines anderen Gesellschaftsmodells, ja einer Zivilisation, bleibt undenkbar.
Das 21. Jahrhundert hat uns also eine neue Form der Desillusionierung beschert. Nach der »Entzauberung der Welt«, von Max Weber vor einem Jahrhundert beschrieben – die Moderne als unmenschliches Zeitalter der instrumentellen Vernunft –, haben wir eine zweite Entzauberung erlebt, entstanden aus dem Scheitern ihrer Alternativen. Diese historische Sackgasse ist das Produkt einer blockierten Dialektik: anstelle der »Negation der Negation« – die sozialistische Überschreitung des Kapitalismus nach der Hegel’schen und marxistischen Idee der Aufhebung – haben wir der Stärkung und Ausdehnung des Kapitalismus beigewohnt und der Ausschaltung seiner Feinde. Die Hoffnung in das menschliche Werden – was Ernst Bloch das Noch-Nicht nannte, zieht sich in einer unendlichen Gegenwart zusammen.[21]
***
Für die radikale Linke der Sechziger- und Siebzigerjahre war die Weltrevolution ein Prozess, der sich auf drei geografisch unterschiedliche Gebiete erstreckte, die aber dialektisch korrelierten. Sie war antikapitalistisch in den westlichen Ländern, antibürokratisch in denen des ›Realsozialismus‹ und antiimperialistisch in der Dritten Welt.[22] Während mehr als 15 Jahren, zwischen der Kubanischen Revolution (1959) und dem Ende des Vietnamkrieges (1975), erschien diese Vision nicht als ein abstraktes oder doktrinäres Schema, sondern als objektive Beschreibung der Realität. In Europa war der Mai 1968 der Höhepunkt einer Welle der politischen Radikalisierung, die mehrere Länder der westlichen Welt betraf, von Italien des heißen Herbstes bis zur Portugiesischen Revolution. In der Tschechoslowakei hat der Prager Frühling offen die sowjetische Herrschaft herausgefordert und drohte, sich auf andere Länder des ›Realsozialismus‹ auszudehnen. In Lateinamerika folgten mehrere Guerillabewegungen – in den meisten Fällen mit tragischen Konsequenzen – dem kubanischen Beispiel. Zumindest bis zu den Militärputschen des General Pinochet in Chile (1973) und von Jorge Videla in Argentinien (1975) wurde der Sozialismus als eine Option wahrgenommen, die auf der Tagesordnung steht, und nicht als nebulöser Traum einer weit entfernten Zukunft. In Asien haben die vietnamesischen Kämpfer*innen der imperialen amerikanischen Dominanz eine historische Niederlage versetzt. Das Gefühl einer Gemeinsamkeit zwischen diesen Wellen der Revolte hat die Jugend auf der ganzen Welt dazu gebracht, die politischen Ideen wie die Praktiken grundlegend zu transformieren. Wahrscheinlich zum ersten Mal in der Geschichte entstand auf einer globalen Ebene – und über die Ideologien hinweg – eine revolutionäre Kultur, die sich in Romanen, Filmen, Liedern, Frisuren oder Kleidungsstilen ausdrückte.
Während dieser street fighting years, wie sie Tariq Ali[23], einer der Protagonisten in Großbritannien, definiert hat, war die Erinnerung kein Kultobjekt; sie war eher in die Kämpfe integriert. In Frankreich spielte die Erinnerung an Auschwitz eine bedeutende Rolle im antikolonialen Engagement zahlreicher Intellektueller und Aktivist*innen. Während des Vietnamkrieges war der Nürnberger Prozess eine Art Paradigma für das Russell Tribunal, das 1967 eine große Anzahl Intellektueller in Stockholm versammelte, um die amerikanischen Kriegsverbrechen zu kritisieren. Jean-Paul Sartre, Noam Chomsky, Isaac Deutscher, Herbert Marcuse und Peter Weiss schrieben ihr Engagement in den antifaschistischen Kampf der Dreißiger- und Vierzigerjahre ein. Für die Bewegung gegen den Krieg war der Vergleich zwischen der Gewalt der Nazis und der des amerikanischen Imperialismus ein Gemeinplatz.[24] Die Erinnerung an die Naziverbrechen diente nicht dazu, den Opfern der Vergangenheit zu gedenken, sondern um die Ungerechtigkeiten der Gegenwart zu bekämpfen. Während des internationalen Treffens von Stockholm unter der Schirmherrschaft des Russell Tribunals bezeichnete Sartre die Antiguerillaoperationen als »totalen Genozid« und Günter Anders, deutsch-jüdischer Philosoph und Kritiker der Industriegesellschaft, plädierte dafür, das Tribunal nach Krakau zu verlegen, wenn möglich direkt nach Auschwitz, um ihm eine stärkere symbolische Bedeutung zu verleihen.[25] In den westlichen Ländern wie in der Dritten Welt wurde die Erinnerung nur in Bezug auf ein politisches Engagement in der Gegenwart gepflegt. Wie Michael Rothberg vergegenwärtigt, indem er Aimé Césaire zitiert, musste sie »im Gegenzug einen Schock«[26] produzieren. In Europa haben sich die antiimperialistischen Kämpfe in die Kontinuität der Widerstandsbewegungen gegen den Nazismus eingeschrieben; im Süden wurde dieser als eine Form des radikalen Imperialismus wahrgenommen – so präsentiert ihn zum Beispiel Aimé Césaire in Über den Kolonialismus.
Diese kräftige Woge hat sich in den Achtzigerjahren erschöpft. Ihr Epilog war die nicaraguanische Revolution im Juli 1979, die mit der traumatischen Entdeckung der kambodschanischen Massengräber zusammentraf. In Europa besetzte die Shoah nach und nach das kollektive Gedächtnis. Der Antifaschismus begann in den offiziellen Gedenkfeiern marginalisiert zu werden, von nun an der Erinnerung an die Opfer reserviert. Die Erinnerung an die Kämpfe hat den Platz den Zeugnissen und Gedenkfeiern überlassen, die die Menschenrechte zelebrieren. In Frankreich wurde der Mai 1968 mehr und mehr unter dem Aspekt der ›kulturellen Mutation‹ interpretiert, als Karneval, in dem die Jugend eine Komödie spielte und die Gesellschaft des Gaullismus zum Liberalismus kippte.[27] In Italien und Deutschland sind die Siebzigerjahre zu einer »bleiernen Zeit« geworden, im Laufe derer die Revolte einer ganzen Generation auf den Terrorismus reduziert wurde.[28] In Deutschland wurde es üblich, den Linksradikalismus mit der Hitlerjugend[29] zu vergleichen. Die Verdrängung der Jahre der Kämpfe, ersetzt durch das Bild einer ›liberal-libertären‹ Jugend, angezogen von einer neuen Form des individualistischen Hedonismus, diente einer Generation, die ihre vergangenen Erfahrungen aufgab, um Posten in Regierungen, Medien, Unternehmen usw. zu übernehmen. Im öffentlichen Raum hinterließ das Verschwinden der Kämpfe den Platz für die Jahrestage der Genozide. Nach dem Schiffbruch der Weltrevolution sind die drei Bereiche des Einsatzes Erinnerungsorte für die Opfer geworden: der Westen wird heimgesucht von den Gedenktagen an die Shoah; Osteuropa von der Erinnerung an den Realsozialismus; der Süden vom Vermächtnis der Sklaverei. Der Antifaschismus, die Kämpfe für einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz und der antikoloniale Kampf wurden verdrängt vom Trauern um die Opfer.[30]
***
1959 stigmatisierte Theodor W. Adorno die Amnesie, die von einem scheinheiligen Gebrauch des Begriffs »Aufarbeitung der Vergangenheit« profitierte, die Westdeutschland und Europa befiel. Diese »höchst verdächtige« Formulierung, erklärte er, bedeute nicht, dass »man das Vergangene im Ernst verarbeite, seinen Bann breche und helles Bewusstsein«. Im Gegenteil, es bedeutet, »einen Schlussstrich darunter ziehen und womöglich es selbst aus der Erinnerung wegwischen«.[31] Heute mit fast einem halben Jahrhundert Distanz besetzt die Shoah einen zentralen Platz in der europäischen Erinnerung, aber die Diagnose Adornos bleibt aktuell. Heute trifft eine vergleichbare Analyse unsere Gesellschaften und unsere Kultur, in denen vollständige Bestandteile der Vergangenheit – der Antifaschismus, der Antikolonialismus, der Feminismus, der Sozialismus und die Revolution – verschwunden scheinen, unangebracht, ja peinlich für die herrschende Rhetorik der ›Erinnerungspflicht‹.
In dieser trostlosen Landschaft ist das Erbe der Befreiungskämpfe fast unsichtbar geworden, denn es überlebt nur noch in einer spektralen Form. Wie es die Psychoanalyse erklärt, suchen die Geister die Erinnerung der Erfahrungen heim, die für abgeschlossen, vollendet und archiviert gehalten werden. Sie nisten sich in unseren Köpfen ein wie Figuren, die aus der Vergangenheit auftauchen, als wirklichkeitsfremde Widergänger, von unserem körperlichen Leben getrennt. Eine Typologie der Geister skizzierend, zieht Giorgio Agamben die Aufmerksamkeit auf eine besondere Gattung an Gespenstern, die »man als larval oder larviert bezeichnen könnte«: »Diese Larven führen kein Eigenleben. Beharrlich suchen sie die Menschen heim, deren schlechtem Gewissen sie entspringen.«[32] Der Stalinismus hat diese Gattung an »verlarvten« Geistern produziert. Im Unterschied zu anderen Epochen der Restauration, wie Frankreich nach dem Juni 1848 oder nach der Pariser Commune, konnte die durch die Wende von 1989 eröffnete Restauration den Besiegten nur die Erinnerung eines verzerrten Sozialismus bieten, die totalitäre Karikatur einer emanzipierten Gesellschaft. Nicht nur die ›prognostizierte‹ Erinnerung des Sozialismus – die dazu dient, sich in die Zukunft zu projizieren –blieb paralysiert, sondern sogar selbst die Trauer über die erlittene Niederlage wurde zensiert. Die Opfer der Gewalt und der Genozide besetzen die erste Reihe der öffentlichen Erinnerung, während die revolutionären Erfahrungen unseren Repräsentationen des 20. Jahrhunderts in der spektralen Form innewohnen. Besiegt, kannten ihre Akteure keine Ablösung. Sie sind nur noch Phantome, die eine »werdende« Präsenz ankünden, wie diejenigen, die Edmund Burke 1790 erschreckten und Marx und Engels 1847 Hoffnung machten, sie verweisen auf die Beharrlichkeit einer »Fortdauer einer vergangenen Gegenwart […], die Wiederkehr eines Toten, das Wiedererscheinen eines Phantoms, dessen die weltweite Trauerarbeit sich nicht zu entledigen vermag«.[33] Die Phantome, die Europa heute heimsuchen, sind nicht die Revolutionen der Zukunft, sondern die niedergeschlagenen Revolutionen der Vergangenheit.
Wir können uns immer trösten, wenn wir konstatieren, dass die Revolutionen »niemals pünktlich sind«[34], dass sie dann stattfinden, wenn wir sie nicht erwarten. Der Schriftsteller Erri De Luca hat vor einigen Jahren einen Skandal hervorgerufen, als er das Erbe der turbulenten Siebzigerjahre mit dem tragischen Schicksal von Eurydike, der Nymphe der Gerechtigkeit in der griechischen Mythologie verglich. Orpheus, der sich nicht mit dem frühen Tod seiner Geliebten abfinden wollte, ist in den Hades hinabgestiegen, das Reich der Toten, um sie zum Leben zurückzubringen, aber sein Versuch blieb vergeblich.[35] In seiner Allegorie beschreibt De Luca die Siebzigerjahre als von einem »kollektiven Orpheus« bevölkert, der sich in die Gerechtigkeit verliebt, die Waffen aufnimmt, um sie zu erobern. Und wie Orpheus sind die Revolutionäre des 20. Jahrhunderts gescheitert, nachdem sie den Sieg gestreift haben. Als Orpheus seinen Blick erhob, war Eurydike verschwunden; wie am Ende eines Zyklus weltweiter Kämpfe die Rebellen allein waren. Es ist bezeichnend, dass im Unterschied zu Marx De Luca die Revolution nicht mit der Erstürmung des Himmels, sondern eher mit dem Abstieg in die Unterwelt der Toten vergleicht. Die Erstürmung des Himmels und die Reise in den Hades sind die zwei Pole des weiter oben beschriebenen Übergangs von der Utopie zur Erinnerung, von der Zukunft zur Vergangenheit. Die linke Melancholie bedeutet nicht die Aufgabe der sozialistischen Idee oder der Hoffnung auf eine bessere Welt; sie impliziert jedoch, den Sozialismus neu zu denken in einer Epoche, in der seine Erinnerung verloren ist, verdeckt, still, und danach fragt, erlöst zu werden. Diese Melancholie darf sich nicht darauf beschränken, über eine verlorene Utopie zu weinen; sie muss sich daranmachen, sie neu zu konstruieren. Sie könnte fruchtbar sein, könnte man mit Judith Butler sagen, wenn sie als eine »verwandelnde Wirkung des Verlusts«[36] agiert.
Ein vielsagendes Beispiel einer bereichernden Trauerarbeit, die statt die Aktion zu paralysieren, sie in einem bewussten und selbstreflexiven Sinn stimuliert, ist die der schwulen Aktivisten gegenüber den vernichtenden Konsequenzen von Aids, einer Pandemie, die dem Ende des Kommunismus kurz vorausging. 1989 beobachtete Douglas Crimp, dass dieses Trauma, statt Passivität entstehen zu lassen und einen Rückzug in die Privatsphäre und das Leiden zu verursachen, eine neue Welle an Aktivismus hervorgebracht hat, gezeichnet von Trauer, die ihre Kraft aus der Melancholie und dem Kummer zieht. Für viele schwule Aktivisten, die von einem Gefühl des Verlustes heimgesucht wurden, die Angst hatten, selbst zum Tod verurteilt zu sein und das Schicksal derer zu teilen, die sie beweinten, war diese Melancholie Ansporn zur Aktion. Eine große Anzahl von Opfern war jung, und die Überlebenden fühlten sich allein, ohnmächtig, ihre besten Freunde und Geliebten waren verschwunden. Ihr Leben veränderte sich radikal. Eine zerstörte Gemeinschaft musste neu begründet werden, die Freundschaft, die Freude und selbst die sexuellen Praktiken neu erfunden werden. Mit dem erschlagenden Gefühl, unter einer Drohung zu leben, wurden sie mit Misstrauen beäugt und waren umgeben von Feindschaft. Viele unter ihnen, vor Angst paralysiert, verinnerlichten das Stigma, das sie mit einem Schuldgefühl traf, mit einer Todessehnsucht, die sich in Selbsthass verwandelte. Der schwule Aktivismus, der auf diese Todessehnsucht in diesen tragischen Umständen zu reagieren wusste, war untrennbar mit Trauer verbunden. Diese Melancholie war keine Flucht; sie rief eine fruchtbare Arbeit der Rekonstruktion hervor, aus medizinischer Pflege, psychologischer Unterstützung, der Verteidigung der Rechte und dem Entstehen eines neuen Netzwerkes. Act Up war das Produkt dieser Melancholie, die notwendigerweise eine politische Dimension annahm. Douglas Crimp hat den Sinn dieser Erfahrung durch eine Formulierung zusammengefasst, die den Geist dieses Buches auf den Punkt bringt: »Lasst uns aktiv sein, aber auch unserer Trauer nachgehen: Trauer und Aktivismus (mourning and militancy).«[37]
1. KapitelDie Melancholie der Besiegten
Die linke Melancholie kann verschiedene Formen annehmen wie das Zusammentragen individueller Erinnerungen am Ende eines kämpferischen Lebens – gepaart mit dem Bedauern über die verpassten Gelegenheiten – oder die Trauer, die sich bei den Feierlichkeiten der vergangenen Kämpfe in Revolte transformiert. Ihr am weitesten verbreitetes Gesicht jedoch bleibt die Niederlage. Es ist das Scheitern, immer schmerzhaft, oft blutig, manchmal von historischem Ausmaß – das heißt fähig, die als unumkehrbar betrachteten Errungenschaften auszulöschen, die Kräfteverhältnisse zu ändern, Projekte und Träume zu zerstören, existenzielle Lebenswege zu modifizieren –, das eine tiefe Melancholie bei den Besiegten auslöst. Diese Melancholie hat nichts mit Reue zu tun; sie ist bedingt durch die Schwere der Niederlage und des Verlustes und nimmt oft die Form des Exils an.
Schiffbruch mit Zuschauer
Die Geschichte des Sozialismus bildet eine Konstellation an Niederlagen, die sich während fast zwei Jahrhunderten entwickelt hat. Statt seine Ideen und sein Bestreben zu zerstören, haben seine tragischen und oft blutigen Debakel den Sozialismus konsolidiert und legitimiert. Zu fallen, nachdem man gekämpft hat, verleiht dem Besiegten ein Gefühl von Würde und kann seine Überzeugungen sogar stärken. Die exilierten und verbannten Revolutionär*innen kannten oft Elend und Entbehrungen, den Schmerz des Verlustes, waren aber selten innerhalb ihres Umfeldes isoliert. Von Heinrich Heine, Karl Marx und Alexander Herzen im Paris des 19. Jahrhunderts bis zu den nach New York emigrierten Antifaschist*innen im folgenden Jahrhundert wurden die Exilierten immer von der Linken und der sozialistischen Bewegung empfangen, und die sozialistische Bewegung gestand ihnen einen Ehrenplatz zu.
Die Niederlage von 1989 jedoch ist anderer Art: sie kam nicht nach einer erbitterten Schlacht und verursacht keinerlei Stolz; sie beendete das 20. Jahrhundert und über den Zusammenbruch des Realsozialismus hinaus, beschloss sie einen Zyklus an Revolutionen, der sich 1917 eröffnet hat. Diese Niederlage war so schwer, dass viele es vorzogen, zu flüchten, statt sich ihr zu stellen. Was von diesem Jahrhundert der Aufstände übrig blieb, war nur noch ein Berg an Ruinen und man wusste nicht, wie die Trümmer aufräumen noch wo anzufangen wiederaufzubauen, noch ob man in der Lage wäre oder ob es sich lohnt. Die Melancholie, die aus einer solchen historischen Niederlage hervorging – sie dauerte eine Generation –, war wahrscheinlich die notwendige Voraussetzung, um zu reagieren, zu trauern und einen Neuanfang vorzubereiten. Die am meisten verbreitete Reaktion war zunächst die Vermeidung, mit einer Unfähigkeit zu trauern vergleichbar, wie sie Alexander und Margarte Mitscherlich im Nachkriegsdeutschland beschrieben haben.[38] Wie man auch versucht hatte, Vorwände zu finden, um dem Erbe des Nationalsozialismus zu entgehen, wurde der Kommunismus auf verschiedene Weise verdrängt: indem Namen geändert oder ›vergessen‹ wurden, indem er negiert wurde, oder zwischen unzähligen Ventilen gewählt wurde, die durch die universelle Erhöhung des neoliberalen Kapitalismus angeboten wurden. Wie in Deutschland jedoch ›verging‹ diese Vergangenheit nicht, sie wird zurückkommen und wir müssen uns ihr stellen.
Geerbt von einem Jahrhundert und resultierend aus einem historischen Zyklus, in denen die Revolution die Form des Kommunismus angenommen hat, konnte sich diese dämmernde Melancholie mit anderen vergleichen, die ihr vorausgegangen waren und die mit ihr eine unerschöpfliche Kollektion oder Sammlung aus Trauerfiguren bilden. Die mesoamerikanischen Kulturen, zerstört von den Pferden, Gewehren und Mikroben, die aus der Neuen Welt mit den Schiffen von Cortès kamen, haben ihr Leid in Sprachen ausgedrückt, die nicht mehr existieren oder heute ohne Sprecher*innen bleiben, wie von Mario Vargas Llosa in Der Geschichtenerzähler[39] beschrieben. Auf ähnliche Weise schrieben die jiddischen Poeten nach der Shoah in der Sprache einer verschwundenen Welt: die Melancholie inspirierte eine reiche intellektuelle Tradition. Wie zahlreiche Historiker*innen betonten, wurde die Melancholie während der Renaissance als eine jüdische Krankheit betrachtet.[40] Nach dem Arzt und Gelehrten Fernando Cardoso – erforscht von Yosef Hayim Yerushalmi, einem der bedeutendsten Repräsentanten der marranischen Kultur, der sich im 17. Jahrhundert zwischen dem Spanien der Inquisition und den italienischen Ghettos tummelte –, war die Melancholie zunächst und vor allem Ausdruck von der »Traurigkeit und Angst, entstanden aus den Verletzungen und der Unterdrückung des Exils«[41]. Es war die Melancholie, die drei Jahrhunderte später Erwin Panofsky, Raymond Klibansky und Fritz Saxl, die drei Gelehrten des Warburg Instituts, die in den Dreißigerjahren nach Amerika emigriert waren, dazu drängte, Saturn und der Melancholie eines ihrer berühmtesten Essays zu widmen.[42] Diese Melancholie einer verlorenen Vergangenheit hat meistens einen nostalgischen Geschmack, wie das Abfeiern des Habsburger Mythos in der Autobiografie von Stefan Zweig und in den Romanen von Joseph Roth oder wie im Requiem für das britische Empire in der Prosa von V.S. Naipaul.
Die paradigmatische Figur dieser konservativen Melancholie bleibt Chateaubriand, der resignierte und sublime Erzähler des Sturzes des Ancien Régime. 1802 widmete er ein Kapitel in seinem Génie du christianisme[43] der Migration der Vögel, die er mit jener der Menschen verglich. Ein von der Natur vorgeschriebenes Exil, so beobachtete er, unterscheidet sich sehr von dem, das die Menschen verordnen. Der Vogel geht nicht allein, sondern im Schwarm, und nimmt alle Objekte mit, die ihm etwas bedeuten, wissend, dass er wiederkommt:
»Der Vogel ist einen Moment nur für sein Glück verbannt; er geht mit seinen Nachbarn, mit seinem Vater und seiner Mutter, mit seinen Schwestern und Brüdern –, er lässt nichts zurück: er nimmt sein ganzes Herz mit. Die Einsamkeit hat ihm Essen und Decke vorbereitet; die Wälder wehren sich nicht gegen ihn; er kehrt zurück, um schließlich da zu sterben, wo er geboren wurde: er findet den Fluss, den Baum, das Nest, die väterliche Sonne wieder.«
Der Exilierte dagegen weiß nicht, ob er eines Tages sein Heimatland wiedersieht, weil der Bann der ihn aus seinem Lande wies, ihn aus der Welt verwiesen hat.«[44] Als distinguierter Repräsentant der aristokratischen Emigration, der die Französische Revolution bekämpft hatte, schrieb Chateaubriand diese Worte, als er nach acht Jahren Exil nach Paris zurückkehrte. Er hatte einige Jahrzehnte vor Tocqueville verstanden, dass der revolutionäre Bruch unumkehrbar war und dass das Zeitalter des Absolutismus definitiv vorbei war. Aber, im Gegensatz zu Tocqueville, der unter der Restauration groß wurde, hatte er den Schiffbruch des Ancien Régime als Akteur erlebt und nicht als später Beobachter oder Kommentator.
Chateaubriand verkörpert die Metapher des von Hans Blumenberg analysierten Schiffbruchs in seinem berühmten Essay[45], dessen Ausgangspunkt ein Abschnitt aus dem zweiten Buch von De Rerum Natura von Lukrez ist: »Wonnevoll ist’s bei wogender See, wenn der Sturm die Gewässer/ Aufwühlt, ruhig vom Lande zu sehn, wie ein andrer sich abmüht/ Nicht als ob es uns freute, wenn jemand Leiden erduldet/ Sondern aus Wonnegefühl, dass man selber vom Leiden befreit ist.«[46] Während Lukrez die Reaktion des Betrachters einer Naturkatastrophe beschreibt, überträgt Blumenberg seine Metapher auf die Geschichte und gibt Goethe als Beispiel an, der 1806 am Tag nach Napoleons Sieg das Schlachtfeld von Jena besuchte. Gleichzeitig ändert er die Metapher durch ein Zitat aus den Pensées[47] von Pascal, der den Geist der modernen Zeiten ankündigt: wir sind keine Zuschauer mehr, wir sind »verstrickt«[48] und wir können weder von einem geschützten und weit entfernten Beobachterposten aus die Katastrophen, die uns umgeben betrachten, noch uns ihnen entziehen; sie sind in uns und wir sind die Akteure. Die Erleichterung derer, die sich vor der Katastrophe drücken und sie von Weitem betrachten können, ist ein uns unbekanntes Privileg. Wir haben selbst Schiffbruch erlitten; wir müssen versuchen zu überleben, indem wir uns an einigen schwimmenden Trümmern unseres versunkenen Schiffes festklammern. Anders ausgedrückt, können wir unserer Niederlage nicht entgehen, noch sie von außen beschreiben oder analysieren. Die linke Melancholie ist das, was nach dem Schiffbruch übrigbleibt; ihr Geist gestaltet die Texte von zahlreichen ›Überlebenden‹, entworfen nach dem Sturm von ihrem Rettungsboot aus.
Der epistemologische Wert der Metapher von Blumenberg liegt in der Fähigkeit desjenigen, der den Schiffbruch erlitten hat, in den er selbst für einen Moment »verstrickt« war – und auf den er ephemer, aber entscheidend –, einen weit entfernten Blick wirft. Wie der Erzähler von Der Weg nach Guermantes[49], der, als er in das Haus seiner Großmutter nach einer langen Abwesenheit zurückkehrt, plötzlich den Eindruck hat, auf ihrem Porträt eine alte Frau zu sehen, so unbekannt für ihn wie für den Fotografen, der ihr Bild fest gehalten hat, kann der Besiegte seine Niederlage von einem äußeren Beobachtungspunkt genau und langsam betrachten. In einem Augenblick kann er seine emotionale Implikation in der vollendeten Erfahrung neutralisieren und sie genau untersuchen, als ob er eine Fotografie betrachtet. Selbstverständlich ist ein von seiner familiären Umgebung abgeschnittenes Bild emotional beschädigt, aber es bietet sich für eine ikonografische Annäherung an, befreit von jeglicher Empathie oder Identifikation, und ein solcher Abstand kann auf epistemologischer Ebene fruchtbar sein. Siegfried Kracauer zufolge »fühlt sich das melancholische Gemüt nicht nur zu elegischen Gegenständen hingezogen, sondern weist noch eine andere, wichtigere Eigenschaft auf: es begünstigt Selbstentfremdung, die ihrerseits Identifikation mit einer Vielzahl von Objekten nach sich zieht«.[50] Statt die pathologische Verbundenheit zu einer toten und vernichteten Vergangenheit zu konsolidieren, ermöglicht diese melancholische Vision, das erlebte Trauma zu überwinden.
Die besiegte Linke
Reinhart Koselleck, der Begründer der konzeptionellen Geschichte, stellte die erkenntnistheoretische Überlegenheit der Besiegten in der Interpretation der Vergangenheit fest: »Kurzfristig kann es sein, dass die Geschichte von den Siegern gemacht wird, aber langfristig, kommen die historischen Verdienste der Erkenntnis von den Besiegten.«[51] Die Sieger fallen unvermeidlich in eine apologetische Vision der Vergangenheit, die ihren Heldentaten eine unverhoffte Absicht verleiht. Koselleck zufolge, sind Johann Gustav Droysen und François Guizot zwei eloquente Beispiele dieser selbstgerechten historischen Konstruktion. Ersterer ist Autor einer Monumentalgeschichte Preußens, geschrieben zwischen 1855 und 1884, den Jahrzehnten des deutschen Aufstiegs zur Weltmacht; Zweiterer veröffentlichte seine Geschichte der französischen Zivilisation 1830, dem Jahr als die Monarchie Louis Philippes den Triumph seines konservativen Liberalismus feierte. Die Besiegten dagegen, denken an die Vergangenheit mit einem penetranten und kritischen Blick: »Die Erfahrung, die man aus einer Niederlage zieht, schließt ein Erkenntnispotenzial ein, das bei denen überlebt, die es verursacht haben, insbesondere wenn der Besiegte aufgrund seiner eigenen Geschichte gezwungen ist, die allgemeine Geschichte neu zu schreiben.«[52] Koselleck zufolge bleibt das hervorstechende Beispiel Karl Marx, der umfassend über die Revolutionen des 19. Jahrhunderts vom Standpunkt der besiegten proletarischen Klassen schrieb. Seine Empathie für die Verlierer war umso größer und stärker, weil er sich selbst als einen sozialistischen Exilierten und marginalisierten Intellektuellen betrachtete.[53] Erstaunlicherweise zitiert Kosselleck nicht Walter Benjamin, für den der emphatische Blick auf die Besiegten – verkörpert in seinen Augen durch den positivistischen Historiker Fustel de Coulanges – genau das Verfahren war, »mit dem der historische Materialismus gebrochen hat«[54]. Eine wichtige Tendenz in der marxistischen Historiografie – von der britischen »Geschichte von unten« bis zu den subalternen Indian Studies – hat diesen fruchtbaren Ansatz angenommen. Edward P. Thompson beschrieb die industrielle Revolution vom Standpunkt der englischen Arbeiter*innenklasse aus und Ranajit Guha hat die indische Kolonialgeschichte neu interpretiert, indem er die »kleinen Stimmen« der unterdrückten Bäuer*innen gesucht und sich sowohl von den britischen Kolonialisten wie von den assimilierten indischen Eliten gelöst hat.[55]
Koselleck übernahm diese Dichotomie zwischen Siegern und Besiegten von Carl Schmitt, einem seiner Lehrmeister. In einem kleinen Text, geschrieben am Ende des Krieges, als er von der amerikanischen Armee gefangen gehalten wurde, die Deutschland besetzte, entwarf dieser ein Porträt von Tocqueville als Besiegtem und begriff eine entscheidende Verbindung zwischen diesem Statut und seiner Sicht auf die Vergangenheit.[56] Die Erfahrung der Niederlage habe seinen kritischen Blick geschärft und aus ihm einen der wichtigsten Historiker des 19. Jahrhunderts gemacht. Schmitt hielt ihn für einen hellsichtigen Konservativen, der sich bewusst war, zu einer besiegten Klasse zu gehören. Dieser politische Denker hatte seine Werke über die Französische Revolution als Repräsentant der Aristokratie geschrieben, einer durch die Demokratie verschwundenen sozialen Gruppe. Er hatte diese historische Veränderung umfassend in seinem Werk über Amerika analysiert und all seine Texte waren von einer tiefen Resignation gegenüber dem unumkehrbaren Prozess der demokratischen Transformation gekennzeichnet. Tocqueville, lässt Schmitt vernehmen, war ein besiegter Konservativer der den Katechon[57] aufgegeben hatte.
Dieses theologische Konzept, das ›Widerstand‹ bedeutet – eine Kraft, die zurückhält, konserviert oder bändigt –, erscheint in den Episteln von Paulus an die Thessalonicher als das mächtigste Hindernis gegen die Thronbesteigung des Antichrist, das heißt einer Ära der Gottlosigkeit und der Dekadenz.[58] Bis zum Zweiten Weltkrieg war die politische Theologie von Schmitt stark an die Idee von Katechon gebunden. In der Tradition von Joseph de Maistre und Donoso Cortés hatte er Hitler als eine Art säkularen Katechon gegen den Bolschewismus beschrieben, die moderne Verkörperung des Antichrist. 1946 jedoch betrachtete Schmitt sich selbst als besiegt. Ein resignierter Besiegter, weil er die geringste Illusion in den Faschismus verloren hatte.
Von Schmitt inspiriert, hat Koselleck die Perspektive des Besiegten von Tocqueville auf Marx verlagert. Im Umfeld des Letzteren könnte man sogar eine Parallele zwischen Schmitt (oder Tocqueville) und einigen marxistischen Denkern etablieren, vor allem einigen Mitgliedern der Frankfurter Schule. Walter Benjamin selbst hatte eine solche Umkehrung in seinen Thesen über das Konzept der Geschichte angeregt. Den Standpunkt des »an der Marxschen Schule instruierten Historikers« einnehmend, schrieb er geheimnisvoll: »Der Messias kommt ja nicht nur als der Erlöser; er kommt als der Überwinder des Antichrist.«[59] Im Gegensatz zu Benjamin glaubte Theodor W. Adorno nicht mehr an die Revolution, und wie Tocqueville schrieb er als Besiegter, der an keinen Katechon appellieren konnte. Wie der französische Historiker, der Aristokrat, der das Ancien Régime nicht mehr kannte, hatte Adorno die Russische Revolution nicht erlebt; Tocqueville glaubte nicht an die Restauration wie Adorno keinerlei Vertrauen in Lenin und Trotzki hatte. Der deutsche Philosoph war von der Revolution nicht angezogen und war stoisch resigniert gegenüber der unausweichlichen Thronbesteigung des Totalitarismus (die universelle Verdinglichung, was auch immer ihre Form sein mag). In seinen Schriften verdient die negative Dialektik nur eine kontemplative Kritik, ohne mögliche Erlösung. Ihm zufolge gab es keine soziale oder politische Alternative gegen die Herrschaft, und selbst die ästhetische Schöpfung könne nur von den durch das Verschwinden der Zivilisation der Menschheit zugefügten Verletzungen zeugen.[60] Der Fortschritt sei nur Illusion; die instrumentelle Vernunft habe alle emanzipatorischen Möglichkeiten der Aufklärung erschöpft und das kritische Denken wäre nicht mehr in der Lage, irgendeine effiziente politische Aktion zu inspirieren.
Tocquevilles Definition von Guizot – »ein Besiegter, der seine Niederlage akzeptiert«[61] – passt auch zu Auguste Blanqui am Ende seines Lebens: eine legendäre Figur des Sozialismus des 19. Jahrhunderts. 1872, ein Jahr nach der blutigen Repression der Pariser Commune, ein Ereignis, das er von seinem Gefängnis im Château du Taureau aus beobachtete, schrieb er seinen rätselhaftesten Text, Die Ewigkeit durch die Gestirne. Am Ende einer langen, manchmal naiven Meditation über die Endlichkeit des Universums, trotz seiner scheinbaren Unendlichkeit, beschrieb er den Kosmos und die Geschichte als Resultate einer ständigen Wiederholung, einer unabänderlichen Bewegung; es sei dieselbe Struktur, die die menschlichen Wesen in einer Art unentrinnbaren Hölle gefangen halte. Nachdem er den Fortschritt als eine falsche, trügerische Idee präsentiert hat und sein Misstrauen gegenüber den Menschen affirmiert, beschwört er implizit die ewige Wiederholung der Niederlage. Dieser unveränderliche Charakter der Natur und des Lebens hat keine andere Auswirkung als eine ununterbrochene Reproduktion der Barbarei. Die Emanzipation sei illusorisch und sein eigenes Leben schien im Schiffsbruch der Revolutionen verschlungen, in denen er sich unverdrossen engagierte. Indem Blanqui eine zyklische Konzeption der Geschichte adoptierte, fand er Zuflucht in der Melancholie und gab jede Hoffnung in die Zukunft auf. Die letzten Worte seines Textes klingen wie das verzweifelte Geständnis eines Scheiterns:
»Immer und überall in diesem irdischen Lager das gleiche Drama, die gleiche Kulisse, auf der gleichen schmalen Bühne eine lärmende Menschheit, die von ihrer Grösse überzeugt ist, sich für das Universum hält und in ihrem Gefängnis lebt, als ob es grenzenlos wäre, um mit jenem Planeten unterzugehen, welcher mit tiefster Verachtung die Bürde ihres Stolzes getragen hat. Die gleiche Monotonie, die gleiche Unbeweglichkeit auf den fremden Gestirnen. Das Universum wiederholt sich ohne Ende und verbleibt ungeduldig am gleichen Ort. Die Ewigkeit spielt unerschütterlich in der Unendlichkeit die gleichen Vorstellungen.«[62]
Dieser obskure Text faszinierte Walter Benjamin, der ihn in einer tragischen historischen Konjunktur las, nach dem deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt von 1939, dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und der Kapitulation Frankreichs, dem Land, in dem er im Exil lebte. Zehn Jahre vor Also sprach Zarathustra erschien ihm Blanquis Buch wie eine starke Vision der »ewigen Wiederkunft«, eines fatalen Zusammenbruchs, sehr frappierend an Nietzsche erinnernd. Diese hoffnungslose Resignation dieser Schrift, »die Blanqui in seinem letzten Gefängnis als seine letzte geschrieben hat«, beobachtete Benjamin und schloss, dass der charismatische Anführer der französischen Revolutionen des 19. Jahrhunderts schließlich aufgegeben hatte, die etablierte Ordnung infrage zu stellen. »Das Stück, das sprachlich von sehr starker Prägung ist […] ist zugleich ein Komplement der Gesellschaft, die B(lanqui) an seinem Lebensabend als Sieger über sich zu erkennen gezwungen war. […] Es ist eine vorbehaltlose Unterwerfung.«[63] Die Revolte gegen Herrschaft war vergeblich. Wie es Miguel Abensour nahelegte, verblieb Benjamin selbst inmitten des magnetischen Feldes von Blanqui, zerrissen zwischen Melancholie und Revolution, zweifellos eine dialektische Verbindung zwischen beiden suchend.[64]
Blanqui war ein Kämpfer und revolutionärer Denker. In seinen Erinnerungen über die Revolution von 1848 skizzierte Tocqueville sein Porträt in verächtlichen Zügen, ohne dabei eine fast physische Abscheu zu verbergen. Der Chef der Pariser Barrikaden rief bei ihm eine absolute Missbilligung hervor. Diese Tendenzen Tocquevilles finden sich bei dem marxistischen Historiker Eric Hobsbawm wieder. Er betrachtete das 20. Jahrhundert als Jahrhundert des Kommunismus, eine historische Erfahrung, die er – wie sein aristokratischer Vorgänger das Ancien Régime – für eine definitiv überholte Epoche hielt. Der Vergleich mit François Furet, selbsternannter Tocqueville’scher Historiker der Französischen Revolution und des Kommunismus ist unausweichlich. Hobsbawm und Furet verachten sich zutiefst. In einem für die Zeitschrift Le Débat verfassten Artikel, bezeichnete Ersterer Das Ende der Illusion (das Werk, in dem Furet den Kommunismus beerdigt) als »spätes Produkt des Kalten Krieges«, während Zweiterer Das Zeitalter der Extreme (das große Werk von Hobsbawm über das 20. Jahrhundert) als Relikt einer von der Geschichte verurteilten Ideologie betrachtete.[65] Furet bezog sich auf das Erbe des politischen französischen Denkers, aber derjenige der Tocqueville am meisten ähnelt, war sicherlich Hobsbawm. Hobsbawm hatte seine gesamte teleologische Vision der Geschichte aufgegeben, denn er glaubte nicht mehr an ihre sozialistische Vollendung. Treu sich selbst gegenüber, blieb er ein marxistischer Historiker, selbst als er seinen Telos auf dem Weg verloren hatte: der Kommunismus war ein effizientes Katechon gegen den Faschismus, aber es gelang ihm nicht, den Kapitalismus zu besiegen.[66] Dagegen vertrat François Furet eine liberale Teleologie, denn er postulierte, dass die repräsentative Demokratie und die Ökonomie des Marktes vom Ende der Geschichte künden, ihrer unerhofften Vollendung. Der französische Historiker schrieb mit der Arroganz des Siegers, sein britischer Kollege mit vom Bewusstsein der Niederlage gespitztem Stift.[67] Vielleicht ist es genau dieser besiegte Marx, spektral, ein von seiner revolutionären Dimension amputierter Marx, der zu Beginn der Neunzigerjahre Jacques Derrida anzog. Der Marxismus hatte ihn nicht interessiert, als er reale Revolutionen in der ganzen Welt inspirierte; er wurde akzeptabel für ihn als leere messianische Hoffnung oder in seinen eigenen Worten als Eskaton ohne Telos.[68]