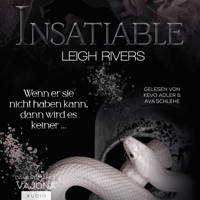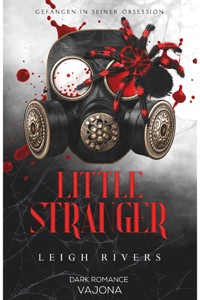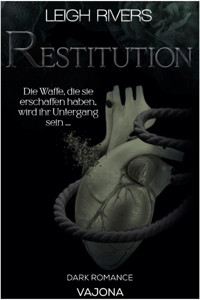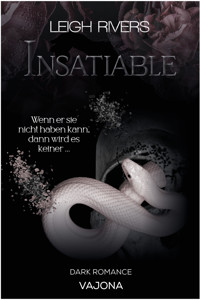Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: VAJONA Audio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Web of Silence Duet
- Sprache: Deutsch
Malachi Vize hatte immer nur einen Wunsch im Leben. Ein Ziel. Eine tiefe Besessenheit, die er nie ablegen konnte. Seine Pflegeschwester Olivia. Zum ersten Mal hat sie ihn der gesamten Welt vorgezogen, und er hat vor, sie für immer in seinem festen Griff zu halten – aber sein Glück wird schon bald zerschmettert, als mächtige Feinde Olivia für sich beanspruchen wollen. Er hatte sie. Doch dann hat er sie verloren. Verletzt und im ständigen Kampf mit seinen eigenen Dämonen ist Malachi gezwungen, unerwartete Allianzen einzugehen, um sie zu finden. Doch er wird nicht aufgeben, ehe er sie nicht zurückgeholt hat. Koste es, was es wolle.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Leigh Rivers
Little Liar
Übersetzt von Sandra Bernstein
Impressum
Little Liar
Copyright der deutschen Ausgabe © 2025 VAJONA Verlag GmbH
Übersetzung: Sandra Bernstein
Copyright © Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel
»Little Liar: THE WEB of SILENCE DUET Book 2
(A Dark Taboo Romance)« by Leigh Rivers.
Korrektorat: Lou Valle
Umschlaggestaltung: Stefanie Saw
Satz: VAJONA Verlag GmbH, Oelsnitz
Vermittelt durch die Agentur:
Two Daisy Media, LLC.
VAJONA Verlag GmbH
Carl-Wilhelm-Koch-Str. 3
08606 Oelsnitz
Teil der SCHÖCHE Verlagsgruppe GmbH
Auf das Buch, das mich beinahe das Leben gekostet hätte.
Diesmal habe ich gewonnen.
Hinweis
Achtung, dieses Buch enthält stark triggernde Inhalte, die einige Leserinnen und Leser sehr verstören könnten!
Bitte erst ab 18 Jahren lesen und wenn ihr ganz sicher seid, damit umgehen zu können. Bitte achtet auf eure psychische Gesundheit!
Zu den verstörenden Inhalten gehören:
Fehlender und zweifelhafter Consent
Somnophilie (Sex mit Schlafenden/Bewusstlosen)
Vergewaltigung
Brutale Gewalt, Folter
Arachnophobie
Tierquälerei
Blut und Blutspiele
Psychische Erkrankungen (vor allem Antisoziale Persönlichkeitsstörung)
Emotionaler und körperlicher Missbrauch
Drogenmissbrauch
Suizidgedanken
Sex in der Nähe einer Leiche/eines Sterbenden
Teil Eins
Der Wind weht durch meine Haare. Daddy trägt mich auf seinen Schultern zum Spielplatz am Ende unseres Wohnviertels.
Mommy ist noch bei der Arbeit, also spielen wir ein bisschen, dann holen wir sie mit Daddys neuem Auto ab. Und heute Abend backen wir Kekse!
»Hattest du Spaß im Kindergarten?«, fragt Daddy, und ich rufe laut: »Ja!«
Ich halte mich an seinem Kopf fest und wir gehen über die Straße. Kleine Regentropfen treffen auf mein Gesicht, aber ich habe meinen Regenmantel und meine Gummistiefel angezogen, damit wir in Pfützen springen können.
»Daddy?«
»Ja, mein Sohn?«
»Können wir auf dem Heimweg noch ein Eis essen?«
Er lacht und hebt mich von seinen Schultern. Ich kichere und kreische vergnügt, als er mich kitzelt und dann absetzt. Nachdem er mir das Schokoladeneis vom Kinn gewischt hat, nimmt er meine Hand. »Aber in einer Stunde müssen wir deine Mommy von der Arbeit abholen.«
Grinsend springe ich unterwegs in jede Pfütze. Plötzlich fährt ein großer Lastwagen an uns vorbei und ich zucke zusammen, schlage mir die Hände auf beide Ohren und kneife die Augen fest zu.
»Hey«, sagt Daddy und hockt sich vor mich, bis der Lastwagen verschwunden ist. Aber in meinen Ohren schrillt es immer noch schmerzhaft laut. Ich will, dass es aufhört – warum hört es nicht auf?
Meine Unterlippe zittert, und als ich die Augen wieder aufmache, sieht Daddy mich an. »Es wird schlimmer, was?«
Ich nicke langsam. Ich mag keine lauten Geräusche – sie tun meinen Ohren weh und machen das Atmen ganz schwer.
»Na komm«, sagt er, steht auf und nimmt meine Hand wieder in seine. »Du kannst ein bisschen schaukeln, und dann holen wir uns noch ein Eis.«
Ein Lächeln huscht über mein Gesicht und Daddy hüpft mit mir über den Spielplatz, hebt mich auf die Schaukel und zieht sie nach oben. Ich lache immer heftiger und kreische ganz laut.
Heute sind gar keine anderen Kinder hier. Das ist gut. Wenn viel los ist, kommen wir nicht hierher. Ich glaube, Daddy mag es am liebsten, wenn wir beide ganz allein sind.
Daddy geht immer mit mir in den Park. Oder ins Schwimmbad, damit er mir das Schwimmen beibringen kann.
Jetzt führt er mich zum Karussell. »Ich drehe dich nicht schnell«, sagt er und setzt mir die Kapuze auf, als der Regen stärker wird. »Aber halt dich trotzdem gut fest.«
Bevor er mich drehen kann, schnappe ich nach Luft und beuge mich vor. »Daddy, sieh mal!«
Eine kleine Spinne baut ein Netz an der Stange. Sie ist winzig und ganz schwarz, und die Regentropfen machen ihr zu schaffen. Daddy streckt seinen Finger aus, und die Spinne krabbelt darauf. »Sieh sie dir ruhig an«, sagt er und setzt sich neben mich auf das Karussell, das unter seinem Gewicht knarrt. Dann senkt er den Finger zu meiner Hand. »Willst du sie auch mal halten?«
Ich nicke und werde ein bisschen nervös, während ich meine Hand mit der Handfläche nach oben auf meinen Schoß lege. Daddy lässt die Spinne auf meine Hand krabbeln, und ich kichere. Sie ist so klein und hilflos und ganz allein. Der Regen muss sie nass gemacht haben. Bestimmt friert sie auch. »Können wir sie mit nach Hause nehmen?«
Doch als Daddy gerade antworten will, kracht es über uns und ich zucke zusammen. Erschrocken balle ich die Hände zu Fäusten und zerquetsche versehentlich die Spinne. Hastig öffne ich die Hand wieder und sie landet direkt in einer kleinen Pfütze auf dem Karussell.
Ein paar Atemzüge lang starre ich sie mit großen Augen an. Sie bewegt sich gar nicht mehr.
»Nein!«, schreie ich und will sie wieder aufheben, aber ich werde aufgehalten. »Rette sie, Daddy!«
»Sie schläft nur, mein Sohn. Bei Gewitter schlafen Spinnen immer. Es geht ihr gut. Wollen wir jetzt ein Eis essen gehen?«
»Aber … aber …«
Daddy hebt mich auf seine Arme, während mir bereits die Tränen über die Wangen laufen.
»Ist schon gut, Malachi. Beruhige dich. Sie schläft nur.«
Ich kuschle mich an ihn und weine. Denn ich weiß, dass ich die Spinne zerquetscht habe. Ich weiß, dass sie jetzt meinetwegen tot ist. Mein Körper zittert unkontrolliert, bis ich schließlich in Daddys Armen einschlafe.
»Du bist so ein guter Junge, Malachi.«
Ich mag die Stille. Dann tun mir die Ohren nicht weh, und die bösen Schmetterlinge, die immer darauf warten, dass mich jemand anschreit, tauchen auch nicht auf.
Doch hier im Haus ist es nie ganz still.
Wenn Mommy mich ganz allein zu Hause lässt, kann ich mit den Kartons spielen, die überall herumstehen. Manchmal sind sie so groß, dass ich reinklettern und den Deckel zumachen kann. Dann verstecke ich mich, bis Mommy wieder nach Hause kommt und mich in mein Zimmer bringt.
Jetzt gerade habe ich zu viel Angst, um nach Kartons zu suchen. Ist Mommy nach Hause gekommen? Daddy? Meinen Daddy habe ich schon ganz lange nicht mehr gesehen.
Ich rutsche vom Bett und stolpere auf dem Weg zu meiner Zimmertür fast über den Wäschesack. Dann drücke ich die Türklinke runter, und meine Unterlippe verzieht sich.
Warum geht die Tür nicht auf?
»Mommy?«, rufe ich und hämmere mit meiner kleinen Faust gegen die Tür. Ich huste in meine Hand und schlage noch mal dagegen. »Daddy?«
Wie jede Nacht passiert nichts. Es macht mich traurig, dass Mommy nicht mehr mit mir kuschelt. Daddy hat mich immer so lange umarmt und dann gekitzelt, bis ich gekreischt und gelacht habe.
Die Musik ist ganz laut – Mommy hört mich bestimmt nicht. Mit Tränen in den Augen gehe ich zurück zum Bett und lasse den Kopf hängen. Auf dem Weg stolpere ich noch mal – ich sehe nicht, wohin ich trete, weil Mommy mein Nachtlicht ausgeschaltet hat, als ich gefragt habe, wann Daddy heute von der Arbeit nach Hause kommt und mir eine Gute-Nacht-Geschichte vorliest.
Mommy sagte, ich wäre ein böser Junge, weil ich nicht schlafe. Dabei war ich gar nicht müde. Mein Bauch tat weh, und meine Wange schmerzte von Mommys Ohrfeige, nachdem ich sie gefragt hatte, ob sie mir stattdessen das Buch vorlesen kann.
Ich wische mir mit dem Handrücken über die feuchten Wangen und kuschle mich in meine Decke, um mich aufzuwärmen. Es ist jetzt immer so kalt. Regen dringt durch mein Fenster und hinterlässt Pfützen auf dem Fußboden, die meine Spielsachen durchtränken – ich habe versucht, sie mit meinem Teddybär aufzuwischen, weshalb ich nicht mehr mit ihm knuddeln kann.
Irgendwann schlafe ich endlich ein, und als ich aufwache, kuschelt Mommy mit mir. Sie riecht komisch, und das Bett ist ganz nass. Vielleicht muss Mommy auch eine Windel tragen, so wie ich. Manchmal juckt es, besonders, wenn ich sie tagelang anbehalten muss.
Lächelnd betrachte ich ihr Gesicht. Ihre Augen sind zu und sie schnarcht, deshalb vergrabe ich meinen Kopf an ihrer Brust und schlafe wieder ein.
Jetzt bin ich wieder glücklich.
In der nächsten Nacht ist es genau dasselbe.
Auch in der nächsten Woche. Und in der übernächsten. Dann werden mehrere Monate daraus.
Bin ich mittlerweile eigentlich schon fünf geworden?
Mommy hat gesagt, ich wäre seltsam. Und das gefällt ihr nicht. Wie kann ich endlich nicht mehr seltsam sein? Ich will das gar nicht. Sie gibt mir auch die Schuld daran, dass Daddy weggelaufen ist.
Nach der Schule hält Mommy auf dem Weg zum Bus meine Hand. Sie erzählt mir, dass Daddy mir ein Geburtstagsgeschenk geschickt hat. Es wartet zu Hause auf mich. Ich grinse aufgeregt, hüpfe den Rest des Weges und ziehe Mommy mit mir. Sie kann kaum noch geradeaus laufen und stinkt nach Bier.
»Langsamer, Malachi«, schnauzt sie mich an und reißt so fest an meinem Arm, dass es wehtut. Mein Lächeln verschwindet.
Heute hat sie knallroten Lippenstift drauf. In den Mundwinkeln ist er verschmiert, auch an den Zähnen klebt was. Doch das sage ich ihr nicht – letztes Mal hat sie mich angeschrien, als ich es ihr gesagt habe.
»Sorry«, antworte ich leise und gehe den Rest des Weges langsam nach Hause, mit Schmerzen im Arm – ich glaube, sie hat mich gekratzt, aber ich sage nichts.
Auf dem Tisch steht eine Schachtel mit kleinen Löchern, daneben ein Glas und eine Geburtstagskarte, auf der eine große Fünf prangt. Mommy legt sich aufs Sofa. Ich schnappe mir die Karte und versuche, die Buchstaben zu entziffern. Obwohl Mommy mich für dumm hält, sagt meine Lehrerin immer, dass ich gut mit Wörtern umgehen kann. Und auch, wenn die Handschrift krakelig ist, kann ich die Karte lesen.
Malachi,
es tut mir leid, dass ich nicht mehr für dich da sein kann, mein Sohn. Ich hoffe, eines Tages kannst du mir verzeihen, dass ich gegangen bin. Weißt du, Daddys Kopf ist kein schöner Ort, und er tut dir und deiner Mutter nicht gut. Ich habe mich so sehr bemüht, aber ihr beide habt etwas Besseres verdient.
Ich wünschte, ich könnte mich für dich entscheiden und gegen das Gift in meinem Kopf ankämpfen, aber ich schaffe es nicht. Eines Tages sehen wir uns bestimmt wieder, aber hoffentlich nicht so bald. Dein neuer achtbeiniger Freund wird dich beschützen, und ich weiß, dass du auch ihn beschützen wirst. Als Namen für ihn schlage ich Rex oder Spikey vor. Hab keine Angst vor ihm.
Immerhin liebst du Spinnen. Genau wie ich.
In Liebe, Daddy
Ich runzle die Stirn und schaue auf. Mommy ist auf dem Sofa eingeschlafen. Was meint Daddy damit? Warum kann er sich nicht für mich entscheiden? Und wo will er hin?
Mein Blick fällt auf die Schachtel, und ich lasse die Karte auf den Tisch fallen und gehe näher heran. Mit meinen langen, schmutzigen Fingernägeln löse ich das Klebeband vom Deckel und zucke zusammen, als ich die Schachtel öffne und eine riesige, flauschige Spinne darin entdecke, die in der Schachtel herumkrabbelt.
Meine Augen werden groß. »Ähm, Mommy?«
Sie schnarcht immer noch, und als ich sie rüttle, stößt sie mich weg, sodass ich auf den Hintern falle. »Hau ab.«
Ich stehe auf und schaue mir die Schachtel noch einmal an. Zögerlich unterdrücke ich meine Angst, bevor ich den Deckel wieder anhebe und das Haustier betrachte, das Daddy mir geschenkt hat. Dann greife ich hinein und lege meine Hand auf den Boden, um zu sehen, ob die Spinne zu mir kommt. Und tatsächlich krabbelt sie direkt auf meine Handfläche. Es kitzelt und ich zittere ein bisschen, aber mein Herz schlägt auch viel zu schnell.
Ob sie mich gleich beißt?
Ich hebe meine Hand mit der Spinne darauf an, bis sie direkt vor meinen Augen ist. »Hi«, sage ich dann mit meiner piepsigen Stimme. »Du bist jetzt mein neuer bester Freund.«
In den nächsten Wochen ist das Leben wieder etwas fröhlicher. Mommy hat gesagt, dass mein neues Haustier eine Vogelspinne ist. Und ich muss sie in meinem Zimmer aufbewahren. Sein Name ist Rex.
Er schläft in seinem Terrarium, wenn ich ins Bett gehe. Manchmal singe ich ihm etwas vor. Er sieht mir sogar zu, wenn ich ihm etwas vorlese, damit Mommy das nicht tun muss.
Mommy sehe ich jetzt nicht mehr so oft – sie verbringt viel Zeit mit ihren Freunden. Meinen Daddy vermisse ich sehr, aber er hat geschrieben, wir sehen uns wieder. Deshalb warte ich darauf, dass er nach Hause kommt.
Ständig sind große böse Männer in unserem Haus. Einmal kam einer von ihnen in mein Zimmer und wollte Rex mitnehmen, seitdem schließt Mommy meine Zimmertür wieder ab – diesmal mit zwei Schlössern.
Auch jetzt sind viele Leute im Haus, aber ich muss schlafen. Ich möchte gerne rausgehen. In die Schule darf ich nicht, weil ich krank bin. Aber ich fühle mich gesund. Warum lässt Mommy mich nicht raus und draußen spielen?
Daddy hat immer mit mir gespielt. Ich habe mich versteckt und er hat versucht, mich zu finden. Dann hat er mich gejagt, bis ich lachen musste und so laut gekreischt habe, dass ich Halsschmerzen bekam und mir die Tränen über die Wangen liefen. Dabei habe ich meinen Helden angelächelt.
Jetzt ist Rex mein einziger Freund. Er schweigt immer. Genau wie ich.
Mommy hasst es, dass ich nicht mehr mit ihr rede, aber ich behalte lieber alles für mich. Wenn ich etwas sage, bekomme ich sowieso nur wieder eine Ohrfeige oder werde angeschrien. Rex ist der Einzige, der jetzt noch mit mir spricht – ganz ohne Worte. Mein bester Freund. Mein Beschützer. Mein Held. Bis Daddy endlich wieder nach Hause kommt.
Meine Augen fliegen auf, als ich unten eine Tür zuschlagen höre.
Sollte ich überhaupt noch schlafen? Ich weiß nicht, ob draußen noch Sterne sind – Mom hat mein Fenster schwarz angemalt, und ich darf mein Zimmer nicht verlassen. Das will ich auch gar nicht. Das Haus ist total dreckig, die Hunde kacken überall hin, und es gibt auch nie etwas zu essen.
Ich glaube, Rex hat auch Hunger.
Als ich das letzte Mal gesprochen habe, habe ich Mommy gesagt, dass ich keine Windel mehr tragen will. Ich weiß eigentlich schon, wie man auf Toilette geht, aber ich darf nicht.
Es juckt. Und es tut weh, wenn ich mich hinsetze. Sie hat gesagt, dass ich still sein soll, und ich habe Rex mein Herz ausgeschüttet. Dann haben wir vereinbart, dass niemand mehr unsere Stimmen hören darf. Er hält sich daran, und weil wir beide jetzt schon seit ein paar Wochen schweigen, schaffe ich es auch.
Ich stehe mit wackeligen Beinen auf, öffne Rex’ Terrarium und entdecke meinen Freund in seiner kleinen Höhle. Dann halte ich meine Handfläche nach unten, doch es dauert ein bisschen, bis er meinen Geruch wahrnimmt und auf meine Hand krabbelt.
Das Geschrei wird immer lauter. Mein Atem zittert.
Keine Sorge, sage ich zu mir selbst. Ich beschütze dich.
Ich zucke zusammen, als auf einmal lautes, dröhnendes Gelächter durch die Tür dringt.
Das ist mein Zeichen, mich schnell unter meinem Bett zu verstecken. Ich krieche darunter und setze Rex vor meinem Gesicht auf den Boden, stütze mein Kinn auf und warte, dass die Stimmen wieder verschwinden.
Dann erstarre ich. Jemand schließt meine Zimmertür auf. Zwei Leute kommen rein. Ich sehe dreckige Socken in meinem Zimmer herumlaufen, dann taucht ein Paar Stiefel direkt vor meinem Gesicht auf.
»Alter. Hier drin stinkt’s ja total nach Scheiße. Wo ist er?«
»Elise hat gesagt, er wäre hier drin. Was hast du ihr denn bezahlt?«
»Nen Fünfziger«, antwortet er. »Atmet die Schlampe noch?«
»Nur knapp. Aber ich hab zugesehen, dass sie mehr als genug von dem Zeug nimmt. Das sollte sie eigentlich umbringen.«
Mein Herz hämmert wie verrückt in meiner Brust und ich halte die Luft an – das hilft mir immer, nicht zu weinen, auch wenn es wehtut und mir die Augen tränen.
Die Stiefel kommen näher ans Bett. Ich schlucke und rutsche noch weiter nach hinten.
Mit pochendem Herzen lege ich schützend meine Hände über Rex. Ich lasse nicht zu, dass sie Rex wehtun! Ich –
Eine Hand greift um meinen Knöchel, und der Laut, den ich ausstoßen will, brennt in meiner Lunge. Dann werde ich unter dem Bett hervorgezerrt und liege vor einem bärtigen Mann, der auf mich herab grinst. Ich schließe die Augen und schreie so laut in meinem Kopf, dass ich Kopfschmerzen bekomme und mir ganz schwindelig wird.
Ich drücke Rex fest an meine Brust. Tränen brennen in meinen Augen, als der Mann meinen Kiefer packt. Als ich die Augen wieder aufreiße, sehe ich, wie der andere Mann mich mit seinem zahnlosen Mund angrinst. Sein Blick fällt auf meine Hände.
»Wen haben wir denn da?«
Er schnappt sich Rex und ich gerate in Panik, schaffe es aber nicht, ihnen zu sagen, dass sie aufhören sollen, ihn wie ein Spielzeug hin und her zu werfen. Der böse Mann schlingt seine Finger um Rex, und ich starre ihn mit großen Augen an, flehe stumm darum, meinem besten Freund nicht wehzutun. Ich will sie anschreien, dass sie ihn in Ruhe lassen sollen, aber ich schaffe es nicht.
Ich kann nicht, kann nicht, kann es einfach nicht.
Rex ist das Einzige, das mir von meinem Daddy noch geblieben ist. Bis er mich endlich von hier abholt.
»Deine Mutter liegt gerade im Sterben«, sagt er. »Willst du, dass wir ihr helfen?«
Ich nicke, meine Unterlippe zittert.
Bitte rettet sie. Bitte, bitte, bitte.
»Sprich, Junge.«
Meine Lippen öffnen sich, aber es kommt kein Ton heraus. Ich schaffe es einfach nicht. Was ist nur mit mir los?
Er lacht laut und sieht seinen Freund an. »Ich glaube, wir haben den Jungen traumatisiert.«
»Bring ihn nach unten. Zeig ihm, wie seine Hure von einer Mutter ihre letzten Atemzüge nimmt.«
Ich werde an der Schulter gepackt und auf die Beine gezogen, dann lacht er wieder. »Er trägt eine gottverdammte Windel.«
»Ich will meine fünfzig Dollar zurück«, erwidert sein Freund und schneidet eine Grimasse.
Sie bringen mich nach unten und ich höre die Hunde bellen, aber sie sind in der Küche eingesperrt. Als der Mann mich auf den Boden fallen lässt, öffne ich die Augen und sehe Mommy neben mir liegen. Erbrochenes tropft aus ihrem Mund, sie starrt mich ohne zu blinzeln an, ihr Brustkorb hebt und senkt sich schnell – dann würgt sie plötzlich entsetzlich laut.
O nein. Mommy? Ist alles in Ordnung?
Ich kann die Worte nicht formen.
»Fleh uns an, sie zu retten. Dann rufen wir einen Rettungswagen.«
Ich schaue zu dem bärtigen Mann auf, meine Zähne klappern heftig vor lauter Angst.
Ich kann es nicht.
Ich kann sie nicht retten.
»Hmm«, brummt er und nimmt etwas vom Tisch. »Der Junge hat aber eine Stimme. Elise hat uns Videos von ihm gezeigt, weißt du noch? Wir müssen sie wohl nur aus ihm herauszerren. Was ist denn hier drin?« Er hebt das spitze Ding hoch, mit dem meine Mom schon so oft gespielt hat. Sein Freund zuckt die Achseln.
Dann explodiert ein heftiger Schmerz in meinem Arm – ich halte die Luft an und kneife die Augen ganz fest zu. Die Männer lachen. »Er ist genauso stur wie seine Mutter.«
Meine Augen fühlen sich komisch an – ich kann sie gar nicht mehr kontrollieren. Auch den Rest von meinem Körper nicht. Und dann werde ich auf einmal ganz schwach und müde.
Stunden später setze ich mich hin. Mom liegt immer noch so da wie vorhin. Ihre Augen sind offen, aber ihre Lippen sind ganz blau. Die bösen Männer sitzen auf dem Sofa. »Sieh mal einer an. Der kleine Scheißer ist wieder wach.«
Meine Beine tun so weh. Meine Arme auch.
Und sie haben Rex.
»Eigentlich müssen wir gleich los, aber wir haben noch eine Wette am Laufen. Wer von uns beiden dich dazu bringt, einen Ton von dir zu geben, gewinnt. Du bist wie ein Mäuschen, nicht wahr, Kleiner? Ganz schön traurig, echt.« Er sieht sich das Foto von Mommy, Daddy und mir an, auf dem wir alle drei so glücklich aussehen. Ich sitze auf Daddys Schoß und wir grinsen alle breit in die Kamera. Sogar unsere Hunde hocken auf dem Bild brav neben uns. »So ein schönes Leben, und dann ging alles den Bach runter.«
Er seufzt schwer und nimmt Rex in die Hand. »Kannst du zählen?«, fragt er mich.
Ich nicke knapp. Zähneknirschend fixiere ich meinen besten Freund.
Dann schreit auf einmal alles in mir auf, als er langsam Rex’ Beine herausreißt. Eins nach dem anderen. Er sagt, ich soll mitzählen. Die Zahlen laut aussprechen oder schreien. Doch als er merkt, dass ich keinen Ton von mir geben werde, lässt er meinen Freund auf den Boden fallen und zerquetscht ihn unter seinem Stiefel.
Ich sollte schreien. Ich sollte weinen. Ich sollte irgendwas tun.
Aber ich konnte ihn nicht beschützen, genau wie ich meine Mommy nicht beschützen konnte.
Ich habe versagt.
»Er ist extrem abgemagert«, sagt eine Frau, während ein Doktor mir in die Augen leuchtet. »Er trug eine schmutzige Windel, als sie ihn gefunden haben. Und er hat am ganzen Körper Entzündungen und Ausschlag.«
Jemand schnalzt mit der Zunge, und sofort habe ich Angst. Ich bin so müde, und ich will zu meiner Mommy und meinem Daddy. Ich will einfach nur nach Hause.
»Der Vater?«
»Tot. Suizid«, antwortet jemand leise, aber seit ich nicht mehr spreche, höre ich viel besser als früher – als könnte ich mich jetzt besser auf meine Umgebung konzentrieren. »Das Jugendamt bespricht sich gerade wegen einer Notunterkunft.«
»So schnell wird dieses Kind das Krankenhaus wohl nicht verlassen. Können wir den Tropf erneuern? Und wir müssen seine Blutwerte überprüfen. Er hat Einstiche an den Armen und in den Fußsohlen.«
»Er hat eine tote Spinne in der Tasche …« Die Stimme der Frau bricht ab. »Großer Gott«, flüstert sie dann.
Ich blinzle. Dauernd stellen sie mir Fragen, aber ich antworte nicht. Vielleicht tun sie mir sonst auch weh.
Eine Träne läuft mir über die Wange, als ich daran denke, wie ich neben Rex und meiner Mommy auf dem Boden gelegen habe. Sie wollten einfach beide nicht wieder aufwachen. Noch mehr Tränen fließen, dann spüre ich plötzlich eine Hand auf meiner Schulter und zucke zusammen.
»Du bist jetzt in Sicherheit«, sagt die Frau. »Kannst du mir sagen, wie du heißt?«
Sie wissen doch schon längst, wie ich heiße.
Ich heiße Malachi.
Ich presse die Lippen ganz fest zusammen und schließe die Augen. Wenn ich bis zehn zähle, verschwinden sie vielleicht alle wieder.
Also fange ich im Kopf an zu zählen. Aber ich weiß nicht mal, wie weit ich noch komme, da schlafe ich auch schon wieder ein.
Als ich Wochen später in mein erstes neues Zuhause gekommen bin, musste ich die meiste Zeit in meinem Zimmer bleiben. Angeblich wären die anderen Kinder sonst traurig geworden, weil ich nicht gesprochen habe.
Irgendwann wurde ich wieder in das große Gebäude voller Kinder zurückgeschickt, dann kam eine andere Familie und holte mich ab. Keine Ahnung, wie oft das passiert ist. Viele Mommys und Daddys holen ihre neuen Kinder ab und sehen total glücklich aus. Nur meine sehen schockiert aus, trotzdem geht es immer weiter und weiter. Niemand will mich als seinen Sohn haben. Niemand wählt mich jemals aus der Gruppe aus. Ich werde immer an verzweifelte Familien gegeben, doch am Ende funktioniert es nie, für keinen von uns.
An meinem achten Geburtstag bekomme ich keine Karten oder einen Kuchen wie die anderen Kinder im Waisenhaus – stattdessen hocke ich mit einer Zeichnung meiner Spinne unter dem Bett und stelle mir vor, wie mir ganz viele Leute zum Geburtstag gratulieren. Dann pusten wir zusammen die Kerzen aus, die ich gemalt habe.
Ich schließe die Augen und wünsche mir was.
Wünsche mir, dass sich auch mal jemand für mich entscheidet.
Schritte ertönen, dann geht meine Tür auf und ich warte darauf, dass an meinem Bein gezogen wird. Doch das passiert nicht. Sie sagen, das wäre eine Traumareaktion wegen meiner Vergangenheit. Der Albtraum, aus dem ich mich einfach nicht befreien kann. Vorsichtig luge ich unter dem Bett hervor.
Die Frau, der das Haus gehört, starrt auf mich herab. »Was machst du denn da unten?«
Ich versuche zu gebärden, wie sie es mir beigebracht haben, aber sie schüttelt den Kopf und tritt von mir zurück. »Egal. Zieh dich an und pack deine Sachen hier rein.«
Wie ein Roboter stehe ich auf und brauche ein paar Sekunden, um mich wieder an das Handzeichen für Warum? zu erinnern.
»Auf dich wartet ein Flugzeug«, sagt sie und reicht mir eine gebrauchte Plastiktüte. »Und eine neue Familie. Für sie gilt die gleiche Probezeit wie für die anderen. Benimmst du dich dieses Mal anständig? Diese Familie hat sich nämlich tatsächlich selbst für dich entschieden. Ich bin also ganz zuversichtlich.«
Ich benehme mich immer. Es gefällt ihnen nur einfach nicht, dass ich nicht normal bin. Sie wollten mit mir spielen und meine Freunde sein und alles. Aber ich wusste nie, wie das geht – und hatte Probleme, mich zu verständigen, weil keiner von ihnen die Gebärdensprache konnte. Und es wollte sie auch keiner lernen. Sie haben nur ständig versucht, mich zum Reden zu bringen, dabei bin ich total glücklich mit mir selbst. Es ist so schön friedlich und still in mir. Und das gefällt mir.
Bis jetzt war ich immer überall der Außenseiter, und das bin ich auch heute noch.
Ja, gebärde ich. Ich werde mich benehmen.
Als ich zum ersten Mal eine neue Familie gefunden hatte, war ich total begeistert. Das ist jetzt nicht mehr so.
Es dauert einen ganzen Tag, um den Ort zu erreichen, der für die nächsten Wochen mein Zuhause sein soll. Das Fliegen gefällt mir nicht, und die Dame, die mit mir reist, spricht kein einziges Mal mit mir – sie versteht nicht mal Gebärdensprache.
»Benimm dich heute so gut wie möglich, Malachi«, sagt sie streng, als ich mit meiner Plastiktüte neben ihr durch den überfüllten Flughafen gehe. Sie umklammert meine Hand ganz fest. »Ich will den ganzen Weg nicht noch mal zurückfliegen müssen, um dich wieder woanders hinzubringen.«
Damit meint sie, dass ich nicht seltsam sein und die Pflegetochter nicht erschrecken soll. Alle halten mich für seltsam. Sie haben Angst vor mir. Es gefällt ihnen nicht, dass ich sie so dazu bringe, sich unwohl zu fühlen.
Ich war schon in fünf Familien, und alle haben mich innerhalb weniger Wochen wieder zurückgegeben, als wäre ich ein kaputtes Spielzeug.
Wir erreichen die Leute, die gerade über mich reden, aber ich schaue unbeteiligt auf den Boden. Wie lange ich wohl hierbleiben werde?
Auch sie werden mich in mein Schlafzimmer einsperren und mich behandeln, als wäre ich zerbrechlich – ich werde das Kind sein, mit dem sie angeblich Mitleid haben, bis sie mich wieder zurückbringen.
Wenn sie mich wieder zurückschicken, was ganz bestimmt passieren wird, haue ich ab und sorge dafür, dass sie mich niemals finden.
Weil ich dann im Himmel bei meinen Eltern sein werde.
Meine Gedanken bleiben plötzlich stehen, als ein kleines Mädchen mit langen braunen Haaren vor mir auftaucht.
»Hi!« Sie grinst mich an und sagt: »Mein Name ist Olivia. Ich bin sieben!« Sie hält sieben Finger in die Höhe, und ich halte im Geiste acht hoch.
Hi, Olivia. Ich bin Malachi, will ich sagen oder gebärden, aber ich starre sie einfach nur an.
»Findest du, ich sehe aus wie eine Prinzessin?« In Gedanken nicke ich, doch körperlich trete ich nur einen Schritt vor. Ich mag sie – bei ihr fühle ich mich gar nicht komisch. Sie ist so glücklich im Vergleich zu allen anderen. Und sie freut sich, mich kennenzulernen.
Ich neige leicht den Kopf.
Ihr Lächeln verblasst ein wenig. »Gefällt dir mein Kleid nicht?«
Ohne nachzudenken, einfach nur, weil ich will, dass sie mich auch mag, hebe ich die Hände und gebärde: Bitte hab keine Angst vor mir.
Aber die Verwirrung auf ihrem Gesicht und der Blick, den sie ihrer Mom zuwirft, verraten mir, dass sie keine Ahnung hat, was ich ihr sagen will.
Das ist auch okay. Ich werde es ihr beibringen.
Ich gebärde das Gleiche noch mal, weil sie wissen soll, dass ich ihr keine Angst einjagen will – ich wünsche mir sehr, dass sie das weiß.
»War es gruselig im Flugzeug? Ich muss immer weinen, wenn es erst ganz schnell wird und dann in den Himmel steigt! Daddy will immer, dass wir fliegen. Er ist jetzt auch dein Daddy!«
Ich reibe mir den Nacken und zupfe an meinen Strähnen. Sie scheint wirklich glücklich zu sein – heißt das, dass sie ihre Familie mag? Ich möchte so gerne mit ihr reden, aber ich glaube nicht, dass ich es schaffe.
Sie will sich gerade wieder ihren Eltern zuwenden, aber ich berühre schnell ihr Handgelenk, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen, und gebärde: Komm mit mir.
Sie versteht immer noch nicht, also zeige ich auf die Drehtüren, und dann rennen wir Hand in Hand darauf zu – sie kichert, ihr Haar flattert wild, und ich entdecke ein Schild für die Toilette. Da drin werde ich versuchen, mit ihr zu reden. Weit weg von allen anderen.
»Wohin gehen wir?«, fragt sie und stolpert fast über ihre Füße. Ich fange sie rasch auf, bevor sie hinfällt, und ziehe sie weiter in Richtung der Toilette, wobei wir vielen Leuten ausweichen müssen.
Als wir drinnen sind, will sie wieder zurücklaufen, aber ich halte sie fest. Ich will mit dir reden, gebärde ich und zeige dann auf mich.
Mache ich ihr Angst? Habe ich jetzt schon wieder alles verdorben?
Sie wirkt immer noch verwirrt, also zeige ich auf meinen Mund und schüttle den Kopf, denn obwohl wir nur zu zweit sind, kann ich offenbar immer noch nicht sprechen. Dann zeige ich auf ihren Mund und nicke.
Ihre Lippen teilen sich. »Du kannst nicht sprechen?«
Ich schüttle den Kopf. Dabei möchte ich so gerne mit ihr reden, ihr sagen, dass ich vielleicht seltsam bin, aber ihr Freund sein könnte – ich bin harmlos. Ich … schaffe es nur einfach nicht.
»Das ist okay. Ich konnte auch ganz, ganz lange nicht sprechen! Ich bringe es dir bei.«
Ich halte kurz inne, dann verdrehe ich die Augen. Warum kann mich niemand einfach so akzeptieren, wie ich bin? Mir muss keiner beibringen, wie man spricht.
Ihre Augen sind so lebendig und bunt. Sie ist fröhlich, und sie ist sogar zu mir total nett.
Ich zeige auf sie und lege meine Handfläche auf meine Brust, während ich näher an sie herangehe. Ich möchte ihre Hand nehmen und sie dazu bringen, die gleiche Geste zu machen – um mir zu sagen, dass ich auch zu ihr gehöre, als ihr bester Freund und ihr Bruder –, aber bevor ich das tun kann, wird die Tür aufgestoßen. Mein neuer Pflegevater stürmt herein und die Mom hebt Olivia hoch.
»Ich hab dir doch gesagt, du sollst brav sein!«, brüllt er sie an, und ich will mit dem Fuß aufstampfen und ihm sagen, dass er sich verpissen soll, aber dann wendet er sich bereits mir zu. »Und du. Das war dein erster Fehltritt, junger Mann. Noch zwei, und dein Arsch wandert direkt in das nächste neue Zuhause. Du bist jetzt Malachi Vize, und die Vizes tanzen nicht aus der Reihe, also gewöhn dich lieber daran.«
Er schickt mich noch nicht zurück? Er gibt mir noch eine Chance? Ich darf bleiben?
Ich schaue das Mädchen an und senke den Kopf, dann gebärde ich: Tut mir leid.
»Er sagt, dass es ihm leidtut, Schatz«, sagt die Mom. »Er kommuniziert über Gebärdensprache.«
»Was ist das? Das will ich auch können!«
Bei ihren Worten schnellt mein Kopf nach oben. In meiner Brust erwacht ein kleiner aufgeregter Schwall zum Leben, vor allem, als die Mutter ihr sagt, dass sie es allen im Haus beibringen wird.
»Malachi soll sich bei uns zu Hause wohlfühlen. Er ist jetzt einer von uns.«
Ich halte meine Tränen zurück und blinzle ein paar Mal, als sie uns aus der Toilette führen. Die Hand des Dads liegt auf meiner Schulter, während er mich aus dem Flughafen und zu einem Auto dirigiert. Ich glaube, sie sind ganz schön reich. Ihr Auto ist riesig und schick, und das Haus, vor dem wir halten, gleicht einer Villa. Bei diesem Anblick weiten sich meine Augen ein wenig, dann huscht meine Aufmerksamkeit wieder zu dem Mädchen neben mir. Ich kann nicht aufhören, sie anzusehen. So gut habe ich mich nicht mehr gefühlt, seit mir Rex weggenommen wurde.
Sie wird mir niemand mehr wegnehmen. Dafür sorge ich. Ich werde ganz brav sein. Ich werde alles tun, was man mir sagt. Ich werde genau das Kind sein, das sie offensichtlich brauchen, um diese Familie komplett zu machen.
Olivia.
Meine neue kleine Schwester. Mom und Rex konnte ich nicht beschützen. Aber ich glaube, Olivia kann ich beschützen.
Ich werde sie beschützen.
Weil sie mir gehört.
Als ich aus dem Schulbus steige, werfe ich mir die Tasche über die Schulter und gehe direkt dorthin, wo ich meine Schwester mit Sicherheit finden werde. Olivia wird bei ihren Freundinnen stehen. Da steht sie immer. Sie bekommt auch immer sehr viel Aufmerksamkeit – weil sie total beliebt ist. Dienstags geht sie früher aus dem Haus als ich. Sie und ihre Freundinnen treffen sich schon seit Jahren dienstags eine Stunde früher vor der Schule und quatschen.
Sobald ich sie sehe, bleibe ich stehen, trete zur Seite und lehne mich mit dem Rücken an die Wand. Das ist meine übliche Position, während sich die Welt um mich herum weiterdreht. Ich folge ihr mit den Augen, als sie zu der Schaukel geht, auf der ihre Freundin Abigail bereits wartet. Sie setzt sich zu ihr, doch da sie mich nicht ansehen, kann ich nicht von ihren Lippen lesen – was, wenn sie gerade über mich spricht?
Ich werde mich nicht zu ihnen gesellen, aber solange ich sie sehen kann, bin ich glücklich. Ich stütze mich mit der Fußsohle an der Wand ab, dann halte ich die Luft an, als eine Gruppe von drei Jungen ebenfalls zu den Schaukeln geht.
Sie sind einen Jahrgang unter mir, vielleicht auch zwei, und ich überrage sie deutlich. Da ich der Größte in meiner Klasse bin und außerdem keine Freunde habe, weil niemand mit mir reden kann, bin ich hier in der Schule nicht gerade beliebt.
Sie nennen mich Freak.
Sie sagen, ich wäre total seltsam und merkwürdig.
Olivia glaubt das nicht, deshalb ist es mir völlig egal, was sie von mir halten. Ich bleibe sowieso lieber in meiner Ecke stehen und beobachte meine kleine Schwester aus der Ferne – und so nah wie möglich, wenn wir zu Hause sind. Nicht auf eine unheimliche Art und Weise – Mom findet nur, dass ich sie zu sehr beschütze, und Dad sagt mir regelmäßig, dass ich mich mal locker machen muss.
Mein Blut kocht, als einer von ihnen Olivia auf ihrer Schaukel anschubst, aber sie stößt sich einfach davon ab und kehrt ihm den Rücken zu. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, sie hat ihm gesagt, dass er sie in Ruhe lassen soll.
Als die Schulglocke läutet, zieht er an Olivias Haarband, und ich spüre sofort, wie Wut in mir aufsteigt. Sie stößt den Jungen gegen die Brust und geht von dem Trio weg. Er versucht noch einmal, sie zu packen, aber Olivia rennt weg, dicht gefolgt von Abigail.
Der Junge und seine Freunde lachen.
Ich stoße mich von der Wand ab und gehe direkt auf sie zu. Dabei beiße ich die Zähne so fest zusammen, dass es wehtut.
Niemand schikaniert meine kleine Schwester und kommt damit durch.
Ich folge ihnen mit nur einer einzigen Intention: Schmerz. Ich will ihnen wehtun. Die drei sind die Letzten, die den Spielplatz verlassen. Leise folge ich ihnen und lasse meinen Rucksack von den Schultern gleiten.
Dann umfasse ich den Riemen und schwinge ihn, wobei die Lunchbox von Mom und die Lehrbücher einen von ihnen so hart seitlich am Kopf treffen, dass er zu Boden geht.
Auch dem zweiten verpasse ich einen Hieb gegen den Kopf, als er versucht, zu entkommen, dann gehe ich auf den dritten los – derjenige, der gelacht hat, als er an Olivias Haarband gezogen und sie vertrieben hat.
»Was soll der Scheiß?«, ruft er, während ich ihn jage.
Ich will sein Blut sehen.
Er reißt eine Tür auf, und blind vor Wut renne ich prompt dagegen. Der Schmerz vernebelt mir die Sicht, trotzdem laufe ich weiter und trete ihm einmal heftig gegen die Knöchel. Er stolpert und geht zu Boden.
Ein Lehrer zerrt mich von ihm runter, kurz nachdem ich ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe.
Mitten in der Nacht werde ich von meinem Vater aus dem Bett und dem Schlafzimmer gezerrt, das ich mir mit meiner Schwester teile – seit Schulschluss lag ich im Bett und wollte niemanden sehen. Nicht einmal Olivia. Sie würde mich fragen, was mit meinem Auge passiert ist, und herausfinden, was ich getan habe. Ich kann ihr aber nicht sagen, dass ich ihretwegen irgendwelche Kids verprügelt habe.
Das würde ihr nur Angst machen. Und ich lasse nicht zu, dass sie Angst vor mir hat.
Dad lässt mich fallen, dann schlingt er seine Hand fest um mein Handgelenk und führt mich den Flur entlang, die große Treppe hinunter und in sein Büro. Er knallt die Tür zu und läuft auf und ab, während er sich mit den Händen durch sein silbriges Haar fährt.
»Was zum Teufel hast du dir nur dabei gedacht? Ich musste mir heute von deinem Schulleiter und mehreren Eltern anhören, dass du ihre Kinder angegriffen hast!«
Sie haben Olivia gemobbt, gebärde ich.
Er hält inne und lässt die Hände sinken.
Dann tritt er vor und packt meinen Kiefer. »Und was ist mit deinem Auge passiert?«
Verlegene Röte steigt mir in die Wangen. Ich bin gegen eine Tür gelaufen, als ich einen von ihnen verfolgt habe.
»Du kannst nicht einfach so irgendwelche Leute verprügeln. Du bist jetzt zwölf Jahre alt. Also noch nicht einmal ein Teenager, und schon brichst du den Leuten die Nasen!«
Das musste ich mir schon den ganzen Tag anhören: Wie kann jemand in meinem Alter nur so aggressiv sein? Seit wann ist das Alter dabei wichtig? Ich habe mich für meine Schwester eingesetzt – er sollte mir also lieber dankbar sein.
»Was soll ich nur mit dir machen?«
Bei der Frage straffe ich die Schultern, und meine Augen weiten sich ein wenig. Schick mich nicht zurück, gebärde ich. Ich verspreche auch, mich zu benehmen.
Dad geht zu seinem Schreibtisch, lehnt sich dagegen und verschränkt die Arme. »Ich schicke dich nirgendwo hin, Malachi. Ich will nur, dass du dich benimmst. Ich bin Anwalt, und ich kann es mir nicht leisten, in den Nachrichten zu landen, weil mein Sohn ausgerastet ist. Warum konntest du sie nicht einfach nur bedrohen? Ihnen sagen, dass sie sie in Ruhe lassen sollen? Oder noch besser: Du hättest es einem Lehrer oder mir sagen können.«
Alles, was ich verstanden habe, ist, dass er mich nicht wegschicken wird.
Ich seufze stumm vor Erleichterung, meine Schultern entspannen sich wieder ein wenig.
»Ich glaube, deine monatlichen Therapiesitzungen sollten häufiger stattfinden. Ich werde mit deinem Arzt besprechen, ob wöchentliche Termine möglich sind. Olivia weiß noch nichts von deiner Therapie, und sie soll auch nichts davon erfahren. Sie sieht in dir einen Anker, und das muss auch so bleiben. Mir wäre es also lieber, wenn das hier unter uns bleibt. Die Jungs wurden alle von der Schule genommen, weil ihre Eltern es dort nicht mehr für sicher halten. Bitte, um Himmels willen, Malachi, zettel einfach keine Schlägereien mehr an.«
Ich nicke und senke den Blick.
»Du hast deine Schwester mit dieser Aktion wirklich erschreckt. Geh wieder ins Zimmer, entschuldige dich bei ihr und geh dann schlafen. Deine Mutter wird morgen mit dir zum Arzt gehen, das Auge muss sich jemand ansehen.«
Ich habe sie erschreckt?
Ich stehe auf, verlasse das Büro und gehe in unser Schlafzimmer. Kaum habe ich die Tür geöffnet, setzt Olivia sich im Bett auf und reibt sich die Augen. »Malachi?«
Es tut mir leid, gebärde ich und lasse mich auf die Bettkante sinken. Es tut mir leid, wiederhole ich mit mehr Nachdruck und reibe dabei mit der Faust fest über meine Brust.
»Hat Dad dir wehgetan?«
Ich schüttle den Kopf, aber wahrscheinlich glaubt sie mir nicht. Dad hasst mich – da bin ich mir sicher. Manchmal schleppt er mich wegen der kleinsten Vorfälle in sein Büro, und er schreit mich auch viel öfter an als Olivia. Deshalb weiß ich, dass er uns nicht als gleichwertig betrachtet.
Ich bin der Sohn, den keiner von ihnen wollte, mit dem sie sich nun aber abfinden müssen. Sie glauben auch, dass der Therapeut weitere Tests mit mir durchführen muss – aber anscheinend bin ich noch nicht alt genug dafür, was auch immer das zu bedeuten hat.
Sie neigt den Kopf, ihr Haar fällt ihr ins Gesicht. Es riecht wie immer nach Erdbeeren – so zärtlich und beruhigend.
»Brauchst du eine Umarmung?«
Ich nicke und lege mich neben Olivia. Wir schlingen unsere Arme umeinander, halten uns gegenseitig fest und beschützen uns, so wie wir es schon immer getan haben, seit wir Bruder und Schwester geworden sind. Dann schlafen wir ein.
Olivias Musik ist total scheiße und macht mir verdammte Kopfschmerzen.
Wir joggen gerade in der Nähe der Villa, in Richtung des nahe gelegenen Sees. Sie läuft ständig vor mir her und bringt mich damit fast zum Stolpern. Ich könnte ihr ein Beinchen stellen und sie in den Dreck stürzen lassen, aber das würde mir später nur leid tun und ich müsste mich entschuldigen, daher entscheide ich mich dagegen.
Ihre lächerliche Popmusik dröhnt in meinem Ohr – Olivia hat den anderen Kopfhörer –, und sie hält problemlos mit meinem Lauftempo mit. Sie ist echt fit. Da sie Cheerleaderin ist und fast so viel trainiert wie ich, können wir viel Zeit miteinander verbringen. Ich gehe gerne laufen – genau wie sie.
Wir sind die perfekten Geschwister. Und so können wir noch öfter miteinander herumhängen.
Ist das seltsam? Selbst wenn, wäre es mir egal. Wenn ich bei meiner kleinen Schwester bin, habe ich immer viel bessere Laune. Als könnte ich nur dann die beste Version meiner selbst sein. Sie versucht nicht einmal, mich zum Reden zu bringen oder tut so, als würde mit mir etwas nicht stimmen. So wie meine Arschloch-Freunde.
Ich meine, sie sind keine echten Arschlöcher, aber sie sind auch nicht garkeine Arschlöcher.
Ich schüttle den Kopf, um mich wieder zu fokussieren, und mein Blick huscht zur Seite. Bemüht, nicht auf ihre Brüste zu starren, gebärde ich: Dad will mir nachher das Autofahren beibringen.
Sie lacht. »Das wird schrecklich. Er wird dich die ganze Zeit nur anschreien. Vielleicht solltest du lieber bei deinem Motorrad bleiben.«
Wahrscheinlich. Er ist nicht gerade geduldig, vor allem, seit ich im letzten Jahr in mehr Schlägereien verwickelt war, als ich zählen kann – und weil er mich mit einem Joint auf meinem Balkon erwischt hat.
Mittlerweile toleriert er mich. Ganze neun Jahre haben sie mich nun schon bei sich, deshalb können sie mich nicht einfach wieder zurück ins Waisenhaus schicken. Und so sehr ich auch davon überzeugt bin, dass mein Vater mich manchmal hasst, glaube ich trotzdem, dass er sich genug um mich sorgt, um mich nicht loswerden zu wollen.
Allerdings streiten wir oft miteinander, daher ist das vielleicht auch nur Wunschdenken.
»Lauf schneller, sonst wird das Bluetooth getrennt!«, ruft Olivia mir zu.
Ich blinzle und bemerke, dass ich schon ziemlich weit zurückgefallen bin. Aber ich lasse mir Zeit mit dem Aufholen und begutachte ihren Arsch. Im Geiste verpasse ich mir selbst eine Ohrfeige, weil sie nie wieder mit mir sprechen würde, wenn sie wüsste, dass ich sie auf diese Weise anschaue. Außerdem wäre ich diese beschissene Musik von irgendeiner Girlgroup los, wenn die Verbindung abreißt. Gerade singen sie irgendwas von einer Trennung.
Irgendwann hole ich sie trotzdem wieder ein, und als wir den See erreichen, wechselt ihre Musik zu einem ruhigeren Song. Sie beugt sich vor und atmet tief ein, während ich die Zigaretten aus meiner Hose ziehe und mir eine anzünde. Immer noch vorgebeugt, wirft sie mir einen Schulterblick zu und bedenkt mich mit einem Ausdruck, der mich definitiv nicht so sehr in den Bann ziehen sollte.
Stirnrunzelnd richtet sie sich auf. »Warum?«
Ich ziehe fragend eine Augenbraue hoch und hoffe bei Gott, dass sie ihren eigenen Bruder nicht gerade dabei erwischt hat, wie er sie angeiert.
»Rauchen ist total ungesund. Erst recht beim Joggen, Malachi.«
Hmm. Ich liebe es, wenn sie meinen Namen sagt.
Nein. Halt die Klappe.
»Mom und Dad werden es an dir riechen, wenn wir nach Hause kommen. Und ich werde nicht noch mal meinen Kopf für dich hinhalten, wenn sie dir in der Küche eine Standpauke halten.«
Ich zucke mit den Schultern und puste eine Rauchwolke über meinen Kopf, bevor ich mich gegen einen Baumstumpf lehne und zusehe, wie sie sich dehnt. Sie beugt sich wieder vor, berührt ihre Zehen, und ich hebe meinen Blick zum Himmel, bevor sie mich noch dabei erwischt, wie ich in ihren Ausschnitt starre.
Das ist neu.
Und ein bisschen abgefuckt.
Aber seit ein paar Monaten kann ich einfach nicht aufhören, Olivia anzuschauen und zu bemerken, dass sie nicht einfach nur hübsch ist – das war sie schon immer –, sondern sehr, sehr anziehend. Und zwar auf eine Weise, die sich für einen Bruder definitiv nicht gehört.
Immer wenn sie kichert oder mich anlächelt, bekomme ich dieses Gefühl … als würde ein ganzer Schwarm von Schmetterlingen mein Inneres aufwühlen. Es macht mich süchtig. Glücklich und nervös. Ich bemühe mich, ständig bei ihr zu sein, um dieses Gefühl aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig diskutiere ich mit den Stimmen in meinem Kopf, dass es komplett abgefuckt ist, auf jemanden zu stehen, den man als Schwester bezeichnet und mit dem man aufgewachsen ist.
Dad würde mich dafür aufhängen – und mich dann noch mal erschießen, nur um sicherzugehen, dass ich auch wirklich tot bin.
Wahrscheinlich würde ich trotzdem einen Weg finden, um in Olivias Nähe zu sein. Als Geist in ihrem Kleiderschrank oder als Monster unter ihrem Bett, mit dem sie sich anfreundet und das sie in den Schlaf kuschelt.
Ich runzle die Stirn über meine eigenen lächerlichen und unreifen Gedanken, während sie auf ihrem Handy herumtippt.
Vor uns geht gerade die Sonne auf, sie schimmert durch das Blätterdach der Bäume und umhüllt uns mit einem sanften Schein. Durch die Bäume sehen wir den Horizont immer heller werden. Der Anblick ist ständig derselbe, trotzdem fasziniert er uns jedes Mal aufs Neue.
Aber diesmal scheine ich der Einzige zu sein, dem es auffällt, denn Olivia tritt plötzlich neben mich, nimmt meine Zigarette und wirft sie in den See.
Ihre verengten Augen lassen mich schmunzeln.
Willst du der Kippe in den See folgen?, gebärde ich. Ich bin nämlich ganz kurz davor, dich hinterherzuwerfen.
Sie verschränkt die Arme und schiebt die Hüfte vor. »Das wagst du nicht.«
Sie quiekt, als ich sie packe, sie mir über die Schulter werfe und mit ihr zum Ufer gehe. Ihre nackten Beine strampeln, sie schreit meinen Namen und trommelt mir auf den Rücken. Nur wenige Zentimeter vom Wasser entfernt bleibe ich stehen und lache leise. Dann lasse ich sie an meiner Vorderseite hinuntergleiten und tue so, als wollte ich sie wirklich hineinwerfen. Hastig schlingt sie ihre Arme um meinen Hals.
Als sie auch noch ihre Beine um meine Taille legt und ihre Oberschenkel zusammenpresst, erstarre ich.
»Bitte nicht«, bettelt sie. »Ich flehe dich an.«
Fuck.
Sie ist mir viel zu nah.
Ich lasse sie fallen, als hätte ich mich an ihr verbrannt. Sie kann sich fangen, ohne dabei ins Wasser zu stolpern, und schlägt mir gegen die Schulter. »Du Arschloch!«
Plötzlich verspüre ich den heftigen Drang, ihr Gesicht zu umfassen und sie zu küssen.
Das Verlangen kommt abrupt, und es ist absurd und ganz neu. Ich habe Olivia schon eine Million Mal geküsst, allerdings nicht so, wie ich es jetzt gerade will. Es ist in so vielerlei Hinsicht einfach nur falsch.
Ich fühle mich ernsthaft zu meiner Schwester hingezogen. Das muss es wohl sein, oder? Es ist auch absolut unmöglich, mich nicht zu ihr hingezogen zu fühlen – für mich ist sie einfach ein verdammt perfektes Meisterwerk.
Die Erkenntnis trifft mich wie ein verdammter Flugzeugabsturz und lässt mich ein paar Mal blinzeln, bevor ich mich von ihr abwende. Mein Herz hämmert wie verrückt, als mir mein Unglück bewusst wird. Ich wusste schon immer, dass ich verkorkst bin, aber das? Das ist wirklich die Krönung. Dad will, dass ich wieder zur Therapie gehe und mir Medikamente verschreiben lasse. Vielleicht sollte ich das wirklich tun – nicht wegen meiner verkorksten Gedanken, sondern wegen der Gefühle, die ich definitiv nicht für Olivia haben sollte.
Gibt es Medikamente, die einen davon abhalten, seine Schwester küssen zu wollen?
Früher ging es mir nur darum, sie zu beschützen – eine Verbindung habe ich immer zu ihr gespürt, aber nicht auf diese Weise. Jetzt will ich sie auf einmal so küssen, wie es ein Junge nur mit seiner festen Freundin tun würde.
Meine Atmung verändert sich, und meine Gefühle verwirren mich komplett – außerdem ist sie mir immer noch zu nah. Meine Finger zucken, wollen sich in ihr Oberteil krallen und sie an mich ziehen, damit ich meinen Mund auf ihren pressen kann. Doch stattdessen trete ich zurück und schlucke schwer.
Sie tippt wieder auf ihrem Handy, während ich mir noch eine Zigarette anzünde und darauf achte, sie nicht anzuschauen. Sie ist völlig ungerührt und ahnt offenbar nicht, dass ihr Bruder gerade einen inneren Kampf ausfechtet, um nicht alles durch eine impulsive Handlung zu ruinieren. Wir beide sind jetzt sechzehn und siebzehn Jahre alt, aber immer noch viel zu jung für solche Gedanken.
Jetzt bin ich sauer. Weil ich mich in jemanden verknallt habe, den ich niemals haben kann. Ich will diese Wut auf die Welt loslassen, vielleicht einen Streit mit meinem Vater anzetteln, um zu sehen, ob er seine Drohungen wahrmachen und mir tatsächlich den Arsch versohlen würde.
Sie stellt sich neben mich, stupst mich mit der Schulter an und reckt ihr Kinn zum Sonnenaufgang. »Ich weiß, dass du ein Herz aus Stein hast, aber du musst zugeben, dass das wunderschön ist.«
Ja, das ist es, gebärde ich träge und beobachte sie weiter, während sie sich wieder der Aussicht zuwendet.
Mein Herz ist gar nicht aus Stein. Es ist nur gefüllt mit Gift.
Was würde sie tun, wenn ich sie jetzt einfach küsse? Würde sie den Kuss erwidern und mein kleines Geheimnis werden, oder würde sie sofort zu unseren Eltern rennen und mich aus der Familie verbannen lassen?
Sie könnte sich auch nur von mir abwenden, ohne irgendjemandem etwas zu verraten.
Das Risiko ist gewaltig, aber ich will ihre Lippen so unfassbar gern auf meinen spüren.
Nach einer Weile schlingt sie ihre Arme um meine Taille und legt den Kopf an meine Brust. So umklammert beobachten wir gemeinsam, wie die Sonne den Horizont erreicht, während ich den Erdbeerduft ihres Haares einatme und mit den Fingern durch die weichen Strähnen fahre. Wie immer.
Auch das ist nicht normal. Ich weiß selbst, dass es das nicht ist, trotzdem ist es mir egal.
Vor unseren Eltern oder Freunden können wir uns nicht so nahe sein. Ich wurde bereits auf die andere Seite der Villa verbannt, weil ich sie mal während eines Brettspiels auf den Mund geküsst habe.
Es war ein ganz unschuldiges Küsschen, aber Mom und Dad sind komplett ausgerastet.
Jetzt kommen wir uns daher nur noch heimlich so nahe. Wenn wir zusammen joggen oder uns in das Zimmer des anderen schleichen, um zu kuscheln. Oder wenn ich ihre Hand halte, nachdem ein Albtraum sie gequält hat.
Es gibt eine von der Gesellschaft gezogene Grenze, die es mir verbietet, mich in meine Schwester zu verlieben. Und die würde ich am liebsten in Stücke reißen. Um sie danach einfach abzufackeln – und mit ihr jeden anderen, der sonst noch zwischen uns beiden steht.
Ich liebe Olivia, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob es noch die gleiche Art von Liebe ist wie die während unserer Kindheit. Sie ist jetzt viel heftiger, brutaler, und ich habe das Gefühl, wenn sie mir befiehlt, vor ihr auf die Knie zu sinken und ihre verdammten Füße zu küssen, dann würde ich es tun. Ich würde alles tun, was sie von mir verlangt.
Fuck. Ich bin so was von am Arsch. Dad wird mich mit Sicherheit umbringen, weil ich solche Gefühle nicht für meine eigene Schwester haben sollte, verdammt noch mal.
»Ich muss dir was sagen«, murmelt sie plötzlich.
Was?
»Erinnerst du dich noch, wie Mom vor einer Weile von unserer Familientradition erzählt hat? Die in Bezug auf arrangierte Ehen?«
Ich knirsche mit den Zähnen, als ich daran zurückdenke, wie mir gesagt wurde, dass Olivia irgendwann mit jemandem verheiratet und mir weggenommen werden würde. Ja, ich erinnere mich sogar verdammt gut daran. Wie könnte ich das wohl Schlimmste, das ich je in meinem Leben gehört habe, vergessen?
»Tja, es geht schon los damit.«
Stirnrunzelnd sehe ich auf sie hinunter, während ich auf eine Erklärung warte, was zur Hölle sie wohl damit meint. Sie ist noch viel zu jung – und zu unschuldig –, um in so ein Leben hineingeworfen zu werden.
»Ähm …« Sie zögert, dann vergräbt sie ihr Gesicht an meiner Brust, um ihre Stimme zu dämpfen. »Mom arrangiert bereits die ersten Dates.«
Mein ganzer Körper versteift sich und ich höre sogar auf, ihr Haar zu streicheln.
»Das erste ist schon dieses Wochenende. Mom und ich besuchen ihn zu Hause, um mit seinen Eltern zu reden. Er ist nur wenig älter als ich und will mich unbedingt kennenlernen.«
Das ist komplett lächerlich. Sie ist doch gerade erst sechzehn!
Wenn ich sie jetzt mit einer Antwort beehren würde, käme es zu einem Streit. Ich würde es ihr verbieten, sie würde mir sagen, dass ich sie mal kann, und dann würden wir uns einen ganzen Tag lang anschweigen, bevor sich doch wieder einer von uns ins Zimmer des anderen schleicht.
»Ich hoffe, er ist zumindest nett. Nicht auszudenken, wenn er auch noch fies wäre. Dann müsste ich meinen großen Bruder losschicken, damit er ihn verprügelt.« Sie kichert, aber ich bin still, so schweigsam wie immer, und befürchte, vor Wut gleich ohnmächtig zu werden.
Ich stelle ihn mir schon in einem Leichensack vor.
Blutig.
In seine Einzelteile zerlegt.
Gewürfelt, zerhäckselt und pulverisiert.
Nicht länger existent.
Keiner wird jemals gut genug für Olivia sein.
»Ich muss bis zur Hochzeitsnacht Jungfrau bleiben. Nicht, dass ich in meinem Alter schon rumvögeln würde.« Olivia hebt den Kopf und sieht mich an. »Bist du noch Jungfrau?«
Auf ihre Frage ziehe ich die Augenbrauen zusammen. Das bin ich tatsächlich – der Gedanke an Sex hat mich noch nie gereizt. Ja, ich habe mir ein paar Pornos angesehen und mir einen runtergeholt, aber ich habe noch nie daran gedacht, tatsächlich loszuziehen und jemanden zu vögeln, wie es meine Freunde tun. Sie versuchen ständig, mich zu überreden, auch mal mit jemandem rumzumachen, aber am Ende verlasse ich die Party immer frühzeitig und nüchtern – oder so betrunken, dass ich nicht einmal mehr geradeaus sehen kann, während ich nach Hause zu meiner Schwester taumle. Dann kümmert sie sich immer um mich – sie bringt mir ein Glas Wasser, einen Eimer und drückt mir ein kaltes Tuch auf die Stirn, bis ich in ihren Armen das Bewusstsein verliere.
Sie presst die Lippen zusammen und sieht enttäuscht aus, als ihr klar wird, dass sie von mir keine Antwort darauf bekommt.
»Entschuldige. Das war unangebracht.«
Ich löse meine Hand aus ihrem Haar. Möchtest du denn heiraten?
Sie zuckt mit den Schultern. »Mom bereitet mich schon seit meiner Kindheit darauf vor. Sie hat sich sogar gefreut, als ich meine Periode bekommen habe, weil das Arrangement dadurch an Wert gewann.«
Ich schlucke und schmiede bereits Pläne, wie ich Olivia entführen kann, um sie vor diesem Leben zu beschützen.
»Ähm.« Sie verzieht das Gesicht. »Tut mir leid. Ich sorge noch dafür, dass dir gleich schlecht wird. Sorry.«
Du musst dich nicht entschuldigen, gebärde ich. Du kannst mit mir über alles reden und könntest mich durch nichts verschrecken.
Im Moment bin ich einfach nur wütend. Ich könnte unsere Eltern töten und es wie einen Unfall aussehen lassen. Ich könnte die beiden im Büro meines Vaters einsperren und das Haus in Brand setzen. Dann könnte ich Olivia eine Schulter zum Ausweinen anbieten und sie danach dazu bringen, sich bis über beide Ohren in mich zu verlieben.
Fuck. Das habe ich gerade tatsächlich gesagt.
Natürlich nur in Gedanken, trotzdem kann ich es jetzt nicht mehr zurücknehmen – ich will meine Schwester, und ich will sie sehr. Keine Ahnung, wie ich das hinbekommen soll, aber Olivia und ich werden gemeinsam unsere Jungfräulichkeit verlieren. Nicht jetzt gleich, aber in ein paar Jahren, wenn wir beide alt genug sind und wissen, wie es ablaufen sollte.
Wenn Olivia bereit ist, werde ich für sie da sein.
Mein Verstand muss sich ernsthaft wieder beruhigen. Wahrscheinlich sieht sie mich nur als ihren Bruder an, und allein der Gedanke, mich leidenschaftlich zu küssen, könnte sie anwidern.
Es sei denn, ich tue so, als wäre ich jemand anderes? Ich könnte vielleicht mein Gesicht vor ihr verbergen?
Nein, das würde den eigentlichen Zweck verfehlen.
Fuck.
Sie wird keinen anderen heiraten.
Nur mich. Ich werde mit unseren Eltern reden. Bestimmt wäre es ihnen auch lieber, wenn sie mit jemandem zusammen wäre, dem sie vertrauen, und nicht mit irgendeinem deutlich älteren Wichser.
Ich atme schwer durch die Nase aus, löse mich von ihr und deute in Richtung unserer Laufstrecke, die uns zurück nach Hause führt. Sie drückt noch einmal meine Hand, bevor sie ihre ohrenbetäubende Musik wieder einschaltet und wir uns auf den Heimweg begeben, um uns für die Schule fertig zu machen.
Mom und Dad sind im Büro meines Vaters, als wir von der Schule nach Hause kommen. Olivia verschwindet in ihrem Zimmer und zieht sich um. Sie trifft sich noch mit einer Freundin, mit der sie ein wenig trainieren will.
Ich gehe in Gedanken alles durch, was ich unseren Eltern mitteilen muss – ohne dass Olivia von meinem Plan erfährt. Oder davon, dass mir die Nerven durchgegangen und meine Knöchel immer noch wund sind, weil ich jemandem in der Umkleide die Scheiße aus dem Leib geprügelt habe.
Er sagte zu mir, dass er nicht versuchen würde, meine Schwester zu ficken – und es auf Video aufzunehmen –, wenn ich ihn laut darum bitten würde. Also habe ich seinen Kopf gegen die Bank geschleudert und ihm ein blaues Auge verpasst.
Dad wird inzwischen davon wissen, aber er hat es längst aufgegeben, mich zu disziplinieren. Er wird mich wieder verwarnen, versuchen, mich doch noch von der Therapie zu überzeugen, und mir dann noch einen Vortrag darüber halten, dass ich unser Zuhause zu unsicher für zukünftige Pflegekinder mache. Bla, bla und bla.
Ich setze mich doch nur für mich und meine Schwester ein – ich ziehe nicht einfach so drauflos und suche mir irgendein Opfer, aber das versteht hier niemand. Ich wurde als Problemkind abgestempelt, als Sohn mit schwerem Gepäck in Form eines Traumas. Für sie hätte es doch an ein Wunder gegrenzt, wenn ich normal geworden wäre.
Als ich das Büro erreiche, höre ich schon ihre Stimmen. Dad hält Mom gerade einen Vortrag über Olivias Alter und dass sie quasi dabei ist, Grooming mit ihr zu betreiben.
Fuck. Tief durchatmen.
Ich klopfe an die Bürotür, und das Getuschel dahinter verstummt.
»Herein!«, ruft mein Vater.
Als ich die Tür aufschiebe und eintrete, schauen sie mich beide irritiert an. Das mache ich sonst nie. Ich suche die beiden nicht auf. Ich gehe nicht zu ihnen, um etwas zu besprechen, solange es nicht absolut notwendig ist.
Ohne bestimmten Grund – ich spare mir meine Unterhaltungen eben für eine ganz bestimmte Person auf. Aber mir ist klar, dass sie sowieso lieber barfuß auf Legosteine treten würden, als sich mit mir zu unterhalten. Nicht einmal meine Freunde bekommen viel von mir zu hören. Nur einer von ihnen versteht die Gebärdensprache, und ihm reicht es, wenn er für die ganze Gruppe übersetzen muss.
Ehrlich gesagt bin ich mir immer noch nicht sicher, warum sie überhaupt mit mir befreundet sind. Sie haben mich erst in ihre kleine Gruppe aufgenommen, nachdem ich angefangen habe, die Leute zu verprügeln, die sich mit Olivia anlegen.
»Malachi?«
Ich blinzle und bemerke, dass ich vollkommen erstarrt dastehe, während meine Eltern mich ansehen, als hätte ich zwei Köpfe.
Ich meine, die habe ich ja auch.
»Stimmt was nicht?«, fragt Mom.
Olivia wird niemanden heiraten, gebärde ich, um direkt zur Sache zu kommen, und schließe die Tür hinter mir. Sie ist viel zu jung.
Mom schnaubt. »Raus hier, Malachi. Musst du nicht noch für deine Prüfung nächste Woche lernen?«
Ich trete vor. Warum muss sie denn heiraten?