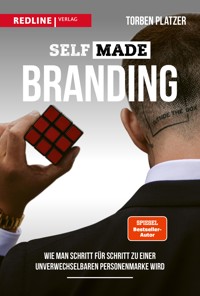Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Mit 27 sitze ich in meiner 1,5-Zimmer-Bude in Oldenburg und habe bis dahin alles gemacht, was meine Eltern von mir erwarteten: Abitur und Studium. Dann breche ich aus dem vorgezeichneten Leben aus, um meinen eigenen Weg zu gehen. Ich erkenne die Chancen von Internet und Social Media, baue mich selbst zur Marke auf und mache einen Umsatz in Millionenhöhe. In meinem Buch spreche ich offen über meine Fehler, meine Ängste und den Mut, Träume zu leben. Meine Botschaft: Dein Weg muss nicht kerzengerade verlaufen, der Glaube an dich selbst und die konsequente Umsetzung von Ideen machen dich langfristig auch außerhalb der Systemgrenzen glücklich. Sei stolz darauf, anders zu sein und OUTSIDE THE BOX nicht nur zu denken, sondern auch zu leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TORBEN PLATZER
LIVING A SELF MADE LIFE
TORBEN PLATZER
LIVING A SELF MADE LIFE
MIT DER RICHTIGEN EINSTELLUNG GEHST DU DEINEN WEG.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
FÜR FRAGEN UND ANREGUNGEN
Originalausgabe, 4. Auflage 2021
© 2021 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Christiane Otto
Korrektorat: Anja Hilgarth
Umschlaggestaltung: Sonja Vallant
Umschlagabbildung: © Torben Platzer
Layout und Satz: Ortrud Müller – Die Buchmacher, Köln
Druck: CPI books GmbH, Leck
ISBN Print 978-3-95972-369-5
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96092-681-8
ISBN E-Book (EPUB, Mobi 978-3-96092-682-5
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Definition: OUTSIDE THE BOX
Definition: SELFMADE LIFE
Prolog
Tag »X«: Rettung Realität – die Flucht aus der virtuellen Welt
Erste Erfahrungen im Chat
Verloren in der World of Warcraft
OUTSIDE THE BOX
Studentenzeit. Prädikat: Orientierungslos
Tag »X«: When opportunity knocks …
LIVING A SELFMADE LIFE
»Hello World« (Social Media)
Falsche Fünfziger: Geld versus Passion
Als Personenmarke in die Unabhängigkeit
MY ATTITUDE BROUGHT ME HERE
Der Autor
Definition: OUTSIDE THE BOX
Jemand, der kreative Ideen entwickelt und sie umsetzt, ohne sich limitieren oder kontrollieren zu lassen von Regeln, Traditionen und vorgegebenen Systemen.
Definition: SELFMADE LIFE
Den eigenen Weg gehen und nicht in bereits vorhandene Fußstapfen treten, sondern neben denen der Vorbilder eigene produzieren. Keinem System folgen, welches eine Nummer zuteilt und Abläufe vorgibt, sondern die eigene wahre Passion finden und diese leben.
Ich widme dieses Buch den Menschen, die mich unterstützt haben, anders zu denken, anders zu leben und anders zu sein. Dies ist ein Buch für alle, die gerne über den Tellerrand blicken, Konventionen hinterfragen und sich selbst als Außenseiter fühlen.
Wir können stolz darauf sein, wer wir sind, egal welchem Geschlecht, welcher Herkunft, Hautfarbe, Religion und welchen anderen Zuweisungen durch die Gesellschaft wir angehören.
Prolog
Es ist 3:16 Uhr, Sonntagnacht. Ich sitze mit einer rauchenden Shisha und einem Whiskyglas vor dem Rechner in meinem Münchener Loft, als ich anfange diese Zeilen zu schreiben. Ich bin kein großer Fan mehr von Drogen jeglicher Art, wie du im weiteren Verlauf dieses Buches noch näher erfahren wirst, aber ich brauche gerade jetzt einen kleinen Push, um endlich das aufzuschreiben, was schon sehr lange in meinen Notizen steht. Dabei lausche ich einem dreistündigen World of Warcraft-Soundtrack auf YouTube, der das Elwynn Forest Ambiente abspielt. Die Musik erinnert mich an eine unglaubliche Zeit, die sich wie Freiheit anfühlte, aber letztlich doch nur eine Flucht war.
Manche Dinge werde ich aus Gründen der Vernunft nicht schreiben, und auch weil meine PR-Beraterin Nina, an die ich an dieser Stelle liebe Grüße sende, sonst die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde, doch für alles andere gibt es jetzt kein Zurück mehr.
Vorher aber noch eine kurze Warnung: Es kann sein, dass dich einige Passagen in diesem Buch verwirren, wenn du mich bereits über die sozialen Medien kennst, andere werden dich belustigen und wieder andere dir vielleicht sogar Angst einjagen. Aber du kannst dir sicher sein, ich spreche nur über wahre Geschichten aus meinem Leben, die dazu beigetragen haben, dass ich zu der Person wurde, die ich heute bin. Lediglich Namen wurden zum Schutz der betreffenden Personen geändert. Und auch weil ich keine Lust habe, dass sie dieses Buch irgendwann aus den (virtuellen) Bücherläden klagen, da die Wahrheit oft schmerzlich sein kann.
2020 war ein komisches Jahr, und das Internet ist nun mit noch mehr Verschwörungstheorien gepflastert als nach dem Einsturz des World Trade Centers im Jahr 2001 oder dem Anschlag beim Boston-Marathon 2013. Viele wünschen sich einfach, aus einem zu lange andauernden Albtraum aufzuwachen, andere haben die letzten Monate genutzt, um Millionen von Euros zu verdienen mit der Digitalisierung, der Produktion von Gesichtsmasken oder dem Online-Verkauf von Toilettenpapier und Hygienemitteln.
ÜBER 300.000 MENSCHEN folgen mir seit drei Jahren über die sozialen Netzwerke, mehr als 30.000 Menschen schauen mir täglich zu, wenn ich mir morgens Content anschaue, ich mit meinem besten Freund unsere Branding-Agentur TPA Media weiterentwickle, wir mit der G-Klasse durch Deutschland cruisen oder ich interessante Menschen treffe und um die Welt reise.
NIEMAND hingegen hat gesehen, wie ich am ersten Schultag im Alter von sechs Jahren von einem Mitschüler verprügelt wurde und er mir die Schultüte vom Rücken getreten hat, oder wie ich im Alter von 15 Jahren auf eine siebenstellige Summe verklagt wurde, oder wie ich im Studium dafür ausgelacht wurde, als ich etwas anderes machen wollte, als ins Referendariat zu gehen und Lehrer zu werden.
Niemand war Zeuge, als ich hintergangen wurde von einem Freund, den ich über 15 Jahre kannte, und er mich in die Firmeninsolvenz trieb, sodass ich Angst um meine Existenz hatte und wusste, dass niemand mehr hinter mehr stehen würde, wenn ich scheiterte.
Ich möchte hier nicht auf deine Tränendrüse drücken, aber dir einfach beide Seiten der Medaille aufzeigen. Denn das Bild vom Unternehmertum, welches auf Social Media propagiert wird, ist eine Illusion.
Jeder ist immer auf der Suche nach dem einen Tipp, dem einen Buch, dem einen Hinweis, der genau erklärt, wie man erfolgreich wird, genügend Geld verdient und dann irgendwann ausgesorgt hat im Leben. Doch so funktioniert das Leben nicht. Das Leben ist zu vielfältig und facettenreich, um es mit so einem simplen Tipp in die Richtung zu lenken, die einem im Moment die liebste ist.
Vor allem benötigst du die richtige Einstellung, um dort anzukommen, wo du hinwillst. Und die habe ich auch nicht von heute auf morgen erlernt, sondern mir über die Jahre antrainiert. MY ATTITUDE BROUGHT ME HERE.
Ich halte nichts von strikten Reglements oder Definitionen, wann jemand etwas ist und wann nicht. Daher habe ich die letzten Jahre meinen Slogan »LIVING A SELFMADE LIFE« etabliert, der für mich ausdrückt: Lebe genau das Leben, das du schon immer wolltest. Ob das ein Leben in Saus und Braus ist, mit exzessiven Partys und Frauen in einer 20-Millionen-Dollar-Villa in den Hollywood Hills oder ob du lieber tagelang auf deinem kleinen Boot bist, um die Stille zu genießen und zu angeln, das sollte alleine deine Entscheidung sein. Geld spielt nur eine untergeordnete Rolle, denn am Ende ist es auch nur das Zahlungsmittel für das, was du zur Erfüllung deines »Traumlebens« brauchst. Auch macht es Vergleiche unbedeutend, denn jeder hat seine ganz eigene Definition von Erfüllung. Vergiss das nie.
Vor zwei Jahren war ich auf einem Mastermind Meeting01 in Los Angeles, und wir diskutierten über ein Sprichwort, das du mit Sicherheit auch kennst: »Alles, was er/sie anfasst, wird zu Gold.« Es wird häufig Bezug auf Menschen genommen, die anscheinend das Glück magisch anziehen. Man rechtfertigt damit Erfolge anderer, die man selbst nicht erzielen konnte. Aber im Grunde ist es ein Prinzip, das wir alle anwenden könnten:
Dwyane Wade, einer meiner Lieblingsbasketballspieler, schaffte 2006 in der Finalserie02 gegen Dallas den 4:2-Sieg, obwohl seine Mannschaft anfangs mit 0:2 Punkten zurücklag. Er gab in jedem Spiel sein Bestes, machte im Schnitt 37,4 Punkte, 172 insgesamt, und sorgte für Frustration bei Dirk Nowitzki, dem »deutschen Wunderkind«, der Backstage voller Wut in einen Mülleimer trat und mit seinem Fuß stecken blieb. Wade wurde zum MVP und hielt das Gold in seinen Händen.
ABC News berichtete von einer 22-jährigen Frau aus Virginia (USA), die einen BMW anhob, um ihren Vater zu retten, dem beim Reparieren des Autos der Wagenheber abgerutscht war.03 Die Wissenschaft begründet dieses Phänomen mit der sogenannten »hysterischen Kraft«, mit der Menschen Superkräfte hervorrufen können.04
Usain Bolt lief 2009 die 100 Meter in unter 10 Sekunden (9,58)05 und prägte damit wie kein anderer die Leichtathletik. Er schaffte etwas, was vorher als unmöglich galt.
Alle diese Menschen, so scheint es, hatten das nötige Quäntchen Glück im richtigen Augenblick, doch vielmehr waren es ihr eiserner Wille, etwas ganz Bestimmtes erreichen zu wollen, und die richtige Einstellung, jeden möglichen Preis dafür zu zahlen, die sie letztendlich so weit gebracht haben. Auch ich musste viel Lehrgeld zahlen, das darfst du mir glauben. Und du wirst auch den einen oder anderen Preis zahlen müssen, wenn du dich für einen ähnlichen Weg entscheidest.
Je mehr ich für das, was ich wollte, kämpfte, desto mehr Glück schien ich nach außen zu haben.
Auf unserer Welt gibt es drei Arten von Menschen:
diejenigen unter uns, die alles beobachten,
einige wenige, die Dinge auch umsetzen, und
sehr viele Menschen, die sich über alles wundern und darüber reden, was passiert.
Ich gehörte lange zu der dritten Kategorie, denn ich habe schon damals in der Schule nicht verstanden, wieso einige so gut darin waren, hervorragende Noten zu bekommen, bei Frauen gut anzukommen oder immer der Beste in jeder Sportart zu sein. Was hatten diese Menschen denn, was ich nicht hatte?
Ich sah die Hintergründe ihrer Erfolge erst viel später, aber um es dem Verlauf des Buches vorwegzunehmen: Vor allem erkannten sie ihre Talente und nutzten sie. Ich möchte dir dabei helfen, deine Talente ebenfalls zu erkennen und diese zu stärken.
Du kennst doch bestimmt auch das Sprichwort »Hard work beats talent«, aber ich frage dich: Was passiert, wenn jemand mit Talent genauso viel Arbeit investiert wie du? Er wird immer die Nase vorn haben, weil es ihm leichter fällt zu lernen, zu üben und vor allem Spaß dabei zu haben, weil er die Verbesserung sieht und daran glaubt.
Sein Talent früh zu erkennen und gezielt auszubilden, ist wahrscheinlich einer der stärksten Wegweiser. Ich brauchte 27 Jahre, um das zu erkennen, denn bis dahin fühlte sich alles an wie der Aufenthalt in einer fremden Stadt ohne Google Maps.
Fun Fact: Ich bin groß geworden in einer Zeit, da gab es kein Google Maps. Noch nicht mal Smartphones, auf denen es gelaufen wäre.. Wir sind in den Jaderberg Tier- und Freizeitpark mithilfe einer physischen Landkarte gefahren, in der meine Mutter Wegweiser markiert und sich Notizen gemacht hatte, welche Ausfahrt wir am besten nehmen sollten. Jedes zweite Mal kamen wir dort auch vor Sonnenuntergang an.
Ich war schon immer eher ein schüchterner Typ, der tendenziell in der Ecke stand und hoffte, dass ihn keiner ansprach. Sicherlich haben auch meine schlechten Erfahrungen in der Schule dazu beigetragen, dass ich mich nie traute, wirklich aus mir herauszugehen.
So ging es mir, bis ich für mich eine neue Art der Kommunikation entdeckte, die es mir ermöglichte, vom heimischen Schreibtisch aus genau das zu tun: in Social Media und dem Internet aktiv und erfolgreich sein.
Schon im Alter von zehn Jahren bekam ich meinen ersten Rechner. Wir hatten ein 56-K-Modem, mit dem man sich ins Internet einwählen musste. Wenn man Pech hatte, war die Leitung besetzt, und man musste es später erneut versuchen.
Ich machte meine ersten Erfahrungen mit Computerspielen, in denen Figuren ein einziger großer Pixel waren, und lernte Menschen in öffentlichen Chats kennen. Später kamen Messenger-Dienste wie ICQ und AIM hinzu, irgendwann auch die Socials wie Facebook und Instagram. Hier konnte man Bilder hochladen, später auch Videos.
In eine Kamera zu sprechen fühlte sich zwar anfangs komisch an, es war jedoch viel leichter, als jemand anderem in die Augen zu schauen.
Über diese neuen Wege im Internet fand ich zu anderen Menschen und Unternehmungen und realisierte so am Ende auch mein eigenes SELFMADE LIFE.
Hast du manchmal das Gefühl, nicht reinzupassen? In die Gruppe? In die Beziehung? Oder vielleicht sogar in diese Welt? Ich kenne das, und die gute Nachricht ist: Obwohl es sich jetzt noch nicht gut anfühlt, kann diese Empfindung deine große Chance sein, auf die du bis heute gewartet hast.
Wir alle werden in ein System geboren, das von Menschen, Institutionen, Politik und anderen Mächten legitimiert wird. Sie reden von Freiheit, aber wie frei sind wir wirklich, wenn wir in einer Kultur groß werden, in der immer noch schwarz oder weiß gedacht wird, wenn unser Schulsystem immer noch auf dem Stand von 1960 ist, wenn wir nur nach Leistung und Noten bewertet werden und wenn sich junge Menschen nicht nach ihren Talenten entwickeln können. Wenn Menschen uns Dinge beibringen, die sie selbst nur aus Büchern kennen, wenn wir bestimmte Leute in bestimmten Positionen nicht kritisieren dürfen, ohne Gefahr zu laufen, sanktioniert zu werden, wenn unser Denken jeden Tag durch Massenmedien manipuliert wird und wenn nur die wenigsten eine Chance haben, das zu erkennen?
Wer OUTSIDE THE BOX denkt, wird von der Gesellschaft oft als »Freak«, »Außenseiter« oder schlimmer noch »Querulant« betitelt. Für mich ist genau das die einzige persönliche Freiheit, die uns bleibt: Ein Leben ohne Vorgaben und Regeln ist sonst nicht möglich, vor allem nicht, wenn du die Vorzüge unseres Systems und unserer Gesellschaft nutzen möchtest. Aber du kannst die Spielregeln, die oft gegen dich sind, umdrehen und so das Spiel zu deinen Gunsten wenden, wenn du die Freiheit des Denkens kennenlernst und die Möglichkeiten der Visualisierung nutzt.
Denn keine physischen Grenzen sind so stark und hoch wie die eigenen Mauern in unserem Kopf.
Mein Buch allein wird nicht sofort alle Mauern einreißen, doch wenn es dazu führt, dass du von nun an manches differenzierter siehst oder auch einmal mehr hinterfragst, für dich neu abwägst und dann deinen Weg gehst, habe ich mein Ziel erreicht. Wir können gemeinsam ein Feuer entfachen und Menschen begeistern, wenn wir wirklich überzeugt von etwas sind. Das hier ist mein Versuch.
Vielleicht ist dir auf dem Cover und in den sozialen Medien das »X« aufgefallen, das ich auch am Hals tätowiert habe und als Kette trage. Es erinnert mich an meine Tage »X«, von denen ich dir erzählen werde. Das waren Tage, die mein Leben für immer verändern sollten. Gleichzeitig ist es auch das Symbol des Andersseins, ein Leben OUTSIDE THE BOX zu realisieren, zu denken und zu handeln. Wir leben oft in einer unsichtbaren Box, die wir gar nicht wahrnehmen, und nur selten setzen wir uns Ziele, die darüber hinausgehen, selten trauen wir uns, Dinge zu sagen, die außerhalb des gebräuchlichen Denkens liegen, selten machen wir einen Schritt nach draußen, weil die Angst, dabei gesehen zu werden, zu groß ist.
Das »X« ist für mich mein persönlicher EXIT aus der Box, und vielleicht erkennst du dich an der ein oder anderen Stelle wieder, und es wird auch zu deinem.
Ich schreibe darüber, was mich geprägt hat und welche Erfahrungen ich machen musste, um mich als Außenseiter zu fühlen, warum Menschen manchmal so sind, wie sie sind, und wie du diejenigen mit guten Absichten von denen unterscheidest, die schlechte haben. Ich beschreibe, was passierte, als ich realisiert habe, dass ich anders bin, und warum zwei große Entscheidungen mein Leben für immer verändern sollten.
Die folgenden Kapitel sind wie ein kleines Tagebuch zu lesen, ein Tagebuch, das niemand in die Hände bekommen sollte, wenn es nach den meisten geht, weil ich hier offen über Dinge spreche, wo viele eine Zensur einschieben, und ich bin froh, Menschen an meiner Seite zu haben, die mir die Möglichkeit dazu geben und mich dabei unterstützen.
Das hier ist kein »SELF HELP«, »GET RICH QUICK« oder Ähnliches von einem Bühnenakrobaten, der dich in die Hände klatschen lässt oder dich bittet, auf die Stühle zu steigen und die Energie, die du in dir hast, rauszulassen. Ich will dich nicht hypnotisieren und dir auch nichts von neurolinguistischen Mustern erzählen, die dir dabei helfen, Menschen zu manipulieren. Ich möchte nicht, dass du deine Augen schließt und mit mir eine Traumreise machst, in der du dir vorstellst, jemand anderes zu sein. Ich möchte dich vielmehr aus dem Traum der Illusionen reißen, bevor er zu deinem Albtraum wird.
Tag »X«: Rettung Realität – die Flucht aus der virtuellen Welt
Alles, was ich brauch, ist meine Gang, meine Gang … «, dröhnte es dumpf durch die Wände. Es klang so, als wenn man sich die Ohren zuhält, weil man Cro nicht mehr hören will. Doch ich hörte das aus der Wohnung unter mir. Antjes Wohnung. Die Wohnung, die zwar auch nur 55 Quadratmeter groß war, ähnlich wie meine, aber in die sich an diesem Tag einfach jeder aus dem Fotografie-Einstiegskurs quetschte, weil sie ihren Geburtstag feierte.
Ich war jedenfalls nicht eingeladen, obwohl ich den kürzesten Weg gehabt hätte. Es wären wahrscheinlich 45 Sekunden gewesen, wenn ich langsam die Treppen heruntergegangen wäre, 20 Sekunden, wenn ich mich beeilt hätte (was der Fall gewesen wäre, denn ich stand schon sehr auf sie). Stattdessen lief ich Kreise in meiner Studentenbude:
»Wie kann es sein, dass ich einfach nicht eingeladen werde?«, fragte ich mich permanent selbst.
In der vorangegangenen Woche hatte ich mit ihr noch darüber geredet, als wir zusammen vor der Dunkelkammer standen, und sie hatte mir erzählt, dass sie auch aus BWL noch ein paar Typen einladen würde, weil es ja sonst nur Mädels wären. Man muss an der Stelle erwähnen, dass ich Germanistik und Kunst auf Lehramt studierte. Eine bessere Kombination gab es für einen Single-Kerl eigentlich gar nicht, weil in Germanistik 90 Prozent der Studenten weiblich waren, und in Kunst hatten (inklusive mir) ganze drei Männer überhaupt in diesem Jahr das Studienfach gewählt – und bei den anderen beiden wusste man, dass sie eher einander bevorzugten als das weibliche Geschlecht.
»Was willst du mit den Snobs?«, hatte ich Antje verspottet, dabei hatte ich selbst noch ein Jahr zuvor versucht, BWL zu studieren, als ich nicht wusste, mit welchen Fächern ich mich immatrikulieren sollte. Ich war jedoch mit 0,3 Punkten am NC gescheitert.
Jetzt waren genau diese »Snobs« da unten. Déjà-vu: Und ich war wieder der, der scheiterte.
»Soll ich einfach runtergehen?«, fragte ich mich. Was sollte schon passieren, wenn ich klopfte und sie einfach begrüßte. Sie würde mich wohl kaum nach Hause schicken. Egal wie dicht sie war, sie würde mich schon erkennen. Wir hatten letzte Woche gerade erst miteinander gesprochen. Es war ja nicht so, als ob sie mich gar nicht kennen würde.
Aber was war, wenn so ein Möchtegern aufmachte und mir die Tür direkt wieder vor der Nase zuschlug, weil er vor den anderen den Dicken machen wollte? Wir sprechen hier von einem 1,5-Zimmer-Apartment, EINEINHALB ausgeschrieben – das Wort ist größer als der Raum.
Einen solchen Vorfall würde jeder mitbekommen, und ich brauchte in der folgenden Woche gar nicht mehr zu Uni zu gehen.
»Xoui? Bist du noch da. Dein Mic geht nicht mehr oder bist du echt noch AFK?«
Ich setzte mein Headset wieder auf, aber ließ den Ton weiter ausgeschaltet, und Natalia laberte immer weiter von Instanzen, Bossen und Waffen, aber ich nahm das alles nur noch, wie die Musik von Cro, ganz dumpf wahr.
Natalia war übrigens keine heiße Gamer-Frau, die da mit mir im Teamspeak herumhing, sondern ein Typ. Andi hieß er, und er hatte sich entschieden, in World of Warcraft eine weibliche Orc-Jägerin zu spielen, die er Natalia nannte. Er war unglaublich gut, verursachte bei jedem Boss am meisten Schaden und brachte uns im Raid echt nach vorne. Im wahren Leben war Andi arbeitslos, lebte bei seinen Eltern und bezeichnete sich selbst als »fettleibig«. Ich habe allerdings nie ein Bild von ihm gesehen und kann das also nicht bestätigen. Seine Hunterin sah jedenfalls toll aus. Sie war schlank und hatte fast das komplette Set voll.
»Und dann brauchen wir endlich einen neuen Priester. Den Neuen kannst du doch vergessen. Letzte Ini hat er mich einfach im Feuer verrecken lassen, ich war vielleicht eine Sekunde da drin, okay vielleicht zwei, aber safe nicht mehr. Ich schwöre!«
Ich zockte schon den ganzen Tag mit ihm, seit ich aus der Vorlesung nach Hause gekommen war, und eigentlich liebte ich genau das: allein zu Hause sein und Computer spielen. Aber dieser eine Abend, den hätte ich gern woanders verbracht. Meine Gedanken schweiften ab, und ich stellte mir vor, unten bei Antje zu sein und mit ihr anzustoßen, Kuchen zu essen und zu lachen und ... AUS. SCHWARZ.
In diesem Moment passierte etwas mit mir, was ich so noch nie erlebt hatte: Meine Augen wanderten ganz langsam durch den Raum, und ich schaute mir die weißen Wände an. Sie waren so strahlend weiß, auch weil ich in der Studentenbude der Erstbezug war und sie deshalb gerade erst frisch gestrichen worden waren.
Mir war etwas kalt, und ich rieb meine Hände. Ich saß ewig auf meinem Bett, vergaß die Zeit. Es musste mitten in der Nacht gewesen sein, vielleicht bereits 2:00 oder 3:00 Uhr. Ich nahm irgendwann mein Headset ab und legte es neben mich aufs Bett. Ich machte alles ganz langsam, als hätte ich damals schon bewusstes Atmen à la Wim Hof geübt.
Dieses Gefühl, wenn du deinen eigenen Atem hörst, weil du nachdenkst und gerade alles um dich herum ausblendest. Es war einfach dieser Moment, der den Prozess in Gang setzte, der schon länger tief in mir drin arbeitete, wie in einer FBI-Serie, wenn der eine Agent sich bei den Feinden einschleust und teilweise Jahre darauf wartet, dass die Operation gestartet wird, und dann genau weiß, was er tun muss, weil er es tausende Male durchgesprochen und durchgeprobt hat: »Code ROT, Sie wissen, was zu tun ist, Agent.«
Ich stand auf und ging zum DSL-Router, zog den Stecker und setzte mich an den Rechner. Ich deinstallierte meine Computerspiele. Ich hatte sowieso nur zwei auf dem Computer, denn wenn ich etwas spielte, dann richtig. In World of Warcraft hatte ich über 600 Tage »played« Spielzeit. Das heißt, fast zwei Jahre meines Lebens war ich aktiv in der virtuellen Welt gewesen. Das Spiel selbst war drei Jahre zuvor erschienen.
Was ich tat, fühlte sich in einer Sekunde richtig an, in der anderen falsch, aber ich konnte nicht aufhören. Ich war wie ferngesteuert.
Stille. In dieser Nacht verliebte ich mich in sie. Obwohl es in diesem Studentenwohnheim nie wirklich ruhig war, hörte ich einfach nichts. Ich lehnte mich in mir selbst zurück, und in mir war nur Leere. Einatmen. Ausatmen. Ich hatte das noch nie ausgehalten, bis zu diesem Zeitpunkt. Ich musste immer in Bewegung sein, durch mein Zimmer laufen, mit den Beinen wippen, etwas nebenbei laufen haben wie den Fernseher oder nebenher im Teamspeak mit den Jungs reden. Selbst wenn ich abends ins Bett war, ließ ich eine Serie an, einen Livestream oder schaute noch ein YouTube-Video. Aber jetzt war da gerade gar nichts. Alles aus. Bis es hell wurde und die Vögel anfingen zu zwitschern, was oft in den Sommerferien das Zeichen für mich gewesen war, ins Bett zu gehen. 5:00 oder 6:00 Uhr morgens wird es gewesen sein, und ich saß immer noch da. Wenn ich heute daran zurückdenke, war es einer von zwei Tagen, die ich nie vergessen werde.
Als ich irgendwann einschlief, wusste ich, dass am nächsten Tag ein neues Kapitel beginnen würde, und die Seiten würden nicht leer sein, weil man die Vergangenheit nicht ausradieren kann. Aber man kann umblättern und eine neue Seite beschreiben. Es war der Tag, an dem ich die Entscheidung traf, dass ich kein Held mehr in der virtuellen Welt sein wollte, keine Schlachten mehr gewinnen mochte, die von Spieleherstellern programmiert wurden. Stattdessen war ich der Meinung, dass das echte Leben spannendere Kämpfe für mich bereithielt. Und das tat es.
GAMERSPRACHE
Die Gamer Community hat ihre ganz eigene Sprache, in der viele englische Begriffe benutzt werden – hier eine kleine Übersetzungshilfe:
»MIC«: Abkürzung für Microphone.
»AFK«: Kurz für »Away from Keyboard« (man ist gerade nicht am Rechner).
»TEAMSPEAK«: Kommunikationsprogramm, über das man miteinander sprechen kann.
»RAID«: So nennt man in World of Warcraft Instanzen, in denen Bosse besiegt werden.
»HUNTERIN«: Ein Charakter aus World of Warcraft, den man spielen kann,
»INI«: Abkürzung für Instanzen.
»GEDROPPT«: Ein Gegenstand wurde von einem Boss fallen gelassen, nachdem er getötet wurde.
»ENTMUTE«: Mikrofon aktivieren.
Erste Erfahrungen im Chat
Du denkst dir jetzt wahrscheinlich: »Was macht der Typ für ein Fass auf, wenn er ein Computerspiel löscht? Das hat doch jeder schon mal gemacht.«
Aber das war tatsächlich bei mir aus einer anderen Perspektive zu sehen: Seit ich zwölf Jahre alt war, begleitete mich der eigene PC zu Hause und wurde mit der Zeit zu meinem besten Freund. Ich war nie besonders gut mit Konsole und Gameboy und hatte auch selten Leute, mit denen ich spielen konnte. Deshalb wollte ich unbedingt einen Computer haben und hatte meinen Eltern so lange damit in den Ohren gelegen, bis sie ihn mir kauften. Als Einzelkind, das antiautoritär erzogen worden ist, hat man schon so seine Vorteile.
Mit 14 schenkte meine Oma mir das Spiel »Warcraft III – Reign of Chaos«, weil ich das erste Mal keine Fünf oder Sechs in Mathe mit nach Hause gebracht hatte, und – möge sie in Frieden ruhen – sie hatte keine Ahnung, dass dieses Spiel der Auslöser für die nächsten Abgründe in meinem Leben sein sollte, denn damit begannen die Kapitel »Spielesucht« und »E-Sport« auf einem ganz anderen Level.
Doch wie kam es eigentlich dazu, dass nicht Tim oder Carsten meine besten Freunde waren, sondern dieser Intel-Pentium-Prozessor, und wer war eigentlich Lan und wieso feierte er so viele Partys? Vorsicht … flacher Gamerwitz (es gab übrigens auch eine tolle StudiVz-Gruppe, die so hieß. Alle, die wie ich der älteren Generation angehören, erinnern sich vielleicht noch daran).
Ich weiß noch genau, wie es war, als ich eingeschult wurde und meine Eltern mir den Eastpack-Rucksack auf den Rücken schnallten. Ich war sechs Jahre alt und kam gerade aus dem Spielkreis, der mich in den letzten zwei Monaten vom Unterricht suspendiert hatte, weil ich Zahnstocher in Knetgummi versteckt und ein anderes Kind animiert hatte, mit voller Wucht auf die Knetmasse zu schlagen (»Hey Uli, ich wette, du bekommst den Haufen nicht mit einem Schlag komplett platt«), was damit geendet hatte, dass die Erzieherin sich übergeben und Uli ein ungewolltes Piercing in seiner Hand gehabt hatte.
Genau genommen hatte sich der Zahnstocher in die weiche Haut zwischen Daumen und Zeigefinger gebohrt, in diesen Hautlappen dort. Ganz sauber und fast ohne Blut hatte er dort dringesteckt. Die Erzieherin war komplett überfordert gewesen und hatte nicht gewusst, ob man ihn nun herausziehen sollte oder nicht. Dabei hat man doch schon x-fach in Autopsie-Sendungen gesehen, dass man Gegenstände, die sich ungewollt durch Körperteile gebohrt haben, immer drinnen lässt, da sonst beim Herausziehen Innereien verletzt werden. Uli hatte erst geweint, als die Sanitäter gekommen waren und das Adrenalin nachgelassen hatte. Ann-Kathrin, das Mädchen, das mich überhaupt erst zu der Sache inspiriert hatte, hatte neben mir gestanden und auch geweint. Ich hatte alles sehr spannend gefunden. Uli hätte sich auch einfach nicht zu ihr in die Kuschelecke setzen müssen, denn das war mein Platz gewesen. Und dann wäre das auch alles nicht passiert. Selber schuld.
Jetzt war aber Einschulung, ich sollte ein Erstklässler werden, und das würde mein Karma aus Spielkreis und Kindergarten ja wohl resetten, dachte ich. Eigentlich wusste ich damals aber noch gar nicht, dass es so etwas wie ein Karma gibt.
Ich sollte also nun die Kids kennenlernen, mit denen ich die nächsten vier Jahre verbringen durfte. Als ich klein war, gab es nämlich noch die Orientierungsstufe: die fünfte und sechste Klasse, die dazu dienten, herauszufinden, ob du eine Empfehlung für die Hauptschule, Realschule oder das Gymnasium erhältst. Zwei Klassen, die also die ersten vier Jahre Schule, die ich jetzt vor mir hatte, irrelevant machten, da die dort erworbenen Noten nicht mit in die Beurteilung einflossen. Die Orientierungsstufe bedeutete für mich zwei Jahre enormen Druck, denn meine Mutter sprach schon seit ich denken kann vom Abitur: »Ohne Abitur, Torben, bist du nichts!«
Ich hatte keinen Bock auf Schule. Meine Mutter fuhr mich mit dem Auto hin, und ich ging hinein. Meine Klassenlehrerin hieß Frau Müller. Sie hatte graue lockige Haare und sah aus wie jemand, der in den Ferien ein Buch auf dem Boot las und zu Hause gerne barfuß rumlief – einfach sympathisch. Frau Müller sah leider auch aus wie eine gute Mutter, deshalb wurde sie im zweiten Jahr schwanger, und Herr Meier, der Rektor, ersetzte sie. Er war alt, haarlos und weniger nett. Er hatte keine Kinder. Es war vielleicht doch Karma.
Schon in der ersten Pause bildeten sich kleine Gruppen, man sprach über Stickerhefte, Fußball und noch andere Sportarten. Erik war Handballer, groß gewachsen und hatte schwarze Haare. Seine Schneidezähne standen übereinander, und es bildeten sich so weiße Flecken darauf. Kommt von zu viel Fluorid in der Zahnpasta. Das weißt du natürlich, wenn deine Mutter beim Zahnarzt arbeitet. Eriks Mutter arbeitete beim Arbeitsamt als Telefonistin. Er war der Lauteste und kam sehr gut an. Auch Marcel war einer der Gruppenanführer. Er war dick und fragte mich immer, was ich zu essen dabeihatte. Wenn es Cini Minis waren, sagte er: »Gib mal!« und aß alle auf. Er atmete schwer, und sein Schmatzen war so laut, dass ich nicht mehr weiß, was ich unangenehmer fand. Auf jeden Fall machte er mir Angst.
Mascha und Tanja waren die hübschesten Mädchen, vor allem Tanja sah echt interessant aus: Sie hatte wellige zweifarbige Haare. Ich weiß nicht, ob es von Natur aus so war oder gefärbt, aber ich mochte es. Heute würde ich zu ihr sagen: »Oh, Ombre«, um mit Fachwörtern zu beeindrucken, damals sagte ich nichts.
Die beiden führten die Mädels der Klasse an und sprangen Seil in den Pausen und liebten es, über ihre Geburtstagsfeiern zu sprechen und wen sie alles einladen würden – teilweise sechs bis acht Monate, bevor sie überhaupt stattfanden.
Ich fand anfangs keinen guten Zeitpunkt, um in die Gespräche einzusteigen, wusste nicht, was ich wirklich erzählten sollte, und gehörte dann keiner Gruppierung an. Dementsprechend stand ich meist allein rum und konnte sicher sein, auch weiterhin nicht angesprochen zu werden – meist erfolgreich. Wenn ich nach Hause kam, spielte ich »Pitfall« und »Earthworm Jim«. Da ich gefühlt der Erste war, der in der Klasse einen Computer besaß, war auch das kein Thema, um mich mit anderen auszutauschen.
Einmal kam Marcel zu mir in der Pause, und noch bevor er mich ansprechen konnte, sagte ich: »Salami-Brot.« Ich machte eine kurze Pause und fügte hinzu: »Ohne Butter!«
Er schaute kurz enttäuscht nach unten, fragte mich dann aber, ob ich Lust hätte, später zu spielen und ob ich den neuen Gameboy Color hätte.
Ich war verwundert, fühlte mich geehrt und ängstlich zugleich und hatte das Gefühl, besser zu nicken, anstatt lange zu überlegen.
Marcel wohnte nur eine Straße weiter und konnte zu Fuß zu mir kommen.
Wir saßen in meinem Zimmer, tranken Fanta und spielten »Batman« an meinem Gameboy. Ich spielte es selbst zum ersten Mal. Marcel wurde sehr emotional, als ich an der Reihe war: »Komm, versau das jetzt nicht! Wir hatten noch nie so viel Leben, als wir dort waren.« Ich dachte mir nur: »Wir waren noch nie dort!«
Batman starb, und Marcel schlug mir auf die Schulter.
»Ah, das tat weh, Marcel. Wieso machst du das?«, fragte ich ihn.
Er schlug noch einmal und erwiderte: »Weil du ein Noob bist!«
Das ist Gamersprache für »Anfänger«. Ich wusste nicht, wie ich in so einer Situation reagieren sollte, ich fühlte einen Schmerz auf der Schulter, dachte an den blauen Fleck und dass man ihn nicht sehen würde unter dem Pullover und ging aus dem Zimmer. Im Flur sprach mich meine Mutter an: »Alles ok, Torben? Wollt ihr noch etwas trinken?«
Ich nickte, ohne etwas zu sagen. Planloses Nicken war zu der Zeit noch voll mein Ding.
»Frag Marcel doch, ob er gleich noch zum Essen bleiben will. Ich mach Fischstäbchen«, sagte sie fürsorglich.
Ich hasste das, denn ich wollte nicht, dass er zum Essen blieb, wollte auch nicht, dass meine Eltern mit ihm redeten. Die würden mich doch bestimmt blamieren und irgendeinen Mist erzählen. Ich ging zurück ins Zimmer, brachte Fanta und Süßigkeiten mit, um ihn zu besänftigen.
Marcel griff sofort zu und fing an zu schmatzen. Und laut zu atmen. Wie so ein Tier, dem du zur Ablenkung ein Stück Fleisch hinwirfst, damit es dich nicht frisst.
Ich erzählte ihm, dass wir gleich zu Oma müssten und zum Essen eingeladen waren, er stopfte sich die Hosentaschen mit Kinder-Schokobons voll und ging. An der Tür boxte er mich noch einmal auf die Schulter und lachte.
Ich war so froh, dass er endlich weg war, und aß allein in meinem Zimmer vor dem Rechner. Ich befühlte noch einmal die Stelle, auf die er mich dreimal geschlagen hatte. Die schmerzte.
Ich fand einfach keinen Anschluss in der Schule und hatte auch keine Lust mehr, andere Jungs einzuladen. Ich fand mich damit ab, was auch kein Problem war, weil ich nach der Schule sowieso immer vor dem Rechner saß und bis abends durchspielte. Die Zeit verging recht flott, bis die ersten Sommerferien anfingen. Es war extrem heiß in Delmenhorst, und ich schwitzte vor dem Rechner. Die meisten Spiele konnte ich inzwischen im Schlaf. Die Möglichkeit, gegen andere online zu zocken, gab es noch nicht.
In Delmenhorst passierte allgemein nicht viel. 77.000 Einwohner, die meisten mit Migrationshintergrund, viele Dönerbuden und Sarah Connor.
Eines Nachmittags klingelte es bei uns an der Tür. Ich weiß nicht wieso, aber ich hasste schon immer die Türklingel: Bis heute noch löst sie bei mir Stress aus, weil man nicht weiß, wer etwas von einem möchte. So auch damals. Meine Mutter bekam Besuch von einer Freundin aus der Nachbarschaft, und sie brachte ihren Sohn mit. Er hieß Danny und war zwei Jahre älter als ich. Meine Mutter klopfte an meiner Zimmertür und fragte, ob ich rauskommen wollte, um Danny kennenzulernen und mit ihm zu spielen. Ich setzte mein Headset ab, verneinte und fuchtelte mit meinen Händen, um meiner Mutter klarzumachen, sie solle mich jetzt nicht stören. Immerhin half ich Erdwurm Jim gerade, den Schleimendboss zu besiegen. Doch ich starb und ging auf die Dachterrasse.
»Hey Torben! Was geht?«, sagte Danny und streckte mir die Hand entgegen. Bis Corona kam, war es üblich, sich die Hand zu geben zur Begrüßung (nur für diejenigen unter euch, die sich vielleicht nicht mehr erinnern).
Wir zogen los und gingen hinters Haus: Dort war ein Industriegebiet, das bald abgerissen werden sollte für eine Neubausiedlung. Jetzt war es voll mit meterhohen Gräsern und Gestrüpp, Bäumen und einer alten Fabrikhalle. Auf diesem Grundstück bin ich ein Jahr später fast gestorben. Zu Danny entwickelte sich meine erste Freundschaft. Wir bauten ein Baumhaus, von dem ich runterfiel und 30 Zentimeter neben einem senkrecht stehenden Nagel aufkam, der sich auch in meinen Kopf oder Bauch hätte bohren können.
Wenn Danny abends nach Hause ging, setzte ich mich vor den PC und fing an, vor Langeweile bei Google Begriffe einzugeben. Einer dieser Begriffe war »Chat«, und ich traf dort auf ein Forum namens »Unikum«.