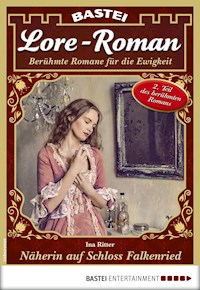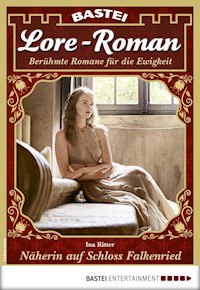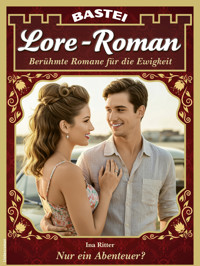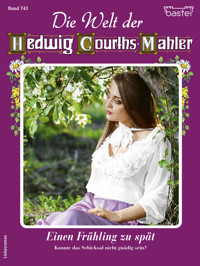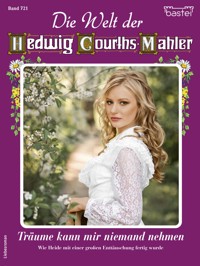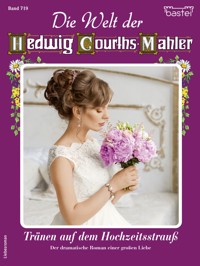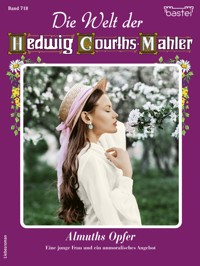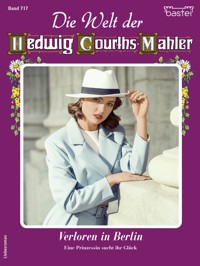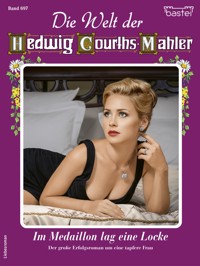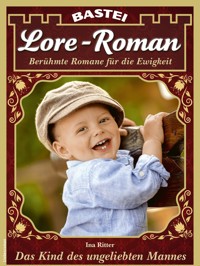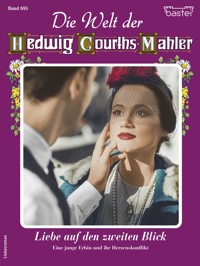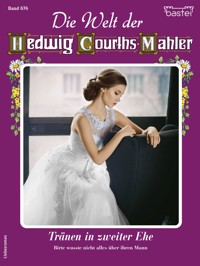1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dr. Kathrin Lambert ist Ärztin geworden, um Menschen zu helfen, sie zu heilen. Und doch kann sie trotz aller Bemühungen nichts für den Menschen tun, der ihr am wichtigsten ist: ihre Mutter. Ihr Leben lang hat Frau Ingeborg dafür geschuftet, dass Kathrin studieren konnte, ist unsagbar stolz auf ihre Tochter - und jetzt, nach einem Unfall, ist sie durch eine unheilbare Rückenmarkslähmung dazu verurteilt, ihr Dasein bewegungsunfähig und ans Bett gefesselt in einer kargen Behausung zu fristen. Nur die Morphiumspritzen, die Kathrin Abend für Abend aus der Klinik mitbringt, erleichtern Frau Ingeborg für einige Stunden ihr Leiden. Nicht nur einmal äußert sie dann den Wunsch, Kathrin möge ihr doch einfach etwas mehr von dem erlösenden Gift verabreichen - endlich schlafen, für immer ... Doch Kathrin hat wie alle Ärzte einen Eid geschworen: "Niemandem werde ich ein tödliches Gift verabreichen oder auch anraten, selbst wenn er mich darum bittet." Wird sie den Schwur halten können?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 150
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Dr. Kathrins Schweigepflicht
Vorschau
Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen?
Impressum
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsbeginn
Impressum
Dr. Kathrins Schweigepflicht
Roman um das Schicksal einer Assistenzärztin
Von Ina Ritter
Dr. Kathrin Lambert ist Ärztin geworden, um Menschen zu helfen, sie zu heilen. Und doch kann sie trotz aller Bemühungen nichts für den Menschen tun, der ihr am wichtigsten ist: ihre Mutter. Ihr Leben lang hat Frau Ingeborg dafür geschuftet, dass Kathrin studieren konnte, ist unsagbar stolz auf ihre Tochter – und jetzt, nach einem Unfall, ist sie durch eine unheilbare Rückenmarkslähmung dazu verurteilt, ihr Dasein bewegungsunfähig und ans Bett gefesselt in einer kargen Behausung zu fristen.
Nur die Morphiumspritzen, die Kathrin Abend für Abend aus der Klinik mitbringt, erleichtern Frau Ingeborg für einige Stunden ihr Leiden. Nicht nur einmal äußert sie dann den Wunsch, Kathrin möge ihr doch einfach etwas mehr von dem erlösenden Gift verabreichen – endlich schlafen, für immer ... Doch Kathrin hat wie alle Ärzte einen Eid geschworen: »Niemandem werde ich ein tödliches Gift verabreichen oder auch anraten, selbst wenn er mich darum bittet.« Wird sie den Schwur halten können?
Fast jeder Mensch schwört im Laufe seines Lebens einmal einen Eid. Vor Gericht, als Soldat, es gibt viele Möglichkeiten und Anlässe.
Auf jeden Fall schwört jeder Arzt den Eid des Hippokrates. Er schwört bei Apoll, dass er zum Heile der Kranken arbeiten will, so gut er es kann und weiß.
Er schwört: »Niemandem werde ich ein tödliches Gift verabreichen oder auch anraten, selbst wenn er mich darum bittet.«
Ein Arzt will helfen, deshalb ist er ja Arzt geworden.
Auch Kathrin Lambert hatte vor drei Jahren diesen Schwur nachgesprochen: »Ich will niemanden töten, auch wenn er mich darum bittet ...«
Vor einem Arzt hat man keine Geheimnisse, ihm kann man das Allerletzte anvertrauen, weil man weiß, dass er sein Wissen nur zum Nutzen und Frommen der Kranken anwendet. Deshalb der Eid des Hippokrates.
Und wenn ein Arzt dagegen verstößt ...?
***
Der Straßenbahnwagen rüttelte Kathrin Lamberts müden Körper hin und her. Mit geschlossenen Augen stand die junge Ärztin im Mittelgang und umklammerte automatisch die Haltestange, um nicht umzufallen.
Gestern hatte sie wieder Nachtdienst gehabt, dann musste sie den ganzen Tag arbeiten, und jetzt, es war schon spät, die Dunkelheit längst hereingebrochen, fuhr sie erst nach Hause.
»Goethestraße ...«
Kathrin schreckte aus ihrem Dahindämmern auf und drängte sich zum Ausgang.
Die frische Luft auf der Straße tat der jungen Frau gut. Sie sog sie in tiefen Zügen in ihre Lunge, ihr Kopf wurde wieder ein wenig klarer, und etwas von der bleiernen Müdigkeit, die ihren Schädel zusammenpresste und das Denken erschwerte, verschwand.
Die Bahn fuhr kreischend um die Ecke, als Kathrin mit schnellen Schritten die Straße hinuntereilte. Hohe graue Mietshäuser, deren Fenster zum Teil noch mit Pappe vernagelt waren, ab und zu eine Ruine, die gespenstisch leer zum Himmel ragte, auf den Trümmern Unkraut, das hier prächtig gedieh und den Schutt und den Schmutz gnädig verdeckte.
Kathrin beachtete ihre Umgebung nicht. Sie wollte nach Hause, schlafen, vergessen.
Die Haustür quietschte in den Angeln. Niemand machte sich die Mühe, die Scharniere zu schmieren, denn das Haus war keinem mehr ein Heim, nur ein Dach über dem Kopf, nichts weiter.
Kathrin wohnte im vierten Stock, hatte dort ein Zimmer mit ihrer Mutter zusammen, einen immer dunklen Raum, dessen einziges Fenster auf die teerbestrichene Wand des Nachbarhauses zeigte. Aber sie musste froh sein, dass sie wenigstens dieses Zimmer hatte. Andere wohnten noch viel schlechter, und ihre Mutter brauchte Ruhe und Pflege, vor allem Pflege.
Die junge Frau presste ihre Handtasche fest unter den linken Arm, als sie mit der rechten Hand den Schlüssel ins Schloss führte. Der durchdringende Geruch nach Kohl schlug ihr auf dem kleinen Flur entgegen, von dem die Zimmer abgingen, fast alle von Familien bewohnt, die die Küche gemeinsam benutzten.
Vierundzwanzig Stunden Dienst lagen hinter ihr, sie war zum Umfallen müde und musste jetzt doch ein frisches und zuversichtliches Lächeln auf ihr Gesicht legen, sie musste Frohsinn ausstrahlen, sich zusammenreißen, um das Zimmer betreten zu können.
Es war ärmlich eingerichtet, aber peinlich sauber. Kathrins erster Blick fiel wie immer auf das Bett, auf ihre Mutter, die bei ihrem Eintritt den Kopf gedreht hatte und ihr entgegenschaute.
Die junge Ärztin stellte ihre Tasche auf den Holztisch, zog ihren Mantel aus und hängte ihn sorgfältig auf einen Bügel. Es war ihr einziger Mantel, und sie mochte nicht an den Winter denken, für den er viel zu dünn war.
»Wie geht es dir, Muttchen?«
Sie zwang sich zur Munterkeit, als sie an das Bett trat und über die fahlen blaugeäderten Hände strich, die sich nicht hoben, um sie zu begrüßen.
»Gut«, flüsterte die Frau, deren Haar schlohweiß war.
Ihre blutleeren Lippen hoben sich kaum von der fahlen Haut ab, bewegungslos lag sie im Bett und schaute zu ihrer Tochter empor.
Ein Flehen lag in diesem Blick, und Kathrin beantwortete die nicht ausgesprochene Frage durch ein Kopfnicken. Sie wandte sich hastig um, und ihre Lippen zuckten, als würde sie gleich zu weinen beginnen, als sie ihre Handtasche öffnete und eine Ampulle herausnahm.
Jeden Tag wiederholte sich diese Szene: Als Erstes gab sie der Mutter eine Spritze – Morphium, das kostbare, lebenszerstörende Medikament, das nicht half, sondern nur linderte.
Frau Ingeborgs scharfe Züge entspannten sich allmählich, als das Medikament zu wirken begann. Ihr rasselnder Atem wurde gleichmäßiger, sie verzog den Mund sogar zur Andeutung eines Lächelns.
»Danke«, flüsterte sie.
Fast ein Dreivierteljahr hatte sie im Krankenhaus gelegen, auf Kathrin Lamberts Station, und dann hatte sie entlassen werden müssen, weil man das Bett brauchte.
»Ich verstehe, was in Ihnen vor sich geht, Kollegin«, hatte der Chef, Professor Schiller, anteilnehmend gemeint und Kathrin seine Hand auf die Schulter gelegt. »Aber es muss sein, die Betten sind so knapp, und ... Sie wissen selbst am besten, dass wir Ihrer Frau Mutter nicht helfen können. Sie kann zu Hause ebenso gut liegen wie hier.«
Kathrin begann hastig, das Zimmer zu säubern, mit dem Staubtuch in der Hand wischte sie über die Möbel.
»Du arbeitest zu viel, Kathrin«, klagte Frau Ingeborg mit brüchiger Stimme.
Früher hatte sie anders gesprochen. Früher ... wie lange lag das schon zurück! Das war zu der Zeit, als die Mutter für Kathrin arbeitete, ihr das Studium ermöglichte, mit ihr zusammen von der Zukunft träumte.
Aber da war sie noch gesund gewesen – und jetzt gelähmt. Ihr Rückenmark war verletzt worden, und es gab keine Möglichkeit, es wieder zu heilen.
War das ein Leben? Vierundzwanzig Stunden am Tag lag sie hier im Bett, allein mit sich und ihrer Verzweiflung, die immer größer wurde, denn Frau Ingeborg wusste um ihren Zustand ganz genau Bescheid.
Kathrin war Ärztin geworden, und nur die Mutter allein wusste, mit wie vielen Opfern und Entbehrungen ihr Studium erkauft worden war.
Der Vater war viel zu früh gestorben, Frau Ingeborg hatte arbeiten müssen, und weil sie nichts gelernt hatte, blieb ihr nur übrig, für einen kargen Lohn Büroräume zu säubern.
Aber sie wusste wenigstens, wofür sie lebte, sie hatte ein Ziel. Kathrin war begabt, und Frau Ingeborg erinnerte sich noch gut an ihren Stolz über die spielerische Leichtigkeit, mit der ihre Tochter das Abitur gemacht hatte.
Und sie hatte es geschafft: Kathrin Lambert, ihre Tochter, war Ärztin geworden ...
Im Zimmer war es inzwischen ganz dunkel. Kathrin drehte den Lichtschalter herum, aber die Birne an der Decke flammte nicht auf.
»Stromsperre, Kind«, erklärte Frau Ingeborg. »Hast du schon gegessen?«
Kathrin nickte. Oberschwester Luise sorgte dafür, dass sie aus der Gemeinschaftsküche mitversorgt wurde, es war eine große Erleichterung für sie, dass sie nach ihrer Heimkehr nicht mehr zu kochen brauchte. Das, was sie auf Marken bekam, konnte sie für die Mutter lassen, und es war trotzdem noch wenig genug.
Eine halbe Stunde später lag sie im Bett, und während Frau Ingeborg keinen Schlaf finden konnte, hatte Kathrin kaum noch die Kraft, die Decke hochzuziehen, da war sie schon eingeschlafen.
Frau Ingeborg schaute zur Seite, den Kopf konnte sie noch drehen, sie sah, dass die Decke von Kathrins Schulter heruntergeglitten war. Das Kind würde frieren, und sie ... sie konnte sich nicht zu ihr hinüberbeugen und die Decke in die Höhe ziehen, wie sie es früher immer getan hatte.
Warten, das war das einzige, was ihr geblieben war. Ein Leben lang Arbeit und Mühe für ihr Kind, und dann, als sie glaubte, es geschafft zu haben, da war plötzlich alles ganz anders. Es war schwer für Frau Ingeborg, nicht mit dem Schicksal zu hadern.
Die Geräusche im Hause verstummten allmählich.
Es wird nach Mitternacht sein, wusste die alte Frau, denn vorher gab es doch keine Ruhe hier. Und dann kamen die Schmerzen wieder, erst wie eine Ahnung, und sie presste abwehrbereit ihren Mund zusammen.
Sie hatte Angst vor diesen Schmerzen, Stunde um Stunde quälten sie sie, und nur die Spritze, die Kathrin ihr gab, verschaffte vorübergehend Erleichterung. Doch ihre Tochter schlief an ihrer Seite tief und fest, schlief den Schlaf völliger Erschöpfung.
Schweiß strömte über Frau Ingeborgs Gesicht, ihr Blick suchte die Tasche auf dem Tisch, ein undeutlicher Schatten, der sich fahl gegen den schwarzen Hintergrund des Schrankes abhob.
In der Tasche waren die Ampullen, dort war die Schmerzlosigkeit für Stunden, und neben ihr schlief Kathrin.
Kathrin musste schlafen. Erst wenn sie erwachte, würde sie sie um die Spritze bitten, und bis dahin musste sie sich zusammennehmen.
Es gelang der jungen Ärztin am nächsten Morgen nur schlecht, ihr Entsetzen über den Kräfteverfall der Mutter zu verbergen. Mit bebenden Händen sägte sie den Hals der Ampulle ab und füllte die Spritze.
»Danke ...« Die Mutter schaute an ihr vorbei. »Kathrin ...«
Ihre Tochter richtete sich steif empor. Irgendetwas in der Stimme der Mutter elektrisierte sie. Sie starrte auf die vertrauten Züge, die plötzlich fremd aussahen.
»Kathrin ... gib mir ... mehr ... ich will schlafen ... immer ...«
Die junge Ärztin schluckte, presste unwillkürlich die Handtasche fest an sich, weil in ihr die kostbaren, unersetzlichen, lindernden – und todbringenden Ampullen waren.
»Ich muss jetzt gehen, Muttchen, ich werde versuchen, heute pünktlicher nach Hause zu kommen.«
Wie gehetzt lief sie davon.
Hoffnungslos?, fragte sich Kathrin, als sie die Treppe des Hauses hinunterjagte, die Tasche fest an sich gepresst. So lange man lebt, hofft man, man darf sich nicht aufgeben, vielleicht findet man noch etwas gegen Mutters Lähmung ...
Die Straßenbahn ratterte heran, Kathrin zwängte sich hinein und dachte dabei nur an ihre Mutter, an ihre flehende Bitte, die Frau Ingeborg das erste Mal ausgestoßen hatte.
»Gib mir mehr ... ich möchte schlafen ... immer ...«
Nein, dachte sie verzweifelt. Nein, Mutter, das geht nicht.
***
Schwester Luise erschrak, als Kathrin das Stationszimmer betrat und sich offenbar tief in Gedanken umschaute, als sähe sie diesen Raum zum ersten Mal. Die alte Schwester schob den Stuhl zurück und ging ihr entgegen, nahm ihr den Mantel ab, den Kathrin sich gedankenlos abstreifen ließ, und blieb abwartend vor der jungen Ärztin stehen.
»Fräulein Doktor ...«
Kathrin hörte sie nicht. Noch immer starrten ihre Augen blicklos ins Leere.
Jetzt wird Mutter schlafen, dachte sie. Drei Stunden, vielleicht auch vier hält die Spritze vor. Und dann?
»Der Patient auf Nummer 5 hat eine unruhige Nacht gehabt, Fräulein Doktor«, berichtete Schwester Luise.
Und dann wird Mutter wieder Schmerzen haben, sie wird immer zur Tür schauen und auf mich warten, auf die Spritze, stoben die Gedanken durch Kathrins Kopf. Sie braucht jetzt schon doppelt so viel wie vor einem halben Jahr. Und sie wird noch lange leben, und immer mehr Morphium wird sie brauchen ...
»Es scheint ... dass eine Wundinfektion vorliegt«, fuhr Schwester Luise fort.
Ein unheimliches Gefühl presste ihr Herz zusammen. Alle im Krankenhaus mochten die junge Ärztin gern.
»Kommen Sie!«, befahl sie energisch und packte den Arm der Ärztin.
»Was sagten Sie, Schwester Luise?«
Wie aus einem Traum erwachend strich Kathrin sich über die Stirn. Sie war ja hier im Arbeitszimmer, ein neuer Tag begann.
Geduldig wiederholte die Schwester ihren Bericht, Kathrin versteifte ihren Kopf im Nacken, griff nach dem weißen Mantel, ließ sich von der Schwester hineinhelfen und trat auf den Gang hinaus.
»Temperatur?«, fragte sie knapp, ganz auf den Fall konzentriert, den sie jetzt zu behandeln hatte.
Eine Stunde später machte sie ihre Visite, und niemand, der sie in die Säle treten sah, konnte vermuten, dass schwere Sorgen sie bedrückten.
Der Maurer Fritz Kahlau, den der Chef selbst vor drei Wochen operiert hatte, richtete sich im Bett empor und strahlte Kathrin voller Verehrung an.
»Wie geht es Ihnen, Herr Kahlau?«
Gewohnheitsmäßig warf die Ärztin einen Blick auf die Fieberkurve und nickte ihm dann befriedigt zu.
»Gut, Fräulein Doktor«, rief der stets fröhliche Mann. »Und dies hier hat meine Frau für Sie mitgebracht.« Etwas verlegen nahm er eine Tüte vom Nachtschrank und drückte sie Kathrin in die Hand. »Wo Obst doch jetzt so knapp ist ...«
»Aber Herr Kahlau ... das kann ich doch nicht annehmen«, wehrte Kathrin entsetzt ab.
»Doch, Fräulein Doktor, behalten Sie nur das Obst. Sie sehen immer so blass aus. Ich glaube, Sie arbeiten zu viel.«
»Dann schönen Dank, Herr Kahlau.«
Kathrin strich ihm über seine Rechte, die auf der Bettdecke lag, und ging weiter.
Ich werde das Obst für Mutter mitnehmen, beschloss sie kurz darauf, als sie die Tüte auf ihren Tisch im Ärztezimmer legte.
Oberarzt Dietmar Eich, der ebenfalls in dem Raum anwesend war, wunderte sich über die geistesabwesende Haltung seiner Kollegin. Er kannte sie anders: energisch, zielbewusst, sehr klug und überlegen, eine Ärztin, wie sie sein sollte.
Darum trat er jetzt auf Kathrin zu und legte ihr leicht seine Hand auf den Arm.
»Ist etwas Unangenehmes passiert, Kollegin?«
Kathrin zuckte erschrocken zusammen, weil sie niemanden um sich herum wahrgenommen hatte. Mühsam lächelte sie ihm zu.
»Nein, nein, es ist nichts weiter, Herr Oberarzt ...« Sie brach ab, schaute an ihm vorbei und hatte die Unterlippe zwischen die Zähne gezogen. »Nur ...«
Die junge Ärztin trat ans Fenster. Sie empfand es als wohltuend, dass der Oberarzt ihre Gedanken mit keiner Frage störte. Er stand einen halben Schritt hinter ihr, und sie spürte seine Nähe, eine beruhigende und wohltuende Nähe.
Er erschien Kathrin wie ein Fels in der Brandung. Sie hatte ihn operieren sehen, mehr als einmal, und stets wusste er ganz genau, was er tat. Seine Assistenten und die Operationsschwestern wären für ihn durchs Feuer gegangen.
»Es handelt sich um meine Mutter«, stieß sie nach einer Unendlichkeit des Schweigens hervor.
Dietmar Eich krauste die Stirn. Dr. Lamberts Mutter! Er erinnerte sich gut an den Fall.
»Würden Sie ... meine Mutter noch einmal untersuchen?«
Kathrins Stimme klang dünn und verzagt, und sie schaute ihn so an, wie schon viele Menschen den Oberarzt angeschaut hatten.
Dietmar Eich ließ sich Zeit mit einer Antwort, holte erst einmal tief Luft.
»Es gibt keine Besserung, Fräulein Lambert«, erinnerte er Kathrin dann.
Das war ein Todesurteil. Kathrin zuckte zusammen, wandte den Kopf und schaute wieder hinaus.
»Es tut mir furchtbar leid, dass ich Ihnen keinen Trost geben kann, Fräulein Lambert, aber Sie wissen selbst, wie es aussieht. Ich kann Sie nicht belügen.«
Gib mir eine größere Spritze, Kathrin ..., klang die brüchige Stimme der Mutter in ihr nach. Und plötzlich sank Kathrins Kopf vornüber, Weinen schüttelte ihren Körper, stoßweise, hilflos.
Dietmar legte unwillkürlich beide Arme um sie und zog sie an sich.
»Aber Kollegin ...«
Wer war er, der Oberarzt? Ihr Vorgesetzter? Ein Mensch!
Und deshalb presste Kathrin ihren Kopf an seine Brust und weinte, weil sie wusste, dass er sie verstand, dass er nicht über sie lächelte, dass er imstande war, ihre Gefühle nachzuempfinden.
Anfangs stand Dietmar steif wie ein Stock. Eine junge Frau lag an seiner Brust, ihre Arme umklammerten ihn fest, und sie weinte. Er sah auf sie hinab, auf ihr Haar, auf ihr Ohr, das so blass und durchscheinend war, auf ihren Hals, auf dem die Aorta sich bläulich abzeichnete. Als Arzt registrierte er unbewusst, dass ihr Puls sich beschleunigt hatte.
Und dann war nur noch Mitleid in ihm. Sie war nicht mehr die Kollegin, die tüchtige Ärztin, sie war nur noch ein junges verzweifeltes Mädchen, das Trost und Rat brauchte, einen Menschen, dem sie alles sagen konnte, was sie bedrückte.
Dietmar zog sein Taschentuch und tupfte vorsichtig die Tränen von ihren Wangen, und Kathrin spürte unbewusst die Erleichterung, die es für jeden Menschen bedeutet, sich einmal nicht mehr zusammennehmen zu müssen.
»Ich danke Ihnen.« Endlich verebbte ihr Schluchzen. Kathrin löste sich von ihm und errötete, als ihr zu Bewusstsein kam, was geschehen war. »Ich glaube manchmal, es nicht mehr ertragen zu können.« Sie starrte an Dietmar vorbei, es war so, als spräche sie gar nicht zu ihm, sondern zu sich selbst. »Sie hat für mich geschuftet, und ich habe mir geschworen, dass ich es wiedergutmachen will. Sowie ich genügend Geld verdiene, habe ich mir vorgenommen, soll Mutter es gut haben. Um vier Uhr ging sie morgens aus dem Hause, und nie hat sie geklagt. Ich sollte studieren und Ärztin werden, ich sollte eine schönere Zukunft haben als sie. Und dann kam das. Weshalb musste es ausgerechnet sie treffen, sagen Sie es mir! Kein Mensch hat mehr für einen anderen getan als Mutter für mich, alle mochten sie gern, immer war sie hilfsbereit, und gerade sie.«
Sie begann, zu zittern, und Dietmar trat auf sie zu und zog sie erneut an sich.
»Nicht mehr daran denken, Kathrin«, flüsterte er, und die junge Frau wunderte sich gar nicht über die Selbstverständlichkeit, mit der er ihren Vornamen aussprach.
Sie schüttelte heftig den Kopf.
»Wie könnte ich es vergessen?«, stieß sie gequält hervor. »Aber ... kann ich sie so leiden lassen ... so ohne jede Hoffnung?«
»Manchmal sind uns die Hände gebunden. Das ist das Schwere an unserem Beruf, dass wir helfen wollen und manchmal nicht helfen können.«
»Aber sie ist meine Mutter ...«, stammelte Kathrin und schaute mit Augen, in denen Tränen schwammen, zu ihm hoch. »Sie ist doch meine Mutter ...«
Sie ist völlig verzweifelt, sie braucht irgendeinen Trost, ich muss ihr helfen, dachte Dietmar, und deshalb zwang er sich zu einem zuversichtlichen Lächeln.
»Ich werde Ihre Frau Mutter noch einmal untersuchen, Kathrin«, sagte er dann.
»Soll das heißen ...«
»Vielleicht habe ich mich ja damals geirrt. Professor Mander hat eine aufsehenerregende Rückenmarkoperation durchgeführt. Sie haben vielleicht davon gelesen ...«
Wenn irgendjemand Mutter helfen kann, dann nur er, dachte Kathrin.