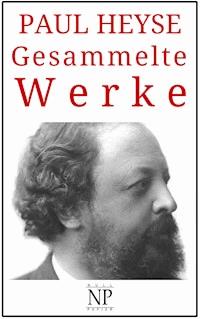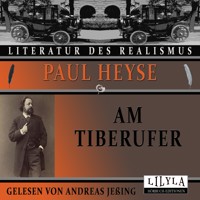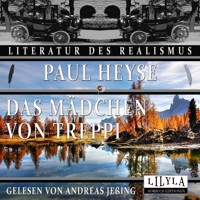1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
In 'Lorenz und Lore' von Paul Heyse tauchen wir in die Welt der jungen Liebenden Lorenz und Lore ein, die von unterschiedlichen sozialen Schichten stammen. Heyse präsentiert eine Geschichte voller Leidenschaft, Intrigen und Klassenkonflikte. Der Autor kombiniert geschickt Romantik und Realismus, und sein detailliertes Porträt von Liebenden, die gegen gesellschaftliche Normen ankämpfen, macht dieses Werk zu einem Meisterwerk des 19. Jahrhunderts. Heyse's Schreibstil zeichnet sich durch eine präzise Sprache und eine feine Charakterzeichnung aus, die den Leser unmittelbar in die Handlung eintauchen lässt. 'Lorenz und Lore' ist ein wichtiger Beitrag zur deutschsprachigen Literatur des Realismus und regt zum Nachdenken über soziale Konventionen und persönliche Freiheit an. Paul Heyse, ein renommierter deutscher Schriftsteller und Literaturwissenschaftler, hat dieses Buch geschrieben, um die Themen sozialer Ungleichheit und persönlicher Unabhängigkeit zu erkunden. Als Literaturnobelpreisträger verfügt Heyse über ein tiefes Verständnis für die menschliche Psyche und präsentiert in 'Lorenz und Lore' eine fesselnde Studie über Liebe und gesellschaftliche Zwänge. Leser, die einen Einblick in die komplexe Welt der Beziehungen zwischen den Geschlechtern und den Klassen suchen, werden von diesem Roman fasziniert sein. Heyse's Werk ist eine zeitlose Erzählung, die auch heute noch relevante Fragen zur Liebe, Freiheit und sozialen Gerechtigkeit aufwirft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Lorenz und Lore
Inhaltsverzeichnis
Lorenz und Lore
Im Jahre 1854, am 25. Juli, Nachts um elf Uhr – so genau kennen wir den Zeitpunkt, in dem diese eben so wahre als einfache Geschichte begann – hielt die Postkutsche vor dem ansehnlichsten Gasthofe einer kleinen mitteldeutschen Stadt, ohne daß wie sonst der Postillon in’s Horn stieß und Kellner und Hausknecht heraussprangen, die Reisenden in Empfang zu nehmen. Es war nämlich in jenem bösen Cholera-Jahr die Stadt, die bisher immer verschont geblieben, so schwer von der Seuche heimgesucht worden, daß selbst die Handlungsreisenden, die zahlreich in der „Post“ einzukehren pflegten, schon seit Wochen ihre besten Kundschaften versäumten, um nur dem Essig und Chlorgeruch zu entgehen, der Tag und Nacht alle Häuser und Straßen erfüllte. Mehrere Tage schon hatte die Post keinen Passagier mehr gebracht, dagegen täglich in vielen Beiwägen Einwohner der Stadt hinausgeschafft, die in höher gelegenen Oertern des nahen Gebirges Zuflucht suchten, darunter viele schwarzgekleidete Gestalten mit verweinten Augen, bei deren Anblick dem Postillon das Blasen seiner muntern Stückchen verging.
In jener Nacht des 25. Juli führte vollends Einer die Peitsche, der überhaupt sich nicht auf solche Künste verstand, ein junger Mann in schwarzem Rock und grauem Filzhut, der als der einzige Reisende auf der vorletzten Station die Stelle des Schwagers eingenommen hatte, da dieser ebenfalls plötzlich erkrankte, und, bei der großen Scheu, die verpestete Stadt zu betreten, kein andrer Ersatzmann sich finden wollte. Es traf sich, daß der junge Mann als ein Landeskind dem dortigen Posthalter bekannt war, so daß dieser ihm, da er darauf bestand noch heute an Ort und Stelle zu kommen, auf die kurze Strecke unbedenklich den alten Thurn- und Taxis’schen Rumpelkasten anvertraute. Manchen, der ihm auf der dämmerigen Landstraße begegnete, wie er in rascherem Trabe, als üblich war, dahinrollte, mochte ein Schauer überlaufen, wenn er statt des Schwagers in der lustigen Jacke mit den gelben Lederhosen die schwarze Gestalt vom Bock herunter kutschiren sah, als habe nun der Tod leibhaftig das Fuhrwesen übernommen, da die bisherige Beförderung ihm zu langsam gewesen.
Auch der junge Mann konnte sich eines unheimlichen Gefühls nicht erwehren, als es immer finsterer und stiller wurde und endlich nichts mehr zu sehen war, als dicht vor ihm die dampfenden Pferderücken und links und rechts die Steine der Chaussee, über die aus den trüben Wagenlaternen ein ungewisser Schimmer glitt. Er war froh, als die Gäule, die blindlings ihres Weges fortgetrabt waren, endlich vor dem Posthause hielten, übergab dem verschlafenen Hausknecht, den er mühsam herausklopfen mußte, den Wagen sammt dem Briefbeutel, sagte, er werde morgen wieder vorsprechen, um dem Postmeister die nöthigen Aufklärungen zu geben, und schlug dann, sein Reisesäckchen in der Hand, eilig den wohlbekannten Weg ein, der zu seiner Eltern Hause führte.
Nun muß man wissen, daß sein Vater ein ehrsamer Glockengießermeister war, schon in den Siebzigen, der sich seit einigen Jahren zur Ruhe gesetzt, die Werkstatt verkauft und ein behagliches Stillleben begonnen hatte, nur unterbrochen durch Besuche seiner beiden Kinder, der älteren Tochter, die eine Tagereise entfernt an einen Pfarrer verheirathet war, und dieses Sohnes, der seit einem halben Jahr eine Lehrerstelle am Gymnasium der Provinzialhauptstadt bekleidete. Die Mutter, eine Lehrerstochter, hatte ihren Kindern eine sorgfältige Erziehung über die Ansprüche des Handwerkerstandes hinaus gegeben und im Laufe der Zeit auch ihrem Manne, in dem von Hause aus eine reiche künstlerische Ader steckte, seine groben Ecken abgeschliffen, so daß nichts anmuthiger war, als das bejahrte Paar zu beobachten, wie es in seiner späten Mußezeit des Miteinanderlebens erst recht froh wurde. Der Alte, der noch rüstig war, noch immer den schönen Kopf mit den grauen Locken aufrecht auf den breiten Schultern trug, hatte den ganzen Tag in seiner hellen geräumigem Wohnstube etwas zu basteln oder zu bosseln, schnitzte oder formte Modelle zu allerlei kunstreichem Hausgeräth und horchte dazwischen auf das, was ihm seine kleine saubere Frau mit ihrer noch immer wohlklingenden Stimme vorlas. Kam dann die Tochter mit ihrem Manne oder auch nur mit den Kindern auf ein paar Tage zum Besuch und der Sohn, der in Würzburg und Erlangen studirt hatte, konnte ebenfalls eine Ferienzeit benutzen, wieder einmal die Füße unter seiner Eltern Tisch zu strecken, so gab es in dem ganzen Städtchen keine glücklichere und stattlichere Familie, und die Schwester, die den Humor des Vaters geerbt hatte, war froh, einmal wieder ihre pastorale Würde ablegen und das übermüthige lachlustige Kind des Hauses sein zu dürfen, das auch den ernsteren Bruder bald wieder in den alten ungebundenen Ton hineinscherzte.
Diese sonnigen Tage waren plötzlich verdunkelt worden, als die schreckliche Krankheit über das Städtchen hereinbrach. Gleich zu Anfang hatte die Pfarrerin ihre Eltern auf’s Dringendste gebeten, sich in ihre höher gelegene Gegend zu flüchten, wo das Gespenst sich noch nicht hatte blicken lassen. Der Alte, der auch sonst schwer zu lenken war, hatte sich fest geweigert, seine Mitbürger und Nachbarn in der allgemeinen Noth zu verlassen, vielmehr, wo er konnte, Hilfe geleistet und sich selbst und seine Frau durch ein mäßiges und vorsichtiges Leben lange Zeit jeder Anfechtung erwehrt. Seit sechs Tagen aber waren die Briefe der Mutter ausgeblieben, und in der Unruhe, was das zu bedeuten habe, hatte der Sohn sich plötzlich entschlossen, selbst hinzureisen und seinen Eltern, wenn es zum Schlimmsten kommen sollte, nach Kräften beizustehen. Der Hausknecht in der Post, den er sogleich befragte, war erst seit wenigen Tagen in der Stadt und kannte nicht einmal den Namen des alten Meisters; und während der Jüngling durch die finsteren Gassen hinschritt, begegnete ihm keine Menschenseele, die ihm im Vorbeigehn hätte Auskunft geben können, wie es im Hause stehe. Immer hastiger wurde sein Schritt, der Schweiß trat ihm in großen Tropfen vor die Stirn; dann und wann hörte er aus einem offenen Fenster das Stöhnen eines Kranken oder das Weinen eines armen Weibes, das neben ihrem hingerafften Manne oder Kinde die Leichenwache hielt, und in all’ den Jammer sahen die Sterne der Sommernacht so funkelnd herein, daß der Gegensatz himmlischer Ruhe und irdischer Noth dem einsamen Wanderer nur noch schwerer das Herz beklemmte.
Nun stand er vor dem alten hochgiebeligen Hause, drin seine Eltern wohnten, und that einen tiefen Athemzug, als er sah, daß alle Fenster geschlossen waren. Licht brannte hinter keinem, also wurde auch keine Krankenwache gehalten. Jetzt fiel ihm erst ein, daß die alten Leute erschrecken würden, wenn er so spät in der Nacht unangemeldet – einen Brief vorauszuschicken war nicht Zeit gewesen – ihnen in’s Haus fiele. Aber wieder fortgehen, in einem Gasthofsbette schlafen und sich bis morgen gedulden, brachte er nicht über’s Herz. Also zog er sacht an der Hausglocke, die unter einem zierlich aus Sandstein gemeißelten Dächlein zugleich als Handwerkszeichen neben der Thür angebracht war. Sie klang ganz so tief und rein, wie in den besten Tagen, aber sie schien die Kraft verloren zu haben, einen gastfreundlichen Wiederhall drinnen im Hause zu erwecken. Auch auf das zweite Läuten blieb Alles still – „todtenstill?“ dachte der späte Gast, und die Hand am Glockenzug bebte ihm. Zum dritten Mal, jetzt mit solcher Gewalt, daß die ganze Straße weithin davon erschallte, ließ er die eherne Zunge die angstvolle Frage thun, ob denn kein Lebendiger mehr hinter diesen dunklen Fenstern athme. Der schrille Klang hatte noch nicht ausgeschwungen, da hörte er oben im zweiten Stock, nicht seines Elternhauses, sondern ihm gerade gegenüber, ein Fenster klappen und eine Stimme rufen: „Wer läutet da noch so spät? Wenn es der Todtengräber ist, da drüben ist Nichts zu holen. Er soll morgen wiederkommen und an dieses Haus klopfen. Habt Ihr wohl verstanden, Meister Schwarz?“
„Bist Du’s, Lorchen?“ rief der junge Mann. „Nun, Gott sei Dank, daß Du noch wach bist und mir sagen kannst –“
„Herrgott!“ unterbrach ihn die Stimme, „Sie sind es, Lorenz? Und was wollen Sie hier? Und warum kommen Sie nun gerade dazu, wenn wir Alle sterben müssen?“
„Komm herunter, Lorchen,“ bat er, „und öffne mir das Haus und sage mir –“