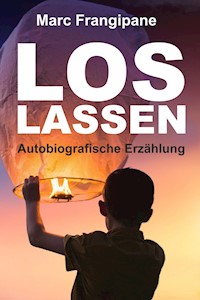
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Laut einer Befragung unter Psychologinnen und Psychologen erleben viele Menschen den Tod ihrer Eltern als belastender als etwa die eigene Scheidung oder den Verlust des Arbeitsplatzes. Wie geht man als Angehöriger mit so einer Situation um? Soll man über das Sterben, den Tod, die Beerdigung sprechen? Wie leistet man Beistand und Trost? Was kann man überhaupt machen? Ist man mehr als eine Fallakte im Getriebe des Gesundheitsapparates? Welche Herausforderungen gilt es innerhalb der Familie zu bewältigen? Der Autor setzt sich mit der Leukämieerkrankung seiner Mutter auseinander, die zu ihrem Tod führte. Er berichtet über Diagnose, Therapien, Verzweiflung, Wut und Hoffnung. Darüber, wie man die verbleibende Zeit sinnvoll nutzen kann, um dem Patienten einen würdigen Abschied zu ermöglichen und Versäumtes nachzuholen. Er versucht auch, sich auf das Leben nach dem Tod der geliebten Mutter vorzubereiten, nichts zu tun oder zu unterlassen, was er später bereuen könnte. Dieses Buch ist weit weniger bedrückend, als es sein könnte. Es soll Mut machen, ein wenig Orientierung bieten und nicht zuletzt auch sehr persönliche Einblicke gewähren, in der Hoffnung, dass es anderen helfen kann, mit einer ähnlichen Situation möglichst gut zurechtzukommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marc Frangipane
Loslassen
Autobiografische Erzählung
Marc Frangipane
Copyright: © 2021 Marc Frangipane
Lektorat: Erik Kinting / www.buchlektorat.net
Covergestaltung: Erik Kinting
Published by epubli
www.epubli.de
Ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, die über den Rahmen des Zitatrechtes bei korrekter vollständiger Quellenangabe hinausgeht, ist honorarpflichtig und bedarf der schriftlichen Genehmigung des Autors.
Nicht mehr besetzt
05362 655 – Ich wählte die Telefonnummer, obwohl ich wusste, dass niemand am anderen Ende ans Telefon gehen würde.
»Dieser Anschluss ist zur Zeit nicht besetzt. Versuchen Sie es später noch einmal.«
Ich legte auf und dachte darüber nach, wie oft ich diese Nummer in meinem Leben wohl gewählt hatte: in den letzten Monaten, in den letzten Jahren. Diese Telefonnummer war eine der wenigen, die ich sogar im Halbschlaf hätte auswendig aufsagen können. Vermutlich war es die erste, die ich kannte, die ich schon während Klassenfahrten auf langen Fluren in Landschulheimen gewählt hatte oder in Telefonzellen, nachdem ich von zu Hause ausgezogen war und noch keinen eigenen Telefonanschluss hatte. Immer wenn ich nach dem Wochenende wieder in meiner kleinen Wohnung war, wählte ich diese Nummer: »Bin wieder gut angekommen.« Häufig waren es nur wenige kurze Sätze, aber der Anruf war ein Ritual.
Während sich meine Telefonnummer anfangs alle zwei bis drei Jahre änderte, weil ich umzog, blieb die Nummer meiner Mutter stets dieselbe. – Doch nun gab es sie nicht mehr. Der Anschluss wurde gekündigt.
Nur wenige Wochen vorher hockte ich in einer schmalen Abseite auf dem Dachboden meines Elternhauses. Mit meiner Handy-Taschenlampe leuchtete ich in die Kartons, die dort herumstanden und in die bestimmt seit 30 Jahren niemand mehr gesehen hatte. Es waren alte Schulzeugnisse, ein Mutterpass (ich wusste bis dahin gar nicht, dass es so etwas gab), alte Schulaufsätze und Tapetenrollen, die hier offensichtlich als Ersatz gelagert wurden, für den Fall, dass mal irgendein Stück Tapete ausgewechselt werden musste; allerdings gab es viele dieser Tapeten gar nicht mehr, sie wurden längst übertapeziert. Sie hat wirklich nichts umkommen lassen, dachte ich und musste dabei lächeln. In einem Karton fand ich meine Kinderzimmertapete: Bäume, in denen bunte Vögel sitzen, alles gezeichnet. Irgendwann wurde auch diese Tapete mit einer neutraleren überklebt, weil mir das Muster ab einem bestimmten Alter peinlich war. Nun sah ich diese Tapete nach Jahrzehnten zum ersten Mal wieder und nahm ein Stück davon mit. Es hängt jetzt gerahmt in meiner Wohnung, die einzige Erinnerung an mein Kinderzimmer.
Vermutlich würde dieses Stück Tapete nicht bei mir in der Wohnung hängen, wenn vieles anders gekommen wäre; wenn knapp drei Jahre zuvor meine Mutter nicht diesen Husten bekommen hätte, der einfach nicht weggehen wollte …
Das Schicksal
Viele Schicksalsschläge brechen von einer Sekunde auf die andere über uns herein, ohne Vorahnung oder Vorwarnung. Auf einmal ist nichts mehr so, wie es vorher war. Und es gibt Schicksalsschläge, die man anfangs gar nicht erkennt, weil sie sich geschickt tarnen.
Die Verleihung der Sportabzeichen ist in dem kleinen Ort, aus dem ich komme, immer ein großes Event, so auch in jenem Jahr. Mitte Februar wurden die Sportabzeichen mit einer Urkunde übergeben, dann wurden Gyros, Souflaki und Bifteki gereicht und der Ouzo eingeschenkt. – Ein geselliger Abend im Sportverein. Es wurde gelacht, erzählt und es wurden Fotos gemacht. Auf einem ist auch meine Mutter drauf. Sie hat als Übungsleiterin die Wettkämpfe abgenommen. Sie lacht fröhlich in die Kamera. Ich sehe dieses Foto erst einige Jahre später und schaue es mir sehr lange an, denn vielleicht ist dieser Moment, in dem das Foto gemacht wurde, einer der letzten unbeschwerten Momente im Leben meiner Mutter. Heute weiß ich: Das Schicksal – oder wie man es auch immer nennen will – muss vermutlich bereits an diesem Abend zugeschlagen haben; noch so leise, dass es niemand bemerkte.
Wenige Wochen später, Ende März, erwähnte meine Mutter in einem unserer regelmäßigen Telefonate eher beiläufig, dass sie seit Tagen einen starken Husten habe. Obwohl ihr Hausarzt bereits ein Antibiotikum verschrieb, ging er nicht weg.
»Ist bestimmt eine schwere Erkältung, warte noch mal einige Tage ab«, riet ich ihr.
Natürlich hatte ich gerade andere Sachen im Kopf als mich damit groß auseinanderzusetzen. Es war März und noch mehr Winter als Frühling, da war ein starker Husten nun mal alles andere als ungewöhnlich.
Doch der Husten ging nicht weg. Ich war erleichtert, als ich hörte, dass beim Röntgen ihrer Lunge nichts Auffälliges gefunden wurde. Selbst als ihr Hausarzt Blut abnahm, um es untersuchen zu lassen, machte ich mir keine großen Gedanken.
Doch das Ergebnis ließ mich zum ersten Mal aufhorchen: Irgendwas stimmte mit den Blutwerten nicht. Schlechte Blutwerte gab ich als Suchbegriff bei Google ein und die meisten Treffer ließen mich zusammenzucken. Ich glaubte aber erst mal, dass die Ursache ganz harmlos sei und man einer Ferndiagnose von Dr. Google nicht trauen dürfe. Ohnehin hatte ich wenig Zeit, mir irgendwelche Gedanken über den Gesundheitszustand meiner Mutter zu machen, denn sie hatte sich am Wochenende zum Besuch angekündigt. Das setzte bei mir und meinem Freund Jan ein mittlerweile eingeübtes Handlungsmuster in Gang, das wir im Laufe der Jahre perfektioniert hatten: Einkaufen, Wohnung aufräumen und putzen. Das machten wir natürlich auch sonst regelmäßig, aber wenn sich Besuch ankündigte natürlich umso gründlicher. – Und wenn meine Mutter kam, am gründlichsten. Sie hatte ein besonderes Auge dafür und neigte dazu, vermeintliche Defizite in unserem Haushalt offen anzusprechen: »Das Waschbecken hat aber auch lange keinen Putzlappen mehr gesehen. Soll ich euch mal einen kaufen?« Mit ihrer direkten Kommunikation und ihrer burschikosen Art konnte nicht jeder umgehen, Diplomatie war ganz sicher nicht ihre größte Stärke. Ich hatte das erst in den letzten Jahren immer mehr schätzen gelernt, nämlich als direktes und ehrliches Feedback, ohne die rosarote Mutterbrille. Vor einigen Jahren hatten wir uns einen neuen Wohnzimmertisch angeschafft. Als ich ihn ihr stolz präsentierte, musterte sie ihn kurz und sagte »Gefällt mir überhaupt nicht.« Viele andere Mütter hätten dies bestimmt anders formuliert; mich überkam eine seltsame Mischung aus Enttäuschung und Wut. Allerdings wusste ich so auch immer, woran ich war. Und wenn ich ehrlich bin, ist mir ein ungefiltertes Feedback lieber als ein diplomatisch verpacktes. So wurde meine Mutter in den letzten Jahren zu einem wichtigen Korrektiv für mich. Aber als Jugendlicher war mir diese Direktheit häufig etwas unangenehm.
Schatten über der Elphi
Ich hatte mir für dieses Wochenende ein schönes Programm in Hamburg überlegt. Wir besichtigten die (damals noch sehr neue) Elbphilharmonie und gingen abends zu unserem Lieblingsgriechen. Es war Ende Mai, das Wetter herrlich und unsere Stimmung meistens auch. – Doch etwas war anders als sonst. Mir fiel relativ schnell auf, wie schwach meine Mutter war, eine sehr sportliche 67-jährige Frau. Auf dem Weg zur Elphi musste sie sich mehrmals auf eine Bank setzen. Beim Essen im Restaurant hatte sie keinen großen Hunger, stocherte lustlos auf dem Teller herum und wollte früh wieder zurück in unsere Wohnung.
Am nächsten Morgen fuhr sie wieder nach Wolfsburg. Meine Mutter winkte mir noch lange aus dem halb offenen Autofenster zu. Das hatte sie noch sie so intensiv getan, sie bevorzugte sonst immer die nüchternen Abschiede: »Tschüss – bis zum nächsten Mal.« Mit einem komischen Gefühl ging ich zurück in die Wohnung.
Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen konnte: Am frühen Morgen hatte ihr Hausarzt bereits eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen: »Bitte rufen Sie mich sofort zurück.«
Die zweite Blutuntersuchung ließ keinen anderen Schluss zu: Meine Mutter war an akuter myeloischer Leukämie erkrankt. Ich erfuhr den Befund erst am Abend, als ich sie anrief, um mich zu vergewissern, ob sie gut zu Hause angekommen war: »Bei mir ist übrigens nicht alles in Ordnung«, sagte sie ungeschönt wie immer. »Ich habe Leukämie.«
Ich nahm mein Handy aus der Tasche und musste nur Leu eintippen, um mehr zu erfahren: Die Leukämie, umgangssprachlich auch als Blutkrebs bezeichnet, ist eine bösartige Erkrankung des blutbildenden Systems. Leukämien zeichnen sich durch die vermehrte Bildung von weißen Blutkörperchen und vor allem ihrer funktionsuntüchtigen Vorstufen aus. Diese Leukämiezellen breiten sich im Knochenmark aus und verdrängen dort die übliche Blutbildung. Je nach Verlauf unterscheidet man akute und chronische Leukämien. Akute Leukämien sind lebensbedrohliche Krankheiten, die unbehandelt innerhalb weniger Wochen zum Tode führen.
Ich musste raus aus der Wohnung. Ich ging an einem Kanal in der Nähe spazieren und setzte mich auf einen Holzsteg, der direkt am Wasser liegt. Von dort hat man eine schöne Aussicht auf den Kuhmühlenteich, ein kleines Gewässer in der Nähe der Hamburger Außenalster; Naturidylle inmitten einer Großstadt.
Immer wieder ging ich in den folgenden Wochen und Monaten diesen Weg, immer dieselbe Strecke, auch wenn sich vieles um mich veränderte. – Nicht nur die Natur, durch den Wechsel der Jahreszeiten, sondern auch meine Stimmungslage. Damals konnte ich nicht mal ansatzweise ahnen, welche großen Schwankungen ich erleben sollte. Doch diese Strecke war eine feste Konstante in meinem Alltag. Ich begegnete auf dieser Runde nur wenige Menschen, was mir sehr entgegenkam, denn so konnte ich auch mal laut nachdenken, ohne schief angeschaut zu werden.
Dieser Spaziergang wurde zu einem festen Ritual: Ich dachte stets darüber nach, wie es mir das letzte Mal auf diesem Weg gegangen war und wie ich mich jetzt fühlte. Diese Reflexion gab mir Kraft.
Hoffnung ist stärker als Verzweiflung
Menschliche Beziehungen sind komplex, vor allem Beziehungen zwischen Kindern und Eltern. Mich macht es immer traurig, wenn ich höre, dass jemand in meinem Bekannten- oder Freundeskreis, aus welchem Grund auch immer, keinen Kontakt zu seinen Eltern hat. Mein Bruder und ich hatten zu unserer Mutter ein intensiveres Verhältnis als zu unserem Vater. Sie machte mit uns die Hausaufgaben, wenn wir nicht mehr weiterkamen, ging mit uns ins Schwimmbad und organisierte unsere Kindergeburtstage. All das trug ganz sicher auch zu der starken Bindung bei.
Bereits am nächsten Morgen wurde meine Mutter im städtischen Krankenhaus aufgenommen. Die Behandlung gegen die Leukämie musste sofort beginnen. Ich schickte ihr eine WhatsApp-Nachricht: Du hast schon so viele Kämpfe gewonnen. Ich dachte an die Scheidung von meinem Vater, an Probleme mit einigen Schülerinnen und Schülern in ihrem Beruf als Lehrerin und an viele andere Situationen, in denen sie sich nicht unterkriegen ließ. Sie lernte in den 70er-Jahren meinen Vater, einen italienischen Gastarbeiter, kennen und heiratete ihn. Eine binationale Ehe war damals alles andere als gewöhnlich – auch für ihre Familie, zumal ihr Bruder es gleich nachmachte: Er heiratete eine Italienerin, die aus demselben Ort kam wie mein Vater.
Ihre Antwort auf meine Nachricht kam nur wenige Minuten später: Danke, wird schon werden. – Sie war bereit zu kämpfen.
Diese Reaktion passte zu ihr, diese Entschlossenheit. Die hatte ich schon früh an ihr kennengelernt. Ich war vielleicht sieben, acht Jahre alt; mein Bruder und ich spielten in dem kleinen Dorf bei Wolfsburg mit den Nachbarkindern – Verstecken, Fangen … was man eben in den 80er-Jahren draußen in diesem Alter so gemacht hat. Stets beobachtet von einer alten Frau, die von morgens bis abends am Küchenfenster saß. Aus irgendeinem Grund gerieten wir Kinder untereinander in Streit. Da ging auf einmal das Küchenfenster auf und die alte Frau schrie: »Ihr Itaker, haut ab! Geht zu euch und lasst die anderen in Ruhe hier spielen, ihr Spaghettifresser.« Ich war wie erstarrt und überlegte noch kurz, ob für diese Bezeichnungen noch jemand anderes infrage käme, aber es gab keinen Zweifel – sie meinte uns. Es war das erste und bislang einzige Mal, dass ich in so offener Weise ausländerfeindliche Ressentiments gespürt hatte. Ich nahm meinen Bruder an die Hand und rannte schnell nach Hause. Dort erzählte ich meiner Mutter, was passiert war. Sie war offensichtlich genau so schockiert wie ich. Nun hätten sicherlich viele Mütter gesagt: Das hat die Frau bestimmt nicht so gemeint. Oder: Sicherlich hast du dich verhört! Oder noch schlimmer: Ihr habt bestimmt den Streit angezettelt und das kommt davon. Meine Mutter zog aber ihre Jacke an und sagte: »Ich kläre das!« Das fand ich schon damals sehr mutig von ihr. Nach einer halben Stunde war sie wieder da und schickte uns zu der alten Frau: »Sie will sich bei euch entschuldigen.« Sehr unwillig machte ich mich mit meinem Bruder auf dem Weg, klingelte bei der alten Dame und sie bat uns sehr aufrichtig um Entschuldigung und drückte uns dabei noch einen Geldschein und Schokolade in die Hand. Gelernt habe ich an diesem Nachmittag eins: Konflikte muss man offen und ehrlich klären – eine Lektion, die meine Mutter aber meist besser beherrschte als ich.
Mondscheinwellen und eine Platzwunde
Am Wochenende packte ich meine Sachen und fuhr rund 220 Kilometer nach Wolfsburg, zu ihr in die Klinik.
Solang ich mich erinnern kann, habe ich eine chronische Abneigung gegen Krankenhäuser, obwohl ich mehr als zwölf Jahre direkt neben einer großen Klinik in Hamburg gewohnt habe. Wenn ich dort vorbeigegangen bin und mir Patientinnen und Patienten mit ihren rollenden Infusionsständern entgegenkamen, habe ich oft unauffällig die Straßenseite gewechselt, bin der Konfrontation mit schweren Krankheiten lieber ausgewichen.
Ich erinnere mich, wie ich als Kind einmal meinen Onkel in einem Krankenhaus besucht habe. Seine Achillessehne war gerissen; nichts Schlimmes. Die langen Gänge, die sich plötzlich selbst öffnenden Türen, dieser spezielle Geruch … das fand ich damals schon irgendwie unheimlich. Als ich in einem Treppenhaus nach unten schaute, sah ich im Keller einen Zinksarg stehen. Das gab mir den Rest. Ich rannte zu meiner Mutter und umfasste ihre Hand – und ließ sie erst mal für lange Zeit nicht los. Krankenhäuser waren spätestens seit diesem Moment für mich gruselige Orte. Einige Jahre später war ich auf einem Kindergeburtstag eingeladen. Irgendwann in den 80ern war es total angesagt, dass nicht mehr zu Hause gefeiert wurde. Ausflüge in einen Freizeitpark, ins Kino, zu einer Kegelbahn oder sogar zu einem amerikanischen Fast-Food-Restaurant waren der letzte Schrei, Spiele wie Blinde Kuh oderSchokokuss-Wettessen langweilig geworden. Mein Highlight war das Badeland – ein großes Freizeitbad mit einem Wellenbecken. Jeden Abend gab es dort die Mondscheinwellen – das war für mich und meine Freunde das Größte: Während des Wellengangs wurden die Lichter gedimmt und der Bademeister machte einen roten Scheinwerfer an, der – mit sehr viel Vorstellungskraft – eine untergehende Sonne darstellen sollte. Ich staune heute, wie einfach wir damals zu begeistern waren. Ich tobte mit vielen anderen Kindern in dem halbdunklen Bad durch die Mondscheinwellen. Ausgerechnet ich stieß dabei frontal mit einem anderen Kind zusammen. Mein Gegenüber hatte nicht mal eine Beule, ich aber blutete heftig an der Stirn, was vermutlich im roten Scheinwerferlicht schlimmer aussah, als es wirklich war. Der Bademeister kam, sah sich meine Wunde an und stellte fest: »Das muss genäht werden, im Krankenhaus.« – »Nein, ich will nicht ins Krankenhaus!«, schrie ich – ohne Erfolg. Der Kindergeburtstag fand ein plötzliches Ende, die Eltern des Geburtstagskindes brachten mich nach Hause und mein Vater musste mich in die Klinik fahren. Er war wenig stressresistent und schimpfte im Auto ständig mit mir, warum ich nicht besser aufgepasst hatte. Dabei fand ich die Vorstellung, dass ein Arzt mit Nadel und Faden in meine Stirn sticht, schon schlimm genug. Meine Mutter – was für ein Zufall – war zu dieser Zeit selbst in der Klinik, weil sie eine Mandel-OP hatte. In solchen Situationen vermisste ich sie umso mehr, weil ich wusste, dass sie einen kühlen Kopf bewahrt und mich getröstet hätte. In der Nähe der Notaufnahme mussten mein Vater und ich warten, auf einem langen Flur, der – daran erinnere ich mich noch genau – in einem hässlichen braunen Farbton geklinkert war. Auf einmal sah ich meine Mutter im Bademantel um die Ecke kommen. Irgendwie hatte sie von meinem Missgeschick erfahren. Ich rannte auf sie zu – direkt in ihre Arme – und fühlte mich wieder sicher. »Das Nähen tut nicht weh, mach dir keine Gedanken«, sagte sie und strich über meinen Kopf.
Mehr als 30 Jahre später betrat ich nun wieder dieses Krankenhaus, kam an der Notaufnahme vorbei und sah diesen Flur. – Und erinnerte mich an den Kindergeburtstag, die Mondscheinwellen und die Platzwunde. Ich finde es erstaunlich, dass einige Orte Jahrzehnte später bestimmte Erinnerungen zurück in unser Bewusstsein holen – und sei es nur ein braun geklinkerter Flur in einem Krankenhaus. Kaum etwas hatte sich in all den Jahren geändert, aber mir wurde in diesem Moment bewusst, dass sich die Rollen jetzt vertauscht hatten: Ich würde nun für meine kranke Mutter da sein, sie brauchte jetzt meine Unterstützung.
Weiße Kittel und lange Flure
Mit schnellen Schritten ging ich über die Krankenhausflure – mein Bruder vorneweg, ich hinterher. Ich kam mir vor wie in einem Labyrinth. Schon bald hatte ich das Gefühl, dass ich alleine wohl nicht mehr so einfach zurück zum Ausgang finden würde, was dazu führte, dass ich mich an diesem Ort noch unwohler fühlte.
Nach vielen sich selbst öffnenden Doppeltüren, die dabei immer ein ganz bestimmtes Geräusch machten, erreichten wir die onkologische Station. Das Zimmer meiner Mutter war in einem Isoliertrakt dieser Station, der durch eine Schleuse von der übrigen Station getrennt war. Dort musste man sich die Hände desinfizieren und einen Mundschutz anlegen. Da das Immunsystem meiner Mutter durch die Leukämie angegriffen war, durfte sie keine Infektion bekommen.
Mit dem Mundschutz habe ich mich anfangs sehr schwergetan; das war ein unangenehmes Gefühl – besonders wenn man ihn mehrere Stunden tragen musste. Vor Corona waren die meisten von uns überhaupt nicht daran gewöhnt, so einen Mund-Nase-Schutz überhaupt zu tragen.
Wir klopften an der Tür. »Ja-haaa«, hörten wir. Mein Bruder öffnete und sie winkte uns herein. Sie wirkte noch schwächer als vor einigen Tagen in Hamburg, versuchte aber, sich das nicht anmerken zu lassen.
Meine Mutter hatte ein Einzelzimmer im Erdgeschoss, direkt neben dem Hubschrauberlandeplatz. Das sorgte an manchen Tagen für etwas Ablenkung. Da sich aber im Krankenhaus Wolfsburg die Zahl der Notfälle, die per Hubschrauber eingeliefert wurden, in Grenzen hielt, war der Ablenkungseffekt überschaubar.
Mein Bruder hatte an einer Zimmerwand ein großes Poster angebracht. Darauf hatte er ein Gebirge gezeichnet und diese Strecke in mehrere Etappen eingeteilt, die die verschiedenen Chemozyklen darstellen sollten. Am Ende der letzten Etappe hatte er eine Zielfahne gemalt, wie in der Formel 1. Außerdem hatte er Fotos von sich und seiner Familie auf das Poster geklebt. Meine Mutter war erst vor Kurzem Oma geworden. Sie freute sich seit Jahren auf das erste Enkelkind und ging in der Rolle voll auf. Das Poster war ein schöner bunter Blickfang in dem sonst sterilen Zimmer und die Aussage war klar: Die nächsten Wochen und Monate werden hart, aber es gibt ein Ziel.
Neben dem Bett meiner Mutter stand ein Infusionsständer. Die Infusionen liefen durch einen dünnen Schlauch über einen zentralen Venenkatheter, der im Krankenhaus nur ZVK genannt wurde, in ihren Körper unterhalb ihres Halses. Ich vermied es, mir diese Stelle genauer anzusehen, weil schon der Anblick Schmerzen in mir auslöste.
Die Flüssigkeit, die in dem Infusionsbehälter war, sah unscheinbar aus, beinahe wie Wasser und passte gar nicht zu der Wirkung, die sich die Ärzte und wir davon versprachen, nämlich eine tödliche Krankheit zu heilen. Wenn eine Flasche leer war, piepte es und ein neuer Behälter wurde eingesetzt – auch nachts. Das taten die Krankenschwestern und Pfleger stets mit Handschuhen, um zu vermeiden, dass sie direkt mit den Substanzen, die in dem Behälter waren, in Kontakt kamen. Das machte mir bewusst, wie gefährlich diese Flüssigkeit war.
Die Chemotherapie bestand aus insgesamt vier Zyklen, die jeweils rund sieben Tage dauerten. Der Oberarzt der onkologischen Station stellte meiner Mutter zur Wahl, ob sie eher eine mildere oder aggressivere Therapie haben wollte, dementsprechend wurde die Konzentration der chemischen Substanzen angepasst. Meine Mutter entschied sich für die aggressivere Variante. Damit stieg natürlich auch das Risiko für Nebenwirkungen.
Die in der Chemotherapie eingesetzten Medikamente, die in der Ärztesprache Zytostatika genannt werden, sollten die Leukämiezellen vernichten. Um die Behandlung zu kontrollieren, wurde meiner Mutter mehrfach am Tag Blut abgenommen. Ihre Arme waren irgendwann übersät von den Einstichstellen der Spritzen.





























