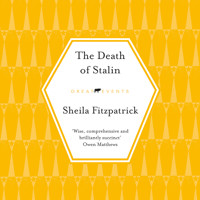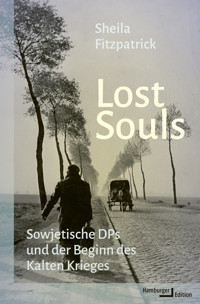
35,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hamburger Edition HIS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, lebten etwa eine Million Menschen, die aus der Sowjetunion kamen, hauptsächlich in den westlich besetzten Zonen Deutschlands und Österreichs. Diese Displaced Persons – Russen, sowjetische Bürgerinnen und Bürger aus der Vorkriegszeit und Menschen aus der Westukraine und den baltischen Staaten, die 1939 zwangsweise in die Sowjetunion eingegliedert wurden – weigerten sich, in ihre Heimat zurückzukehren. Nachdem die DPs 1947 von »Opfern des Krieges und des Nationalsozialismus« zu »Opfern des Kommunismus« erklärt wurden, waren die Vereinigten Staaten bereit, für deren Umsiedlung nach Amerika, Australien und in andere Länder außerhalb Europas aufzukommen. Die Sowjetunion protestierte gegen diesen »Diebstahl« ihrer Bürgerinnen und Bürger. Für die Vereinigten Staaten war es ein Propagandaerfolg in Zeiten des Kalten Krieges. Auf der Basis neuer Archivrecherchen und Interviews beschreibt Sheila Fitzpatrick nicht nur das Alltagsleben, sondern auch die konkurrierenden Manöver von Politik und Diplomatie. Flucht ist immer mit Leid verbunden. Und doch ist die Geschichte der sowjetischen DPs eine Erfolgsgeschichte. So ist dieses Buch ein wertvoller Beitrag zum Verständnis der europäischen Nachkriegsmigration und auch zu heutigen Diskussionen um den Umgang mit geflüchteten Menschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 686
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Sheila Fitzpatrick
LostSouls
Sowjetische DPsund der Beginn desKalten Krieges
Aus dem Englischen von Utku Mogultay
Hamburger Edition
Hamburger Edition HIS Verlagsges. mbH
Verlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung
Mittelweg 36
20148 Hamburg
www.hamburger-edition.de
© der E-Book-Ausgabe 2025 by Hamburger Edition
ISBN 978-3-86854-886-0
E-Book Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde
© der deutschen Ausgabe 2025 by Hamburger Edition
ISBN 978-3-86854-877-8
© der Originalausgabe 2024 by Princeton University Press
First published by Princeton University Press
Titel der Originalausgabe: »Lost Souls. Soviet Displaced Persons and
the Birth of the Cold War«
Umschlaggestaltung: Lisa Neuhalfen, Berlin
Umschlagabbildung: Ralph Morse / The LIFE Picture Collection / Shutterstock
Inhalt
Cover
Titelei
Impressum
Inhalt
Dieses Buch handelt von …
Einleitung
Teil I – Die Geschichte der Großmächte
1 Die UNRRA und ihr Mandat
Gründung der UNRRA
Erste Schritte
Die Frage der jüdischen DPs
Welche Personengruppen fielen unter das UNRRA-Mandat?
Die UNRRA unter La Guardia
Der Kalte Krieg und das Ende der UNRRA
2 Repatriierung in die Sowjetunion und Konflikte zwischen den Alliierten
Zwangsrepatriierung und Widerstand
Filtration
Anhaltende Konflikte um die Repatriierung
Sowjetische Bemühungen zur Lokalisierung und Kontaktierung von DPs
Rhetorische Rahmung der Repatriierungsdebatte
Verschollene Kinder
Kriegsverbrecher
Teil II – Die Geschichte der DPs
3 Organisation des DP-Lebens
Formen der DP-Handlungsmacht
Das Lagerleben
Mönchehof: Ein russisches Lager
Esslingen: Ein lettisches Lager
DP-Entscheidungen
»Frei lebende« DPs
DP-Politik
4 DP-Tätigkeiten
Schattenmärkte
Arbeiten in Deutschland
Arbeiten für die »Amis«
Arbeit außerhalb Deutschlands
Studium
5 Andere DP-Tätigkeiten und Freizeitaktivitäten
Optionen für junge Frauen
Tourismus und Abenteuer
Sport
Kultureller Nationalismus
Teil III – Die Lösung des Problems
6 Die IRO und ihr Mandat
Vorgeschichte des Resettlements
Das Resettlement-Programm der IRO und der Kalte Krieg
Anhaltende Konflikte um Repatriierung und Resettlement
Die Tolstoy Foundation
Die »Liberalisierung« der Anerkennungskriterien: Der Fall der baltischen Waffen-SS
Ukrainische und russische Kollaborateure
7 Resettlement als Politik
Vereinigte Staaten
Australien
Kanada
Weitere Zielregionen (Südamerika, Israel, Marokko)
Fragen der »Rasse«: Türken und Kalmücken
Sicherheitsbedenken
8 DPs wägen die Optionen ab
Den richtigen Ausweg finden
Eine gute Geschichte erzählen
Wege zu Unterstützung und Bürgschaft
Späte Entscheidung zur Repatriierung
Der Prozess der Abreise
9 Ungeklärte Fragen
Hard Core
Verbleiben in Deutschland und Österreich
Rückkehr und Ausweisung nach dem Resettlement
Fortgesetzte Bemühungen zur Repatriierung von Sowjetbürgern
Auslieferung und Bestrafung von »Kriegsverbrechern«
Schluss
Anhang
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Danksagungen
Zur Autorin
Extra Seite
Dieses Buch handelt von geflüchteten und entwurzelten Menschen und ist damit unweigerlich eine Geschichte von Leid von Verlust. Den »Displaced Persons« (DPs) aus der Sowjetunion und anderen Ländern, die sich am Ende des Zweiten Weltkriegs in Mitteleuropa wiederfanden, erging es jedoch vergleichsweise gut. Sie wurden von internationalen Organisationen mit annehmbaren Unterkünften, Mahlzeiten und Bekleidung versorgt. Sie konnten Gesundheits- und Kinderbetreuung in Anspruch nehmen. Um sie herum wütete kein Bürgerkrieg, und ihre Lager wurden nicht von bewaffneten Männern überfallen. Sie konnten einer Arbeit nachgehen oder auch nicht, das blieb ihnen überlassen. Sie konnten Schulen und Universitäten besuchen. Sie organisierten eine Fülle von Sport- und Kulturveranstaltungen in den Lagern. Deren Leitungen wurden von den DPs selbst gewählt und gehörten gemeinhin derselben Nationalität wie sie selbst an. Ihr Dasein als DPs währte meist nur zwischen fünf und sieben Jahren, bevor sie in einem Prozess neu angesiedelt wurden, in dem sie gewisse Entscheidungsspielräume hatten: Slawische und baltische DPs wanderten vorwiegend in Erste-Welt-Länder aus und zionistische jüdische DPs nach Palästina.
Die Geschichte der DPs steht also in deutlichem Kontrast zu der Erfahrung nahezu aller anderen Geflüchtetengruppen im 20. Jahrhundert, einschließlich der der jüdischen Menschen, die in den 1930er Jahren aus Nazi-Deutschland flohen, im Ausland aber auf viele verschlossene Tore trafen, und der der palästinensischen Menschen, deren Unglück in den späten 1940er Jahren mit dem der DPs zusammenfiel.
Der Kontrast ist nicht weniger deutlich, wenn wir den Blick auf das späte 20. und frühe 21. Jahrhundert richten, als bekanntlich Millionen von Menschen in Afrika und Asien im Zuge der Dekolonisierung und der sie begleitenden Unabhängigkeitskriege vertrieben wurden und später vor weiteren Kriegen, politischen Unruhen, Naturkatastrophen und Klimaverheerungen flohen. Jeden Abend zeigen uns Fernsehnachrichten die neuesten Bilder von verzweifelten Menschen, die in den Trümmern ihrer zerstörten Häuser wühlen, sich in riesigen staubigen Zeltstädten unter gleißender Sonne versammeln oder sich an die kaum seetüchtigen kleinen Boote klammern, die bei der Überquerung des Mittelmeers, des Pazifiks oder des Ärmelkanals, auf der vergeblichen Suche nach einer Zuflucht, Schiffbruch erlitten.
Stand Mai 2023 betreute das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen 30 Millionen Menschen – weniger als ein Drittel von geschätzt insgesamt 110 Millionen gewaltsam vertriebenen Menschen. Viele Länder, darunter Australien und große Teile Europas, machen Stimmung gegen »Asylsuchende« und bieten allen, die ihre Grenzen zu überqueren versuchen, eine kühlen Empfang, mit Ausnahme der Ukrainerinnen und Ukrainer, die seit Russlands Angriff von 2022 ihr Land verlassen.
1948 waren die Palästinenserinnen und Palästinenser im Nahen Osten und die DPs in Europa die beiden Flüchtlingsgruppen, die für die noch jungen Vereinten Nationen die größte Rolle spielten: 700000 palästinensische Geflüchtete im Nahen Osten und eine Million DPs in Europa wurden von internationalen Hilfsorganisationen versorgt. 2023 waren die DPs und ihre Kinder und Enkelkinder schon lange zu Bürgerinnen und Bürgern der USA, Kanadas, Israels oder Australiens geworden, während die Zahl der palästinensischen Geflüchteten auf sechs Millionen stieg (vor dem Ausbruch des Gaza-Krieges und einer neuen Massenflucht), ohne dass sich nach über 70 Jahren eine Lösung für ihre Not abzeichnet.
Die Geschichte der DPs, die dieses Buch erzählt, sticht heraus aus den Chroniken der Flüchtlingshilfe, weil sie eine Erfolgsgeschichte ist. Was erklärt diesen so beachtlichen Erfolg? War diesen Geflüchteten etwas eigen, das ihre Not vergleichsweise einfach zu bewältigen machte? War die Lösung ein glücklicher Zufall oder das Produkt geschickten diplomatischen und politischen Vorgehens? Es wäre ein schöner Gedanke, dass internationale Zusammenarbeit gelegentlich auch gelingen und gute Absichten zu Erfolg führen können. Doch Ergebnisse können ebenso unvorhergesehene Nebenfolgen von Absichten sein, die nicht besonders gut gemeint waren. Dieses Buch bietet eine Erklärung für die erfolgreiche Lösung der DP-Frage nach dem Zweiten Weltkrieg. Ob sich daraus eine ermutigende moralische Lehre ziehen lässt, müssen Lesende für sich selbst herausfinden.
Einleitung
Als am Ende des Zweiten Weltkriegs sowjetische Truppen den Osten und britische sowie amerikanische Streitkräfte den Westen Deutschlands besetzt hielten, bestand eines der dringendsten Probleme darin, was mit den umherstreifenden Massen von Menschen geschehen sollte – insgesamt bis zu zehn Millionen Personen, darunter alliierte Soldaten, Kriegsgefangene, aus Osteuropa vertriebene Deutsche, Zwangsarbeiter und Geflüchtete osteuropäischer Herkunft, waren zur deutschen Bevölkerung hinzugekommen.1 Aufseiten der Zivilisten gehörten zu ihnen Überlebende der Nazi-Konzentrationslager und Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, die im Krieg aus den besetzten Gebieten in Ost- und Westeuropa oft gegen ihren Willen nach Deutschland gebracht worden waren. Doch unter ihnen befanden sich auch sowjetische und osteuropäische Bürgerinnen und Bürger, die dem Rückzug der Deutschen am Kriegsende in Richtung Westen gefolgt waren, ebenso wie andere, die nach dem Sieg der Alliierten weiterhin aus Osteuropa herausströmten. Aufseiten des Militärs hatten mehrere Millionen sowjetischer Soldaten das Kriegsende als Insassen deutscher Kriegsgefangenenlager erlebt. Eine weitere Gruppe von beträchtlicher Größe waren frühere sowjetische Soldaten, die sich in ebendiesen Lagern von den Deutschen hatten rekrutieren lassen, um gegen die Sowjetunion zu kämpfen, und die sich nach dem Krieg neben deutschen Soldaten in den alliierten Kriegsgefangenenlagern wiederfanden.
Übersicht in diese Situation zu bringen, war eine erhebliche Herausforderung. Die kurzfristige Lösung lag darin, die Zivilisten und später die entlassenen Kriegsgefangenen als »Displaced Persons« zu erfassen (in allen Sprachen setzte sich rasch die englisch ausgesprochene Abkürzung DP durch), sie zu entlausen, mit Essen zu versorgen und bis zu ihrer Repatriierung in Lagern unterzubringen. Bald stellte sich jedoch heraus, dass viele DPs, insbesondere die aus der Sowjetunion, nicht zu einer Rückkehr bereit waren. Daraus entstand ein diplomatisches Problem, das zwischen der Sowjetunion und ihren Verbündeten, Großbritannien und den USA, zu einer großen Streitfrage in den ersten Jahren des Kalten Krieges wurde. Die Sowjets verlangten »ihre« Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zurück; die westlichen Alliierten wichen der Forderung aus und lehnten nach den ersten Monaten eine Zusammenarbeit in der Frage stillschweigend ab. 1947 entschieden die Alliierten über eine Lösung für den sogenannten hard core von ungefähr einer Million nicht-repatriierbarer DPs aus der Sowjetunion und Osteuropa: Sie sollten außerhalb Europas in den Ländern neu angesiedelt werden, die sie aufzunehmen bereit wären. Wie sich herausstellte, waren dies primär Länder in Nordamerika, Australasien, Südamerika und (für jüdische DPs) der junge Staat Israel. Die Sowjetunion zeigte sich empört über das, was sie als »Diebstahl« ihrer Bürgerinnen und Bürger durch Kapitalisten betrachtete, die nach Arbeitskräften gierten.
Das vorliegende Buch erzählt die Geschichte der »DP-Frage«, mit der sich die Alliierten am Ende des Zweiten Weltkriegs konfrontiert sahen, und ihrer hauptsächlich durch die Neuansiedlung der DPs erfolgten Lösung in den späten 1940er und frühen 1950er Jahren. Diese Geschichte ist einerseits eine der Regierungen und der Diplomatie, die sich teilweise innerhalb der neu gegründeten Vereinten Nationen abspielte, wobei die Sowjetunion und ihre osteuropäischen Unterstützer zunehmend in Konflikt mit den USA, Großbritannien und den Ländern Westeuropas gerieten. Dieser Teil der Geschichte setzt am Kriegsende mit der scheinbar unproblematischen konzertierten Bemühung der Alliierten zur Rückführung sämtlicher Kriegsgefangener und Zwangsarbeiter in ihre Herkunftsländer ein, um daraufhin den Zusammenbruch des Kriegsbündnisses und die Entstehung des Kaltes Krieges nachzuzeichnen. Am Ende dieses Teils stand die erfolgreiche Umsetzung eines sehr ambitionierten, größtenteils US-finanzierten Resettlement-Programms, dessen Finanzierung der amerikanische Kongress wohl nie bewilligt hätte, wenn die DPs nicht durch die Linse des Kalten Krieges, also als Opfer des Kommunismus, betrachtet worden wären.
Im Rahmen der entstehenden Antagonismen des Kalten Krieges, war die DP-Frage zwar ein relativ kleines Thema, an dem die politischen Empfindlichkeiten und Verstimmungen der Sowjetunion allerdings besonders deutlich hervortraten. Zunächst einmal wurde es als Demütigung gesehen, dass dermaßen viele sowjetische DPs ihre Repatriierung ablehnten. Natürlich stammten die meisten der Verweigerer nicht aus der »alten« Sowjetunion (aus der Zeit vor 1939), sondern aus den Gebieten im Baltikum, der Westukraine und Belarus, die infolge des Hitler-Stalin-Pakts von 1939 ungewollt in die Sowjetunion einverleibt worden waren. Da Moskau aber keinen Unterschied zwischen den beiden DP-Gruppen sehen wollte, konnte man darauf nur schwer aufmerksam machen. Wie der Marshallplan zum Wiederaufbau Westeuropas wurde die Neuansiedlung von DPs als Beispiel dafür gesehen, wie Kapitalisten mit obszönen Geldsummen um sich warfen, um die Sowjetunion zu schädigen. Doch die Neuansiedlung sowjetischer DPs war ein sogar noch herberer Schlag, weil es aus Sicht der Sowjets dabei zu einer unrechtmäßigen Aneignung ihres Eigentums (ihrer Staatsangehörigen) kam.
Parallel zu dieser Erzählung der großen Mächte verläuft die Geschichte der DPs selbst, angefangen mit ihrer Ankunft in den Lagern bis zu ihrer Ausreise in verschiedene Zielländer einige Jahre später. Displaced Persons wurden oft als »Bauern des Schicksals« beschrieben, als Menschen, die die Kontrolle über ihr Los verloren hatten und erst den Wirren des Krieges und später der Diplomatie der Großmächte ausgeliefert waren. Dieses prägnante Bild, das vielen DPs und ihren Nachkommen im Rückblick reizvoll erschien, ist tatsächlich nur teilweise zutreffend. Denn das realweltlich Geschehene unterscheidet sich nicht nur von der Geschichte, die die institutionellen Archive erzählen, sondern auch von der in Erinnerungen. Je näher der Blick dem Leben der DPs in den Lagern (und außerhalb davon) kommt, umso deutlicher wird der Grad an Handlungsmacht (agency), die sie sowohl kollektiv als auch individuell ausübten.2
Die Verweigerung der Repatriierung war die erste, aber auch nur die offensichtlichste große Übung in puncto Handlungsmacht. Die DPs wurden nach Name, Alter und Nationalität erfasst – aber all diese Informationen beruhten im Wesentlichen auf Selbstangaben. Die Alliierten konnten sie genauso wenig überprüfen wie Angaben zum Ehestand oder zur Kollaboration mit den Deutschen. Es war der kollektive Druck der DPs, der die Alliierten, entgegen ihrer ursprünglichen Absichten, dazu bewog, in Nationalgruppen aufgeteilte Lager zuzulassen und daraufhin auch zunächst »jüdisch« und später »ukrainisch« als Nationalitäten anzuerkennen. DPs konnten selbst entscheiden, ob sie in den Lagern unterkamen (viele holten dort lediglich ihre Rationen ab und lebten in Städten), ob sie einer Arbeit nachgingen (was erlaubt, aber nicht vorgeschrieben war), ob sie sich weiterbildeten (sie konnten kostenlosen Zugang zu deutschen Universitäten erhalten) oder ob sie, wenn es sich um weibliche DPs handelte, in den Lagern eine Art Sozialstaat im Kleinen in Anspruch nahmen und Kinder bekamen. Als das Resettlement-Programm anlief und Anträge an verschiedene nationale Auswahlkommissionen gerichtet werden konnten, hatten DPs die Wahl, wo sie ihr Glück versuchten.
Diese zwei Ebenen der Geschichte – die der Diplomatie der Großmächte und die der Handlungsmacht der DPs – ließen sich mit Blick auf alle DP-Gruppen nachzeichnen, die nach der Massenrepatriierung in den ersten Monaten nach Kriegsende für längere Zeit in Obhut der westlichen Alliierten verblieben. Darunter waren polnische DPs (die größte Gruppe von ihnen), jüdische DPs (die überwiegend aus Polen kamen), jugoslawische und tschechische DPs und weitere Gruppen aus sämtlichen anderen Ländern Osteuropas, ebenso wie DPs aus der Sowjetunion. Das vorliegende Buch befasst sich jedoch spezifisch mit sowjetischenDPs – oder, genauer gesagt, mit jenen DPs, die die Sowjets als die ihren betrachteten. Zu ihnen gehörten nicht nur die Bürgerinnen und Bürger aus der UdSSR der Vorkriegszeit – die nach sowjetischem Recht neben ihrer gemeinsamen Staatsangehörigkeit andere Nationalitäten besaßen und etwa Russen, Ukrainer, Belarussen, Georgier, Juden, Tataren oder Kalmücken waren –, sondern auch Menschen aus den Gebieten, die die Sowjetunion mit dem Hitler-Stalin-Pakt annektiert hatte. Diese Gruppe umfasste Letten, Litauer und Esten aus den vormals unabhängigen baltischen Staaten; Westukrainer und Westbelarussen, die einst polnische Staatsbürger waren; und sogar einige Bessaraber, die früher zu den Staatsbürgern Rumäniens zählten.
Es gibt eine Reihe von Besonderheiten, die sowjetische DPs zu einem äußerst aufschlussreichen Thema machen. Erstens stand diese Gruppe im Zentrum eines »Besitz«-Streits, der sich zwischen der Sowjetunion und den Alliierten abspielte und einen der grundlegenden Konflikte des Kalten Krieges darstellte. Zweitens nahmen einzelne sowjetische DPs oft falsche Identitäten (als Polen, Jugoslawen oder staatenlose Russen) an, um unentdeckt zu bleiben und der Zwangsrepatriierung zu entgehen. Praktiken der Täuschung – ein sozialgeschichtlich stets höchstinteressantes Thema – werden in diesem Buch als eine bedeutende Form von Handlungsmacht beleuchtet, die von westlichen Behörden stillschweigend hingenommen und von DPs selbst ins Leben gerufen wurde.
Die Alliierten verwendeten die Bezeichnung »russisch« oft als Synonym für »sowjetisch«, wenn es um DPs ging. Die Sowjetunion war aber ein Vielvölkerstaat (auch wenn Russisch als Lingua franca diente), dessen Einwohner nicht nur sowjetische Bürgerinnen und Bürger waren, sondern auch verschiedene Nationalitäten hatten. Unter den sowjetischen DPs waren die mit russischer Nationalität nur eine Minderheit, obgleich eine bedeutende. Noch unübersichtlicher wurde es dadurch, dass sowjetische Russen nicht die einzigen russischen DPs waren: Es gab auch »staatenlose« Auswanderer, die Russland nach der Revolution von 1917 verlassen und seitdem in Paris, Berlin, Prag oder Belgrad gelebt hatten. Diese Gruppe stieß anfangs oft auf Schwierigkeiten bei der offiziellen Anerkennung als DPs (nicht zuletzt aufgrund des Verdachts der Kollaboration mit den Nazis), die sich später jedoch legten. Sich als staatenlose russische Emigranten auszugeben, war bei sowjetischen Russen eine beliebte Methode, um der Repatriierung zu entgehen. Die russischen Auswandererinnen sind daher ein unverzichtbarer Teil der Geschichte, die dieses Buch erzählt.
Von den vielen sowjetischen Nationalitäten waren ukrainisch und belarussisch unter den DPs überrepräsentiert, was vor allem damit zusammenhing, dass sie am weitesten im Westen und am längsten unter deutscher Kriegsbesatzung gelebt hatten und folglich auch am häufigsten als Zwangsarbeiter eingesetzt wurden (dazu kamen noch diejenigen, die mit dem Rückzug der Deutschen am Kriegsende freiwillig gingen). Bei vielen der ukrainischen DPs handelte es sich tatsächlich um »polnische Ukrainer« oder »Westukrainer«, die vor 1939 keine Sowjetbürger gewesen waren; da sie in eine Kategorie fielen, die die westlichen Alliierten allgemein für nicht-repatriierbar erachteten, gaben sich aber »Sowjetukrainer« (Zentral- und Ostukrainer aus der Sowjetukrainischen Republik der Vorkriegszeit) ebenfalls als solche aus, um der Repatriierung zu entgehen. Das ukrainische Thema – zu dem auch die »Kosaken« gehören, als die sich viele der militantesten ukrainischsprachigen antisowjetischen Gruppen identifizierten – ist ein komplexer und wichtiger Teil der in diesem Buch behandelten Geschichte.
Eine andere große Gruppe, die die Sowjets als ihre zu repatriierenden Bürgerinnen sah, waren DPs aus den baltischen Staaten (Lettland, Litauen und Estland). Damit sind sie nolens volens Teil meiner Darstellung, was jedoch keineswegs heißen soll, dass ich sie in irgendeinem echten Sinne als »Sowjets« verstehe. Die meisten baltischen DPs waren im Herbst 1944, als sich die Deutschen aus ihren Gebieten zurückzogen, nach Westen geflohen, um kein zweites Mal unter sowjetischer Besatzung leben zu müssen. Tatsächlich unterschieden sie sich, was ihr Auftreten und Ansehen betraf, so deutlich von den »vorkriegssowjetischen« DPs (die zumeist russisch und ukrainisch waren), dass ich diesen Kontrast (insbesondere mit Blick auf die mir vertrauteste baltische Gruppe der Letten) oft dazu benutze, um die Vielfalt innerhalb der breiten Kategorie von DPs zu betonen, die die Sowjets für sich reklamierten.
Jüdische DPs bilden eine weitere bedeutende Gruppe in meiner Darstellung. Für viele Historikerinnen stellen jüdische Menschen den Inbegriff der DPs dar: Ihre Geschichte machte 1945/46 in den USA zuerst Schlagzeilen und prägte den Deutungsrahmen für ein internationales Publikum. Tatsächlich war der Großteil der DPs nicht jüdisch, sondern slawisch oder kam aus dem Baltikum. Jüdische DPs schätzten nicht-jüdische DPs nicht sonderlich, weil sie sie mit ihrer Verfolgung im Krieg assoziierten, und slawische und baltische DPs erwiderten die Abneigung häufig. Jüdische DPs verweigerten die Repatriierung in ihre Herkunftsländer, weil man sie dort abgewiesen hatte. Bei den slawischen und baltischen DPs, die die Sowjets für sich reklamierten, verhielt es sich umgekehrt – sie wurden nicht abgewiesen, lehnten aber die Sowjetunion ab.3
Der jüdische Strang ist nicht deshalb Teil dieser Geschichte, weil er für alle anderen steht, sondern sich in wichtiger Hinsicht so deutlich unterscheidet. Zugleich gab es faszinierende Felder der Gemeinsamkeit, nicht zuletzt geteilte Russischkenntnisse. Die polnischen Juden – die größte einzelne jüdische Gruppe in den DP-Lagern – hatten den Holocaust größtenteils dadurch überlebt, dass sie die Kriegsjahre in der Sowjetunion verbrachten. Manchmal hatten sie sich dazu entschieden – und waren vor den Nazis in Richtung Osten geflohen oder von den Sowjets in die neu einverleibten westukrainischen und westbelarussischen Gebiete evakuiert worden –, manchmal war es die Folge einer Deportation durch sowjetische Behörden, doch das Ergebnis blieb dasselbe: Die meisten überlebten (nach einer Amnestie für die Deportierten), gesellten sich während des Kriegs unter Russisch sprechende Menschen und lernten ihre Sprache, wenn sie sie nicht schon sprechen konnten. Am Kriegsende wurde den polnischen Juden (sowie den ethnischen Polen) erlaubt, die Sowjetunion in Richtung Polen zu verlassen, von wo aus viele schnell weiter nach Österreich und Deutschland zogen und dort als späte und umstrittene Ergänzung in die Kategorie DP aufgenommen wurden. Während diese große Gruppe polnischer Juden westwärts wanderte, bewegte sich eine weitaus kleinere Zahl einzelner jüdischer DPs mit sowjetischer Herkunft – deren Geschichten in den späteren Kapiteln teilweise noch beleuchtet werden –, aus Deutschland und Österreich in Richtung Osten und ging als freiwillige Rückkehrer in die Sowjetunion zurück.4
\ \ \
Der Titel des vorliegenden Buchs bezieht sich nicht nur auf die entwurzelte Situation und die ungewisse Zukunft der DPs, sondern auch auf das alte russische Wort für »Seele« (dusha), das im System der Leibeigenschaft im Sinne eines Stück Eigentums verwendet wurde, als sich der Reichtum adliger Grundherren weniger über die Fläche ihres Landesbesitzes als über die Zahl der dort lebenden Seelen (Leibeigenen) definierte. Der russische Staat war gleichfalls ein Besitzer von bäuerlichen Leibeigenen, und die Vorstellung von Arbeitskräften als einer Form von Eigentum bestand unterschwellig auch in der Sowjetunion fort, was nicht zuletzt an ihrer Reaktion auf den Verlust von fast einer halben Millionen ihrer Bürgerinnen und Bürger in den DP-Lagern in Europa deutlich wird.
Für die DPs erwies sich ihr »Verloren-Sein« als lediglich temporär, wobei sie die von den Großmächten angebotenen, konkurrierenden Auswege daraus selbst gegeneinander abwägen konnten. Der von den Sowjets offerierte Pfad der Repatriierung war eine der beiden Hauptoptionen. Zu großen Zwangsrepatriierungen kam es nur 1945 und Anfang 1946, aber bis in die frühen 1950er Jahre hielt ein kleiner Strom freiwilliger Rückkehrender an. Obwohl nur wenige diese Entscheidung trafen, ist sie dennoch interessant – umso mehr, als die von den Sowjets bei der Wiederreise durchgeführten Befragungen (die ich in einer frühen Phase meiner Recherchen in russischen Archiven entdeckte) Einblicke in die Einstellungen und Prioritäten von DPs gewähren, die andere Quellen nicht bieten. Das Resettlement war die Option, die die westlichen Alliierten nach mehreren ungewissen Jahren anboten und bei der die Hauptziele die USA, Australien, Israel und Kanada waren. Die DPs, die Ende 1945 noch nicht repatriiert worden waren, entschieden sich größtenteils für diese Option. Das Verbleiben in Deutschland oder Österreich war die dritte Möglichkeit, die sich am Ende der 1940er Jahre, nachdem die Lager geschlossen und die meisten DPs ausgewandert waren, einer kleinen Gruppe als letzte Option auftat. Für einige lag darin mehr Schicksal als Wahl, denn oft handelte es sich um DPs, die aufgrund von Alter, Gebrechlichkeit, Sicherheitsbedenken oder nicht nachgefragter (intellektueller) Berufe von keiner der nationalen Auswahlkommissionen in das Resettlement-Programm aufgenommen wurden. Andere wiederum, darunter zweifellos auch manche derjenigen, die sich in einer der grundlegen DP-Aktivitäten – nämlich dem informellen und illegalen Handel – hervortaten, blieben aus freien Stücken.
Die Repatriierung war die ausdrückliche Aufgabe der United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA), der ersten für die DPs zuständigen internationalen Hilfsorganisationen. Die während des Kriegs von den Alliierten, einschließlich der Sowjetunion, gegründete UNRRA hatte noch viele andere Aufgaben im Bereich Nothilfe und Wiederaufbau, die teilweise für dringender als die Repatriierung der DPs erachtet wurden. Nach der Gründung der Vereinten Nationen im Jahr 1945 blieb die UNRRA zwar konstitutionell und finanziell unabhängig, funktionierte aber dennoch fast wie ein Teil der UN, und wichtige politische Fragen in Bezug auf ihre Arbeit wurden von der UN-Generalversammlung diskutiert. Für die Aufgabe der Repatriierung kooperierte sie mit den Militärverwaltungen in den Besatzungszonen der Westmächte (USA, Großbritannien und Frankreich) in Deutschland und Österreich (die sowjetischen Besatzungsbehörden, die den DP-Status nicht anerkannten, repatriierten entsprechende Personen einfach möglichst schnell und überließen unklare Fälle den Alliierten). Die UNRRA, eine wahrlich international besetzte Organisation, hatte sich zunächst aufgeschlossen für eine Kooperation mit der Sowjetunion gezeigt, was ihr den Ruf als einer gegenüber dem Kommunismus nachsichtigen Weltverbesserer-Organisation einbrachte und sie das Vertrauen der USA, ihres wichtigsten Geldgebers, kostete. Es war die Geburtsstunde dessen, was der britische Premierminister Winston Churchill bekanntlich als »Eisernen Vorhang« bezeichnete, der Europa in Ost und West trennte und damit den Fortbestand der UNRRA – insbesondere den Großteil ihrer Finanzierung, den sie vom UN-Kongress erhielt – untragbar werden ließ. 1947 stellte die Organisation ihre Arbeit ein.
Die Nachfolgerin der UNRRA war die International Refugee Organization (IRO), eine zwar weiterhin internationale Einrichtung, die tatsächlich aber eher unter amerikanischer Kontrolle stand und fast ausschließlich durch den US-Kongress finanziert wurde. Die IRO machte das Resettlement der DPs zu ihrer Hauptaufgabe, was in der Sowjetunion, die den Beitritt zu der Organisation abgelehnt hatte, für Empörung sorgte. Diese institutionelle Verschiebung fiel mit dem Anbruch des Kalten Krieges zusammen, und das Thema Resettlement wurde schon früh politisch prägend für diese Phase. Der Kalte Krieg war kein absoluter Rahmen für die IRO – sie übernahm viele Angestellte der UNRRA, darunter auch amerikanisches Personal, das zuvor in Präsident Roosevelts New-Deal-Behörden Erfahrung gesammelt hatte –, dennoch war sie viel eindeutiger als die UNRRA eine westliche Institution, die sich mit der Sowjetunion nicht vertrug. In den letzten Jahren des Resettlement-Programms der IRO, das von 1947 bis Anfang der 1950er Jahre lief, zogen sich die Militärverwaltungen aus den drei westlichen Besatzungszonen zurück und übergaben die Regierungsgewalt an die von den USA unterstützte, neu gegründete Bundesrepublik – die damit zur westlichen Seite eines geteilten Deutschlands wurde, dessen anderer (kleinerer und weniger mächtigere) Teil die aus der sowjetischen Besatzungszone entstandene Deutsche Demokratische Republik war.5
Im Laufe des Bestehens der IRO erfuhr der Begriff »Displaced Person« eine wesentliche Bedeutungsverschiebung, die dem neuen Kontext des Kalten Krieges entsprach. Zunächst waren »Displaced Persons« – die meist aus Osteuropa und Sowjetunion kamen – von der UNRRA offiziell als Opfer des Nationalsozialismus und Kriegs definiert worden. Ohne dass sich daran formal etwas änderte, wurden DPs jedoch etwa von 1947 an als Opfer des Kommunismus betrachtet, deren Widerwille gegen die Rückkehr in ihre Herkunftsländer, die nun unter mehr oder weniger prosowjetischer kommunistischer Kontrolle standen, der Grund für ihre Vertreibung sei. Eine Konsequenz daraus war, dass die Kollaboration mit den Nazis, die zuvor ein großes Hindernis für die Erlangung des DP-Status (der Voraussetzung für das IRO-Resettlement) dargestellt hatte, zu einem unbedeutenden Problem wurde. Sogar wenn Russen, Ukrainer oder Letten im Krieg unter deutschem Kommando gedient hatten, erschien das nun als Zeichen für den Wunsch, den sowjetischen Kommunismus zu bekämpfen, und weniger als Indiz für Sympathien mit den Nazis.
Quellen
Die Handhabung der DP-Frage durch die Großmächte und internationalen Hilfsorganisationen ist in deren jeweiligen Archiven dokumentiert, die, wie gewöhnlich bei staatlichen und institutionellen Archiven, besonders aufschlussreich sind, wenn es um bürokratische Konflikte geht. Ich habe versucht, die diplomatische Geschichte nicht nur aus der vertrauteren westlichen, sondern auch aus der sowjetischen Perspektive zu erzählen, indem ich neben englisch-, französisch- und deutschsprachigen auch russischsprachige Quellen heranzog, sowohl veröffentlichte als auch unveröffentlichte. Unter den Aufnahmeländern des IRO-Resettlement war Australien das Land, dessen Archive ich am ausgiebigsten benutzt habe (und das nach den USA die meisten DPs aufgenommen hat). Dies war für mich eine notwendige Strategie, insofern als ich während der COVID-19-Pandemie in Australien lebte, bietet jedoch auch den Vorteil, die USA, deren Geschichte der DP-Einwanderung am bekanntesten ist, in ein vergleichendes Licht zu stellen.
Archive gewähren historisch Forschenden grundsätzlich bessere Einblicke in politische und diplomatische Entwicklungen als in individuelle Erfahrungen. Um die DP-Erfahrung in all ihrer Vielfalt zu ergründen, bleiben uns hauptsächlich Memoiren (eine unschätzbar wertvolle Quellensorte, auch wenn Menschen Ereignisse rückblickend wohl anders betrachten als zum Zeitpunkt ihres Geschehens), ergänzt durch bürokratisches Material, wie etwa von UNRRA- und IRO-Personal verfasste Berichte über die Zustände in den DP-Lagern. Im Westen wurden DPs bei ihrer Einwanderung zwar nicht systematisch befragt, in den Archiven der Aufnahmeländer finden sich aber einige Materialien aus den Auswahlkommissionen. Die sowjetischen Behörden führten dagegen lose strukturierte Interviews mit Rückkehrern durch, die im Hinblick auf die allgemeinen Einstellungen und Entscheidungen der DPs überraschend erhellend sind. Eine weitere wertvolle Quelle zu individuellen Lebenserfahrungen – für die es meines Wissens kein Pendant in anderen Diaspora-Kontexten gibt – ist die russischsprachige australische Zeitschrift Avstraliada, die nach dem Kriegsende zwei Jahrzehnte lang Erinnerungen und Biografien ausgewanderter russischer DPs veröffentlichte.6
Schließlich wäre da noch eine Quelle, die für mich persönlich von besonderer Bedeutung ist: die Dokumente meines verstorbenen Ehemanns Michael Danos (ich nenne ihn Misha; für diejenigen, die ihn aus seinen Jahren in Deutschland kannten, hieß er Mischka) und die seiner Mutter Olga Danos, die beide DPs im Deutschland der Nachkriegszeit waren. Als Misha 1999 starb, wurden mir ihre sehr ergiebigen Dokumente vermacht, darunter Tagebücher und regelmäßige Briefe zwischen den beiden aus den Jahren 1944 bis 1951 (glücklicherweise für mich als Historikerin lebten sie fast die ganze Zeit über in verschiedenen deutschen Städten und DP-Lagern); diese Dokumente werden nun in der Sondersammlung der University of Chicago aufbewahrt. Die Briefe der einfallsreichen und unternehmerischen Olga erzählen vieles über die Handlungsmacht und die Möglichkeiten der DPs, die sich in anderen Quellen nicht finden. Zahlreiche Einsichten boten mir auch die Interviews, die ich nach Mishas Tod mit seinen lettischen Freunden und Zeitgenossen aus dem DP-Kontext geführt habe. Sie erzählten mir von der DP-Geschichte aus ihrer jeweils eigenen individuellen Perspektive (und teilten mit ihr ihre Reaktionen auf Mishas Version).7
Mishas Geschichte kenne ich nicht nur aus Dokumenten und Interviews, sondern auch aus persönlichen Gesprächen, die wir vor 40 Jahren begannen, als er schließlich bereit war, über diese Episode seiner Jugend zu reflektieren. Wenn ich zum Thema DPs arbeite, ist Misha mir stets präsent, weil er die von mir beschriebenen Ereignisse und Umstände laufend, aber nur für mich hörbar kommentiert. In diesem Buch streue ich stellenweise kleine Zitate aus diesem Kommentar ein, um Lesende daran zu erinnern, dass mir das Thema dieses Buches, so distanziert mein Stil als Historikerin auch sein mag, ein persönliches Anliegen ist.
Teil I
Die Geschichte der Großmächte
1 Die UNRRA und ihr Mandat
Sich mit Displaced Persons zu befassen, kann leicht zu der Annahme führen, dass ihr Schicksal für die Siegermächte am Ende des Zweiten Weltkriegs oberste Priorität gehabt hätte. Tatsächlich sahen sich die Alliierten damals aber mit einer Vielzahl dringender Probleme konfrontiert, und das der DPs war nicht einmal das wichtigste von ihnen. »Alle Welt ist in Schwierigkeiten, und ich muss mich mit allen Problemen gleichzeitig auseinandersetzen«, erklärte der zerstreut wirkende britische Außenminister Ernest Bevin im November 1945 vor dem Unterhaus. Ein zweifellos heikles Thema war das der Repatriierung. Für die dabei involvierten Großmächte – das Vereinigte Königreich, die USA und die Sowjetunion – hatte es jedoch nicht die existenzielle Bedeutung wie andere Probleme, etwa die Verwaltung des besetzten Deutschlands, der Wiederaufbau der kriegsgezeichneten Volkswirtschaften Europas, die Bestimmung und Entnahme von Reparationen aus Deutschland, die Demobilisierung der Streitkräfte und die Heimkehr der Soldaten, ganz zu schweigen von der Gestaltung der Beziehungen zwischen der UdSSR und den westlichen Alliierten angesichts der faktischen Kontrolle Osteuropas durch die Sowjetarmee.
Als General Lucius Clay im Mai 1945 Deutschland erreichte, um seinen Posten als Eisenhowers stellvertretender Stabschef beim Oberkommando der alliierten Streitkräfte (SHAEF) anzutreten, bot sich ihm ein düsteres Bild. »Alle Regierungsgewalt – im Staat, in den Ländern, Bezirken und Städten – war zusammengebrochen; Postverbindungen gab es nicht mehr; das Nachrichtenwesen war aus Sicherheitsgründen und zum Gebrauch der einströmenden Armeen übernommen worden«, wobei allein die amerikanischen Streitkräfte rund drei Millionen Soldaten und Mitarbeiter zählten. Die Alliierten mussten mit sieben Millionen deutschen Kriegsgefangenen fertig werden, die sich ihnen ergeben hatten, zusätzlich zu den Millionen aus osteuropäischen Staaten vertriebenen Deutschen, die ins Land strömten, und einer ähnlich großen Zahl nicht-deutscher Personen, die der Krieg nach Deutschland gebracht hatte. »Auf den Landstraßen und an den Zügen spielten sich bei dieser riesigen Massenwanderung unbeschreibliche Szenen ab.«
In den sechs Jahren, bis die letzten aus dem hard core der verbliebenen DPs als sogenannte »heimatlose Ausländer« zur deutschen Bevölkerung hinzukamen, war die Frage der Displaced Persons zwar ein Dauerthema, das die Allliierten und die Beziehungen zwischen ihnen belastete, blieb dennoch stets ein zweitrangiges Problem. Dies galt sogar für die Sowjetunion, für die die Frage der Repatriierung sowjetischer DPs »einen empfindlichen Nerv zu treffen schien, was […] ihr Selbstbild und Gerechtigkeitsempfinden anbelangte«. Für die westlichen Alliierten dagegen war der schwierigste Teil der DP-Frage nicht ihre sowjetische, sondern ihre jüdische Dimension – die für die Vereinigten Staaten ein großes Anliegen war, bei dem die Interessen und politischen Prioritäten der Briten und Amerikaner aber auseinandergingen. Im Rahmen der neu gegründeten Vereinten Nationen fand das DP-Problem Eingang in die entstehende Debatte um Menschenrechte und gab Anlass zu verbalen Gefechten zwischen der US-Delegierten Eleanor Roosevelt und dem sowjetischen Vertreter Andrei Vyshinsky. Allerdings war auch dies im Grunde ein Nebenschauplatz, auf dem über Prinzipien gestritten, nicht jedoch über das Vorgehen verhandelt wurde.1
Das Zusammenspiel der Alliierten, das während des Krieges bei den Treffen zwischen Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt und Josef Stalin so überraschend gut funktioniert hatte, war durch zwei Ereignisse völlig aus dem Lot geraten: den Tod von Roosevelt im April 1945, einen Monat vor dem Sieg der Alliierten, und die Niederlage der Tories unter Churchill bei den britischen Unterhauswahlen am 28. Juli. Letzteres stellte eine schwerwiegende Zäsur dar, wie bei der Potsdamer Konferenz im Juli und August 1945, dem ersten Treffen der alliierten Anführer nach dem Kriegssieg, deutlich wurde: Premierminister Churchill und sein Außenminister Anthony Eden, die ursprünglichen Vertreter Großbritanniens, mussten nach ihrer Wahlniederlage während der laufenden Konferenz durch den neuen Labour-Premierminister Clement Attlee und seinen Außenminister Ernest Bevin ersetzt werden. Dem sowjetischen Außenminister Vyacheslav Molotov war unbegreiflich, wie die Briten sich so unfeierlich ihrer »Planer des Siegs« entledigen konnten (»Offenbar muss man das englische Eigenleben besser verstehen«, merkte er dazu an). In Potsdam folgte ein weiterer Schock, als Truman Stalin bei ihrer ersten und einzigen Begegnung darüber informierte, dass die USA über »eine neue Waffe mit außergewöhnlicher Zerstörungskraft« verfügten – nämlich die am 6. August 1945, nur wenige Tage nach der Konferenz, über Hiroshima abgeworfene Atombombe.
Die wohlhabenden und vom Krieg relativ verschont gebliebenen Vereinigten Staaten gaben 1945 im Wesentlichen den Ton an, nur ihre Verbündeten aus Kriegszeiten mussten sich daran gewöhnen. Großbritannien, das am Rande des Bankrotts stand und nur von den USA Rettung erwarten konnte (die aber noch zögerten), war im Begriff, sein Empire und damit auch seine Weltmachtposition zu verlieren, während es weiterhin seine Besatzungszonen in Deutschland und Österreich zu verwalten hatte. Die britisch-amerikanischen Beziehungen gestalten sich in den ersten Nachkriegsjahren schwierig, bis die USA sich im Zuge des Marshallplans bereit erklärten, Großbritannien aus der Klemme zu helfen. Auch die Sowjetunion war in wirtschaftlicher Not, konnte jedoch noch weniger damit rechnen, dass Amerika ihr zuhilfe eilen wird. Immerhin bot es ihr Trost zu wissen, keine absteigende, sondern eine aufstrebende Großmacht zu sein, die nicht mehr länger wie in den Vorkriegsjahrzehnten eine Außenseiterrolle spielte.
Formal war Deutschland in vier Verwaltungszonen unterteilt worden, nachdem Frankreich neben Großbritannien, den USA und der Sowjetunion zur Siegermacht erklärt worden war. Die britische Zone lag im Nordwesten, dem am stärksten industrialisierten und bevölkerungsreichsten Teil Deutschlands, aber die Industrie stand still, ohne dass Einigkeit darüber bestand, wie sie wieder zum Laufen gebracht werden konnte. Die US-Zone im Süden, zu der auch Bayern gehörte, war das größte und finanziell bestausgestattete Gebiet. Die Sowjets kontrollierten den Ostteil Deutschlands, während Frankreich als Zugeständnis an General de Gaulle ein kleines Gebiet zugeteilt wurde, das zu den beiden anderen westlichen und der sowjetischen Besatzungszone hinzukam. Auch die frühere Hauptstadt Berlin wurde zwischen den Siegermächten aufgeteilt.
Bei allem guten Willen, den sie in Kriegszeiten auch bewiesen, verloren die Sowjets nie aus den Augen, dass sie Kapitalisten als Verbündete hatten. Ausgehend von ihrer Analyse der Nachkriegssituation erwarteten sie, dass der Streit um die Kriegsbeute zu einem Konflikt zwischen dem absteigenden Großbritannien und den aufstrebenden USA führen werde und dass die Widersprüche im Kapitalismus sich offenbaren und wahrscheinlich eine neue Große Depression im Westen auslösen würden. Aus sowjetischer Sicht war es eine ermutigende Prognose, vor allem wenn sich die USA wie nach dem Ende des Ersten Weltkriegs rasch aus Europa zurückziehen würden. Auf kurze Sicht sah die Sowjetunion keine Notwendigkeit, auf Konfrontationskurs zu den Westmächten zu gehen. In den ersten Tagen nach dem Kriegende war es tatsächlich ihre Absicht zu kooperieren, um sich wirtschaftliche Wiederaufbauhilfen in jeder nur verfügbaren Form zu sichern, seien es deutsche Reparationszahlungen oder amerikanische Kredite, während sie sich zugleich »Zeit ließen, damit die Differenzen zwischen Briten und Amerikanern hervortreten« konnten. Doch die Sowjets hatten auch einen ausgeprägten Sinn für das, was ihnen (aus ihrer Sicht) als Sieger im Krieg gegen Deutschland zustand, nämlich »eine gerechte Verteilung der Beute aus dem Krieg, eines durch große Opfer des sowjetischen Volks gewonnenen Kriegs«, sowie die Anerkennung ihres Lands »als einer legitimen Großmacht«. Hitler hatte sie in den Jahren von 1939 bis 1941 hereingelegt, aber das würde ihnen nicht noch einmal passieren. »Meine Aufgabe als Außenminister war es sicherzustellen, dass sie uns nicht für dumm verkauften«, erinnerte sich Molotov später.2
Die harte Haltung der Sowjets führte jedoch schnell zu Problemen mit den westlichen Alliierten. Im Dezember schickte Sir Archibald Clark Kerr, der seit 1942 als britischer Botschafter in Moskau fungierte, ein Telegramm an seine Vorgesetzen in Whitehall, in dem er die Schwierigkeiten mit den Sowjets durchaus verständnisvoll zusammenfasste:
»Ihre Obsession mit Sicherheit seit den Tagen der Revolution; ihre Überzeugung, dass der Rest der Welt gegen sie sei; die enorme Erleichterung, die sie verspürten, als die Deutschen zurückgedrängt wurden; der Schock zu erfahren, dass das alte Gespenst der Unsicherheit mit der Erfindung der Atombombe in Westen immer noch da war; ihre enttäuschte Hoffnung darauf, dass das Geheimnis mit ihnen geteilt werde; ihr erniedrigter Stolz und das Wiederaufleben all ihres Misstrauens gegenüber dem Westen, als es nicht mit ihnen geteilt wurde.«
Kerr pflegte ein überraschend freundliches Verhältnis zu Stalin und dem früheren Außenminister Maxim Litvinov (dessen Ansichten er in der oben zitierten Passage wiedergibt), hatte von Litvinovs Nachfolger Molotov jedoch eine weniger hohe Meinung. Dessen Vorschlag, eine Außenministerkonferenz in Moskau abzuhalten, kommentierte Kerr in seinem Telegramm mit den Worten, Molotov habe darauf »sein giftiges Herz gerichtet«. Das Bild des sowjetischen Außenministers als schroffer, feindseliger Verhandlungsverweigerer, zu dem nicht einmal der gesellige Kerr ein persönliches Verhältnis aufzubauen vermochte, war in der diplomatischen Welt weit verbreitet und belastete die Beziehungen zwischen den Alliierten in der Nachkriegszeit, ebenso wie es prägend für einen unglücklichen Stil in der sowjetischen Diplomatie wurde. Molotov war, wie er selbst einräumte, kein Diplomat. Sein störrischer, uneinfühlsamer Stil hatte bei seinen ersten diplomatischen Begegnungen (bei denen er kurz nach Amtsantritt auf Hitler und Ribbentrop traf, um den Pakt von 1939 zu besiegeln) tatsächlich auch ziemlich gut funktioniert, und Stalin riet ihm zweifelsohne, den Umgang mit den Alliierten nach dem Krieg so fortzuführen.
Eigentlich hätte es, was die Nachkriegsdiplomatie anbelangte, von Vorteil sein können, dass Molotov offenbar weiterhin die Nummer zwei in der sowjetischen Polithierarchie und damit viel bedeutender als ein bloßer Karrierediplomat war. Stalin, der selbst sehr erfahrene Untergeordnete gerne auf Trab hielt, hatte Molotov jedoch gerade erst im geschlossenen Kreis der Moskauer Führung, unsichtbar für die Augen der Welt, massiv zurechtgewiesen. Zu allem Übel lautete der scheinbare Grund für die Schelte, dass das »alte Steinerne Gesicht«, wie man ihn schimpfte, zu großzügig im Umgang mit dem Westen sei. Vor diesem Hintergrund verengte sich nicht nur Molotovs Spielraum für Eigeninitiative sehr stark, sondern er selbst brachte sich auch politisch in Gefahr. Es verwundert daher nicht, dass sein Ton in den Verhandlungen mit dem Westen immer schärfer und unangenehmer wurde.3
Als Vertreter der Sowjetunion im Ausland standen Molotov sein Stellvertreter (und ab 1949 sein Nachfolger als Außenminister) Andrei Vyshinsky und der Funktionär Andrei Gromyko zur Seite. Vyshinsky, ein Jurist ohne eigenständiges politisches Ansehen, der sich in den Schauprozessen der 1930er Jahre mit der Forderung einen Namen gemacht hatte, die Angeklagten »wie tollwütige Hunde zu erschießen«, wollte seine rhetorischen Fähigkeiten nun gerne auf der diplomatischen Bühne demonstrieren. Der viel jüngere Gromyko, der minimal ausgebildet und erfahren mit der Umbesetzungswelle nach der Großen Säuberung an die Spitze der Sowjet-Diplomatie gedrängt war, zeigte sich rhetorisch weniger aggressiv und war vom Temperament her trocken, vorsichtig und distanziert. Vor dem Krieg hatten zwei angesehene Diplomaten – Maxim Litvinov, der Amtsvorgänger von Molotov, und Ivan Maisky, der sowjetische Botschafter in Großbritannien – gute Verhältnisse zu ihren westlichen Kollegen aufgebaut, aber beide waren nun aus den hohen Ämtern entfernt worden und sollten bald endgültig kaltgestellt werden.
Die sowjetischen Beziehungen zu ihren einstigen Verbündeten verschlechterten sich nach dem Krieg zusätzlich noch dadurch, dass Stalin und andere Mitglieder der Sowjetführung, die den Verlust Roosevelts bedauerten, Truman für einen Niemand hielten und den britischen Außerminister Ernest Bevin leidenschaftlich verachteten. Auch wenn man denken könnte, dass Bevin als Labour-Politiker der alten Garde sich mit den Sowjets zu verständigen wusste, war tatsächlich das Gegenteil der Fall: Als Gewerkschafter aus dem rechten Labour-Flügel, der in seinen Lehrjahren die britischen Kommunisten bekämpft hatte, übertrug Bevin die Feindseligkeit von früher auf die sowjetischen Kommunisten. Diese wiederum lehnten Bevin ab, weil er für sie den Geist der Zweiten Internationale verkörperte und für alles stand, was sie an der nicht-revolutionären britischen Arbeiterklasse verabscheuten. Bemerkenswert für egalitäre Sozialisten wie Stalin und Molotov war dabei, dass sich beide – manchmal auch öffentlich – darüber mokierten, dass Bevin kein »Gentleman« sei.
Natürlich funktionierte es auch umgekehrt: Dean Acheson, nach US-Maßstäben sicherlich kein Hardliner-Antikommunist, zeigte sich abgestoßen von der sowjetischen Eigenart, »Rüpelhaftigkeit als Mittel zu kultivieren, um ihre Verachtung für die kapitalistische Welt kundzutun«. In all den Jahren, in denen er mit verschiedenen sowjetischen Diplomaten zu tun hatte, erinnerte er sich später, habe er nie einen Draht zu irgendeinem von ihnen gefunden, genauso wenig alle anderen seiner Kollegen. Eleanor Roosevelt, die Frau des verstorbenen US-Präsidenten, die mit ihren Ansichten grundsätzlich weiter links als Acheson stand, gab sich in ihrer Zeit als US-Delegierte bei der UN-Generalversammlung zunächst alle Mühe, die Unsicherheit der sowjetischen Diplomaten zu verstehen und zuzulassen. Ihre Versuche, so etwas wie eine persönliche Beziehung zu ihnen aufzubauen, wurden jedoch konsequent zurückgewiesen. Nachdem sie bis 1948 bei dem Thema Menschenrechte wiederholt mit Vyshinsky aneinandergeraten war und ihre Bemühungen schließlich aufgegeben hatte, schrieb sie, dass bei Verhandlungen mit den Russen »eitel Sonnenschein« nicht weiterhelfe, sondern Härte gefragt sei.
Die Beziehungen zwischen den amerikanischen und sowjetischen Militärführern gestalteten sich weit freundlicher, und zwar so sehr, dass es General Clay schmerzte und enttäuschte, dass sein Kollege General Vasily Sokolovsky ab ungefähr 1947 und vermutlich auf politischen Druck hin »seine frühere Herzlichkeit« im persönlichen Umgang vermissen ließ. Auch Kommandeur Robert A. Jackson, der für die UNRRA als Problemlöser und persönlicher Assistent des Generaldirektors für die Region Europa fungierte, pflegte gute Beziehungen zu vielen Sowjets, mit denen er vor und nach 1945 zu tun hatte, insbesondere zu den Handelsvertretern, denen er im Nahen Osten in Kriegszeiten begegnet war – allerdings nicht wenn es um das Thema Displaced Persons ging, bei dem »totale und fundamentale« Uneinigkeiten bestanden. Wie Jackson in einem Interview in den 1980er Jahren erklärte: »Unser Kampf gegen Stalin drehte sich um die DP-Frage.«4
Gründung der UNRRA
Die Alliierten hatten schon vor 1945 darüber nachgedacht, welches Trümmerfeld der Krieg hinterlassen wird. 1943 gründeten sie die UNRRA, die den Auftrag hatte, Nothilfe zu leisten, die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern, die Wiederherstellung der grundlegenden Versorgung zu unterstützten sowie »Gefangene und Exilierte in ihre Herkunftsländer zurückzuführen«. Hintergrund war der sowjetische Vorschlag aus dem Vorjahr, eine internationale Hilfsorganisation für Europa in der Zeit nach dem Krieg ins Leben zu rufen (obwohl damals von Repatriierung noch keine Rede war). Organisatorische Vorläufer waren die Mitte 1942 von Großbritannien aufgebaute Middle East Relief and Refugee Administration – in deren Rahmen einige spätere UNRRA-Führungskräfte ihre Erfahrungen im Bereich der Nothilfe sammelten und ihre ersten Begegnungen mit Displaced Persons sowie miteinander hatten – und das im US-Außenministerium angesiedelte Office of Foreign Relief and Rehabilitation Operations, das während des Kriegs gegründet und von dem New Yorker Gouverneur Herbert Lehman geleitet wurde. Als die Pläne voranschritten und die Sowjets sich nicht nur als vollwertige Partner neben den Amerikaner und Briten, sondern darüber hinaus auch als potenzielle Hilfsempfänger wiederfanden, pries einer ihrer Vertreter »das gegenseitige Verständnis und den Geist der Zusammenarbeit«, die die Gespräche gekennzeichnet hätten, und hoffte, dass es so weiterginge.
Anlässlich der Gründung der neuen Organisation im November 1943 begrüßte Präsident Roosevelt die Delegierten aus 44 Ländern im Weißen Haus, bevor sie sich zur ersten Sitzung der UNRRA in Atlantic City begaben. Nachdem man zuvor beschlossen hatte, eine Person aus den Reihen der Amerikaner an die Spitze zu wählen, begann die neue Organisation wie ein amerikanisches Unternehmen anzumuten. Gouverneur Lehman wurde schließlich zum ersten Generaldirektor der UNRRA erkoren, da er »Roosevelt nahestand und für das US-Militär, die Briten und die Russen akzeptabel« war. Er erhielt damit den Vorzug gegenüber energischeren Kandidaten wie dem New Yorker Bürgermeister Fiorello La Guardia und dem früheren Präsidenten Herbert Hoover, der nach dem Ersten Weltkrieg eine massive US-Hilfsaktion in Europa organisiert hatte. Ohne großen Widerspruch akzeptierte der wenig durchsetzungsstarke Lehman ein UNRRA-Budget in Höhe von 450 Millionen Pfund, was laut Schätzung eines Historikers »weniger als die Hälfte des tatsächlich Benötigten war«.5
Dass die USA die Organisation in finanzieller Hinsicht dominierten, prägte die Geschichte der UNRRA in mehrerlei Weise. Ihre Mitgliedstaaten sollten eigentlich ein Prozent ihres Nationaleinkommens zur Finanzierung beitragen, was eine sehr erhebliche Belastung darstellte, insbesondere für das Vereinigte Königreich, die damit 15 Prozent des gesamten Budgets hätten aufbringen müssten, hinter den USA mit 40 Prozent. Schließlich sollten die Vereinigten Staaten jedoch drei Viertel des Budgets beisteuern, gefolgt von Großbritannien und Kanada als größten Beitragenden. Die sowjetische Offerte war kläglich – nach offiziellen UNRRA-Angaben betrug sie nur 0,1 Prozent des Gesamtbudgets –, was angesichts der beträchtlichen Hilfe, die die Organisation nach dem Krieg in der Ukraine und Belarus leistete, die Verärgerung des Westens über die aus seiner Sicht typisch sowjetische Mischung aus Arroganz (einer Großmacht) und Selbstgerechtigkeit (eines großen Kriegsopfers) nur noch anheizte. Das einzige Angebot der Sowjets, das Stalin als Antwort auf La Guardias Anfrage an Moskau im August 1946 übermitteln ließ, traf nicht nur zu spät ein, sondern enthielt auch keine Angaben in Dollar.
Ein praktisches Problem mit der hauptsächlichen Finanzierung durch die USA bestand darin, dass sie jedes Jahr von einem misstrauischen und engstirnigen Kongress bewilligt werden musste, was immer wieder zu einem zähen Ringen wurde und oft Zweifel daran aufkommen ließ, ob die Organisation ihre Arbeit fortsetzen könnte. Die Unterstützenden der UNRRA – die vom Vatikan bis zum Abgeordneten Ed (»Boss«) Crump aus Tennessee reichten – leisteten jedes Mal energische Überzeugungsarbeit und behaupteten, die amerikanische Öffentlichkeit hinter sich zu haben, doch das schlechte Verhältnis zwischen dem US-Außenministerium und dem Kongress erwies sich als Dauerproblem. Kaum hatte die UNRRA ihre Nachkriegsoperationen aufgenommen, begann daher bereits die Diskussion darüber, wann die Organisation wieder aufgelöst wird (was nicht einmal zwei Jahre nach Kriegsende passieren sollte). Bei der fünften Sitzung des UNRRA-Rats im August 1946 erklärte (der im März 1946 zum Generaldirektor ernannte) Fiorello La Guardia zu Beginn seiner Rede, dass die Tätigkeiten der Organisation zwar notwendig blieben, sich ihre Arbeit aber verlangsamte, weil man »für 1947 keine Vorkehrungen für die UNRRA getroffen hat« – sprich: Der Kongress hatte ihr das Geld abgedreht. In den letzten sechs Monaten ihres Bestehens (von Januar bis Juni 1947) arbeitete sie im Grunde ohne Finanzierung.
Die Kritik an der Organisationsweise und Einstellungspolitik der UNRRA war unerbittlich. Sie bekam den Spitznamen »UNRRA the unready« (die Unvorbereitete), und Robert Jackson zufolge vollbrachte sie in ihren ersten 15 Monaten praktisch nichts, außer Leute, die wenig oder keine nützliche Arbeit leisteten, auf die Gehaltsliste zu setzen. Der Australier Sir Raphael Cilento, der sich im Nahen Osten für sie rekrutieren ließ, war entsetzt über »die zweifelhaften Fähigkeiten und die bisweilen völlige Unaufrichtigkeit vieler UNRRA-Mitarbeiter«. Ähnliche Kritik äußerte der Amerikaner Marvin Klemmé, besonders mit Blick auf ihr »kontinentales« (also weder britisches noch amerikanisches) Personal, das er als »Gauner und Schieber« bezeichnete, die »sich alles Mögliche unter den Nagel reißen wollten, auf welchem Weg auch immer«. Die UNRRA funktionierte dermaßen schlecht, dass Jackson im Frühjahr 1945 aus New York auf eine Notmission geschickt wurde, um »ein sinkendes Schiff« zu retten. Ohne ihre enge Verbindung zu den Vereinten Nationen hätte sie womöglich gar nicht überlebt. Denn die ursprünglich unabhängige Organisation war gerade erst in die neu gegründete UN eingegliedert worden, und es hätte kein gutes Bild abgegeben, wenn sie kurz vor deren feierlicher Eröffnungskonferenz in San Francisco zusammengebrochen wäre.6
Das Hauptquartier der international besetzten und in anderer Hinsicht international ausgerichteten UNRRA befand sich in Washington, während ein Regionalbüro in London (11 Portland Place) für die Einsätze in Europa, einschließlich der DP-Frage, zuständig war. Bevor Jackson es reformierte, wurde das Londoner Büro gemeinsam von einem britischen, einem amerikanischen und einem sowjetischen Beauftragten geleitet, die jeweils uneingeschränkte Befugnis hatten, die Anweisungen der anderen zu widerrufen. Jackson korrigierte diesen offensichtlichen Fehler, aber die unterschiedlichen administrativen Kulturen des leitenden Personals blieben dennoch ein Problem. Die UNRRA-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter kamen aus insgesamt 33 Ländern, die meisten von ihnen aus Amerika und Großbritannien. Ihre Arbeitssprache war Englisch. Die USA stellten nicht nur die meisten Gelder bereit, sondern betrauten auch verschiedene Washingtoner Behörden mit dem Großteil der Beschaffung.
Angesichts seines Sitzes in London überrascht es wohl nicht, dass das europäische Regionalbüro eine deutliche Prägung durch Großbritannien (einschließlich des Commonwealth) aufwies. Jackson, der das Büro 1945 im Auftrag von US-Gouverneur Lehman reorganisierte, war ein Australier, der im Krieg zur britischen Marine abgestellt worden war, und zählte damit wie der Australier Raphael Cilento und Kanadier Marshall MacDuffie zu denen, die sich bei Einsätzen im Nahen Osten in Kriegszeiten kennengelernt hatten. Generalleutnant Sir Frederick Morgan, der er als britischer Armeeoffizier in Indien und in beiden Weltkriegen gedient hatte, fungierte als Einsatzleiter im Europa-Büro der UNRRA und als stellvertretender Stabschef des Alliierten Oberkommandos. Ein militärischer Hintergrund war typisch für Briten, die für die UNRRA arbeiteten. Die Militärs waren die, »die wussten, was sie tun«, so Morgans Ansicht; gewöhnlich handelte es sich, so die womöglich voreingenommene Meinung des Australiers Cilento, um »mittlere Offiziere nahe dem Ruhestandsalter, die ihren militärischen Rang behielten« (die Arbeit für die UNRRA zählte als aktive Dienstzeit), aber für die es ansonsten »keine weitere Perspektive im Militär gab und fraglos auch keine im zivilen Leben«. Dem Amerikaner Klemmé zufolge war die UNRRA vor Ort in der britischen Besatzungszone praktisch ein Teil des Militärs. Sowohl Cilento als Klemmé waren verärgert darüber, dass die Briten darauf bestanden, ihre Uniformen und Rangabzeichen zu tragen und mit ihrem Dienstgrad angesprochen zu werden, und dass einige von ihnen deutsche Burgen beschlagnahmen ließen, um sie als Privatresidenzen zu nutzen.7
Das amerikanische UNRRA-Führungspersonal stand in der Regel den Demokraten nahe (der Partei von Präsident Roosevelt und Gouverneur Lehman); einige hatten zuvor auch in New-Deal-Programmen zur Armutsbekämpfung gearbeitet, die oft von einem radikalen Idealismus inspiriert waren, der vom Sozialismus nicht allzu weit entfernt schien. Wie der britische General Morgan beißend formulierte, war die UNRRA »ein Hort für all die arbeitslos gewordenen New Dealer aus den USA«. Einer von ihnen war etwa Myer Cohen, der Leiter der UNRRA-Abteilung Displaced Persons, der zuvor als stellvertretender Direktor im Regionalbüro San Francisco für die Wanderarbeiter-Camps der Farm Security Administration (FSA) zuständig gewesen war. Die Amerikaner hatten es zudem zu verantworten, dass die UNRRA das Wort »Rehabilitation« im Namen trug, das für viele (vor allem für Militärs) rätselhaft und unverständlich war, aber auch ein Schlüsselbegriff für diejenigen, die glaubten, dass die Organisation »nicht nur helfen, sondern wiederbeleben« müsse, indem sie, so wie bei der Erziehung von Kindern, Menschen dabei unterstützte, auf sich selbst aufzupassen. Roosevelt selbst hatte den Begriff in seiner Rede vom 9. November 1943 benutzt, um die Aufgaben der neu gegründeten Organisation zu beschreiben, nämlich »Nothilfe und Wiederaufbau für die Opfer der deutschen und japanischen Barbarei«. Die »während der Großen Depression ausgebildeten und zuvor bei US-Bundesbehörden beschäftigten« amerikanischen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter hätten »offensiv für ›aktive‹ Fürsorge statt ›passive‹ Wohltätigkeit geworben«. Dahinter stand die Annahme, dass in der modernen Welt Regierungen und nicht private Philanthropen die Verantwortung für das Wohl der Menschen übernehmen sollten.
Es waren vor allem die Amerikanerinnen und Amerikaner, die einen freiheitlichen internationalistischen Geist in die UNRRA trugen. Eine Rolle spielten dabei nicht zuletzt junge Frauen, die oft einen Hintergrund in der Sozialarbeit hatten und in großen Zahlen in die unteren Dienstebenen der Organisation strömten. Susan Petiss, eine junge Amerikanerin, die drei Jahre lang für die UNRRA mit DPs gearbeitet hatte, erinnerte sich an den »allgegenwärtigen Idealismus« unter ihren Kolleginnen: »Alle hofften, eine wahre Weltgemeinschaft mit neuen sozialen Systemen und internationalen Beziehungen verwirklicht zu sehen.« Dies stand in Einklang mit den Vereinten Nationen, mit denen die UNRRA eng verbunden war, was ihr Ethos und ihre Tätigkeiten betraf, auch wenn sie damit nicht unbedingt jenen in ihren Reihen zusagte, die aus dem Militär kamen. Die fünfte Sitzung des UNRRA-Rats war die erste internationale Versammlung der Nachkriegszeit, die im Palais des Nations in Genf stattfand, der einst erbaut worden war, um den Völkerbund zu beherbergen, und für den nun ein »neues Leben unter dem Banner der Vereinten Nationen« begann. Obwohl die meisten der amerikanischen Idealisten innerhalb der UNRRA keine Sozialisten waren, konnten sie in sozialistischen Modellen der Gesellschaftsorganisation, einschließlich der sowjetischen Variante, oft Positives erkennen. Besonders deutlich wurde das bei den Feldeinsätzen der UNRRA, aber es zeigte sich auch in den Abteilungen für Repatriierung, die sie in Deutschland und Österreich unterhielt.8
Als das Kalte-Kriegs-Denken allmählich an Boden gewann, setzte diese Organisationskultur die UNRRA natürlich Vorwürfen aus, eine prosowjetische Institution zu sein, die nachsichtig gegenüber dem Kommunismus sei. Tatsächlich hatten viele der altmodischen britischen Armeeoffiziere und amerikanischen Gegner des New Deal von Anfang an diese Position vertreten. Nachdem der Amerikaner Marvin Klemmé 1945 für die UNRRA zu arbeiten begann, notierte er, dass »einer der häufigsten Vorwürfe gegen die Organisation […], nämlich dass sie überbesetzt mit Kommunisten, Fremden [Ausländern] und Juden ist, […] zumindest teilweise gerechtfertigt« sei. Klemmé, »ein Schlauberger aus der Provinz« in Oregon mit einer Abneigung gegen Großstadt-Linke von der Ostküste, fand es nicht überraschend, dass das – »bekanntlich von Kommunisten und ihren Sympathisanten verseuchte« – Außenministerium jenen Schlag Mensch zur UNRRA schickte, für den »Sowjet-Russland immer recht und die Vereinigten Staaten immer unrecht haben«. Besonders verbreitet seien solche Ansichten bei ihrem »fremden, im Ausland geborenen« Personal oder, anders gesagt, bei der jüdischen Belegschaft. Alle seien sich stillschweigend darüber einig, dass es in der UNRRA zu viele Juden gebe, schrieb Klemmé. Aus diesem Grund werde die Organisation sowohl von den Briten als auch den Kanadiern beargwöhnt. Als General Frederick Morgan wegen antisemitischer Äußerungen in Schwierigkeiten kam, herrschte besondere Empörung darüber, dass der Nachfolger dieser herausragenden Persönlichkeit »ein amerikanischer Jude namens Myer Cohen« war, der, »wie ich glaube, den Rang eines Stabsoffiziers in der US Army hat«. Diese Schmach sei »etwas, worüber die die Briten lange, lange Zeit nicht hinwegkommen werden«.
Die entgegengesetzten Perspektiven der Idealisten in der UNRRA und die ihrer Verächter wie Klemmé ließen sich nicht miteinander versöhnen. Morgan selbst bezeichnete die von ihm einst geleitete Organisation später als »fürchterlich krummes Geschäft«, als eine »zufällige Ansammlung wortgewandter Taugenichtse, berufsmäßiger Weltverbesserer, Betrüger und Spinner«. Sogar Richter Simon Rifkind, der das US-Militär in Deutschland in jüdischen Angelegenheiten beriet, tat die UNRRA-Idealisten als einen »Haufen Sozialarbeiter« ab. Doch bei vielen, die für sie arbeiteten, entstand auch eine starke Bindung zu der Organisation. Vor dem Hintergrund der Auflösung der UNRRA im Jahr 1947, schrieb Kommandeur Jackson, er sei »untröstlich angesichts des Rückschlags für die praktische Anwendung des internationalen UN-Konzepts humanitärer Einsätze«. Er und viele andere hatten sich eine Nachkriegsordnung vorgestellt, in der der Gedanke des Internationalismus wachsen würde, während die USA und andere westliche Staaten weiterhin mit der Sowjetunion kooperierten. Als die UNRRA ihre Arbeit Mitte 1947 schließlich einstellte und durch die IRO ersetzt wurde, schien das jedoch immer unwahrscheinlicher. Zudem gerieten die Anhänger solcher Ideen – darunter auch eine Reihe ehemaliger UNRRA-Angestellter – innerhalb von nur wenigen Jahren in Gefahr, als Kommunisten an den Pranger gestellt zu werden.9
Erste Schritte
Das UNRRA-Mandat für Nothilfe und Wiederaufbau bezog sich primär auf die Länder, die von der Besatzung befreit worden waren und Kriegsschäden erlitten hatten, sowie die vor Ort lebenden Bevölkerungen. Ebenfalls unter das Mandat fiel die Betreuung von DPs, allerdings wurde das nicht als Hauptaufgabe gesehen. Der offizielle UNRRA-Historiker George Woodbridge – der selbst im Europa-Büro der Organisation und für das Lend-Lease-Programm der Truman-Administration arbeitete – äußerte seinen Frust darüber, dass die von ihm als zweitrangig betrachteten Fragen der Repatriierung und DP-Betreuung stark in den Vordergrund rückten und damit den Ruf der Organisation beschädigten:
»Kein anderes Thema nahm bei den fortlaufenden Sitzungen des Rats so viel Zeit in Anspruch und sorgte für so viel Streit wie diese beiden Fragen. Keine andere Aufgabe bekam so viel – gute und schlechte – Publicity wie die Antworten, die die Mitgliedstaaten der Organisation auf sie gaben. Keine andere Mission erforderte die Einstellung einer so großen Zahl von Mitarbeitern. Für keine andere Abteilung stand jedoch ein so kleiner Teil der Mittel der Organisation zur Verfügung. Keine andere Aufgabe wurde innerhalb der Organisation, von ihren Mitgliedsstaaten und von der Öffentlichkeit so missverstanden. In keinem anderen Bereich war die anfängliche organisatorische Kontrolle der Verwaltung so unzufriedenstellend.«
Die Schwierigkeiten hatten damit zu tun, dass sich die Repatriierung sehr früh als ein Problem herausstellte, schon lange bevor manche der erfolgreichsten UNRRA-Missionen wie die in der Ukraine und in Belarus anliefen. Innerhalb weniger Monate nach Kriegsende wurden zwei wesentliche Herausforderungen deutlich, die auch das Ansehen der Organisation betrafen: Die erste war die Tatsache, dass viele sowjetische DPs und andere Menschen aus Osteuropa nicht in ihre Herkunftsländer zurückkehren wollten. Die zweite war die besondere Notlage der jüdischen DPs, die aus den Konzentrationslagern befreit worden oder aus ihrem Kriegsversteck gekommen waren und die die Idee einer Rückkehr in die Länder, in denen sie früher gelebt hatten, partout ablehnten.
Die erzwungene Repatriierung sowjetischer Kriegsgefangener und Zwangsarbeiter war im Sommer 1945 unter Aufsicht der Alliierten erfolgt, noch bevor die UNRRA ihren wirklichen Auftritt hatte. Nach öffentlichem Aufschrei zogen sich die westlichen Alliierten aus der Zusammenarbeit bei der sowjetischen Repatriierung zurück (wie ich in Kapitel 2 schildere). An diesem Punkt mussten sich die Alliierten zu einer Frage positionieren, der sie zuvor wenig Beachtung geschenkt hatten, nämlich ob die Repatriierung eine individuelle Entscheidung darstellte; und die UNRRA musste ihre ursprüngliche Annahme überdenken, dass ihre Aufgabe darin bestehe, Displaced Persons lediglich temporären Schutz zu bieten, bis der Ablauf der Repatriierung organisiert wäre. Wie Woodbridge schrieb, hatte man ihre »tatsächlich Rolle – die Versorgung von Displaced Persons, die sich meist in feindlichem Gebiet befanden und entweder gar nicht oder nicht sofort zurückkehren wollten – nicht vorhergesehen«.
Für die Repatriierung von Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern war ursprünglich das Militär zuständig, zuerst das Alliierte Oberkommando unter General Eisenhower, dann (nach Auflösung des Oberkommandos im Juli 1945) die Militärverwaltungen in der britischen, amerikanischen und französischen Besatzungszone. In der Anfangsphase waren die DP-Lager oft wie gewöhnliche Kasernen organisiert, sodass ihre Insassen nicht beliebig kommen und gehen konnten. Nach Ansicht von General Patton, dem Leiter der 3. US-Armee in Bayern, »sollten die DPs wie Gefangene behandelt und hinter Stacheldraht untergebracht werden«, um sie vom Plündern und Brandschatzen abzuhalten.10
An der Mitwirkung einer Organisation wie der UNRRA gab es aufseiten des Militärs kein besonderes Interesse, da man es gewohnt war, mit dem Internationalen Roten Kreuz oder mit Hilfswerken wie denen der Quäker zusammenzuarbeiten, die bestimmten religiösen oder ethnischen Gruppen nahestanden. Nun wurden diese Organisationen jedoch in den Hintergrund gedrängt, denn sie durften nur unter direkter Aufsicht und mit offizieller Genehmigung durch die UNRRA aktiv werden (die einzige Ausnahme galt für das jüdische Joint Distribution Committee, JDC, welches später in diesem Kapitel behandelt wird). Viele im US-Militär und auch in der US-Bevölkerung glaubten, dass es besser sei, wenn die Verantwortung ausschließlich bei einer amerikanischen Organisation läge, so wie bei Herbert Hoovers Hilfsaktion in Europa nach dem Ersten Weltkrieg. Selbst innerhalb der UNRRA waren einige überzeugt, dass das britische und amerikanische Militär »mit weniger als der Hälfte von dem, was die UNRRA ausgab«, viel bessere Arbeit hätte leisten können.
Es vergingen Monate, bis Eisenhower die Existenz der UNRRA im November 1944 anerkannte, und es sollte noch ein knappes Jahr dauern, bis Oktober 1945, bis die amerikanische und die britische Militärverwaltung ohne sonderliche Begeisterung die Zuständigkeit für den täglichen Betrieb in den Lagern an die UNRRA übergaben – und selbst dann dauerte es noch weitere vier Monate, bis die Verwaltung in der US-Zone ein formales Abkommen darüber unterzeichnete. Die Aufteilung der Zuständigkeiten wurde so geregelt, dass die Militärverwaltungen die Gelder für die DP-Lager bereitstellten, für Schutz, Lebensmittel, Bekleidung, medizinische Güter und Transport sorgten sowie politische Überprüfungen durchführten, während die UNRRA die Lager verwaltete (die offiziell als »Assembly Centers« bezeichnet wurden, um unangenehme Assoziationen mit den Nazi-Konzentrationslagern zu vermeiden), ihre interne Verwaltung regelte, Gesundheitsversorgung und Freizeitangebote zur Verfügung stellte sowie berufliche Orientierungshilfe gab. Bei der Repatriierung hatte die UNRRA nur eine beratende Funktion, denn das Militär war zuständig für »exekutive Handlungen in Zusammenhang mit der Bewegung von Displaced Persons«, für die Bereitstellung von Beförderungsdiensten, Unterkünften und Versorgungsgütern sowie für die Rationierung (»Displaced Persons haben Priorität gegenüber der deutschen Bevölkerung«) – im Grunde übernahm das Militär die meisten Kosten außer der Bezahlung des UNRRA-Personals.11
An den Verhandlungen über diese Regelungen waren die Sowjets nicht beteiligt, denn für sie gab es kein DP-Problem: Wenn sich solche Personen in ihrer Zone aufhielten, wurde sie einfach in die Sowjetunion und osteuropäische Länder repatriiert; im Falle von Schwierigkeiten beförderte man sie in die amerikanische oder britische Zone und überantwortete sie den Alliierten. Die Sowjetunion bestand von Anfang an darauf, dass in westlichen Zonen befindliche potenzielle Repatrianten, »ungeachtet ihrer individuellen Wünsche […] getrennt und in spezielle Zentren gesteckt werden sollten, die von Offizieren aus der UdSSR betrieben werden«, und das Alliierte Oberkommando gab entsprechende Anweisungen. Dass eine internationale Organisation als Mittlerin im Umgang mit DPs fungierte, begrüßten die Sowjets nicht, da sie solche Angelegenheiten als Gegenstand »bilateraler Vereinbarung zwischen den zwei betreffenden Ländern – dem Herkunftsland und dem Zufluchtsland« – betrachtete.