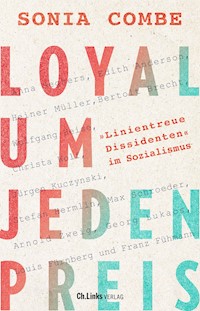
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
DDR-Intellektuelle zwischen Hoffnung und Enttäuschung
Anna Seghers, Bertolt Brecht, Stefan Heym, Jürgen Kuczynski, Paul Dessau, Max Schroeder und viele andere wurden wegen ihrer jüdischen Herkunft oder wegen ihrer kommunistischen
Überzeugung im »Dritten Reich« verfolgt und mussten Deutschland verlassen. Nach dem Exil in England, den USA oder Mexiko wählten sie die Sowjetische Besatzungszone bzw. die DDR als Heimat. Die Konflikte zwischen den Westremigranten und jenen, die aus Moskau in den Ostteil Deutschlands zurückkehrten, gehören zu den zentralen Problemen der DDR-Geschichte. Diesen Intellektuellen schlugen Misstrauen und Verdächtigungen entgegen. Dennoch stützten sie das System und stellten es zugleich infrage. Einzig innerhalb der Partei trugen sie ihre Kritik vor, in der Öffentlichkeit schwiegen sie. Mit dieser Praxis beeinflussten sie auch die Folgegeneration, als deren Repräsentantin Christa Wolf gelten kann. Sonia Combe zeichnet in ihrem Buch die Kämpfe und Gewissenskonflikte dieser kritischen Marxisten nach und fragt, welchen Preis sie für ihre Loyalität zahlten.
»Sonia Combes Buch ist ein Argument gegen eine Historiographie, die die Geschichte der realsozialistischen Gesellschaften auf eine einfache Diktaturgeschichte reduziert. Es leuchtet ein Jahrhundert gelebter Utopien aus, und dies mit ihren Herausforderungen, Widersprüchen und ihrem Scheitern.« Dorothee Röseberg
»Seit Wolfgang Schivelbuschs ›Vor dem Vorhang‹ und Werner Mittenzweis ›Die Intellektuellen‹ und ›Zwielicht‹ hat Sonia Combe den umfassendsten Beitrag zur Intellektuellengeschichte der DDR geschrieben.« The Times Literary Supplement (TLS)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sonia Combe
Loyal um jeden Preis
Georg Lukács empfängt Anna Seghers, die mit der tschechoslowakischen Fluggesellschaft angekommen ist, auf dem Flughafen Budapest, Februar 1952.© MIT / MTVA Foto, Budapest, Foto: Tamàs Munk
Sonia Combe
Loyal um jeden Preis
»Linientreue Dissidenten« im Sozialismus
Aus dem Französischen und mit einem Nachwort von Dorothee Röseberg
Dieses Buch erscheint im Rahmen des Förderprogramms des französischen Außenministeriums, vertreten durch die Kulturabteilung der französischen Botschaft in Berlin.
Die Originalausgabe erschien im September 2019 unter dem Titel »La loyauté à tout prix. Les floués du ›socialisme réel‹« in der Reihe »Clair & Net«, herausgegeben von Antoine Spire, im Verlag Le Bord de L’eau éditions, Lormont (Frankreich).
Die Übersetzung wurde unterstützt durch die Leibniz-Sozietät der Wissenschaften zu Berlin e. V.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Ch. Links Verlag ist eine Markeder Aufbau Verlage GmbH & Co. KG
© Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 2022
entspricht der 1. Druckauflage von 2022
www.christoph-links-verlag.de
Prinzenstraße 85, 10969 Berlin
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
ISBN 978-3-96289-141-1
eISBN 978-3-86284-518-7
Inhalt
Vorwort
PROLOG: »Ein Traum, von Dummköpfen zerstört«
Der Preis der Loyalität
TEIL I: Die Hoffnung
Die Rückkehr
Die »communazis«
Die Racheengel
»Berlin, eine Radierung Churchills nach einer Idee Hitlers«
»Hier im Volk der kalten Herzen«
Rückkehr aus dem Gulag
Nicht dorthin gehen, wo die Gehlen und Globkes sind!
Eine »schnelle und konsequente« Entnazifizierung im Osten
Im Westen eine Entnazifizierung an der Oberfläche
Eine lohnende Kulturpolitik
Die Sprache, in der man zählt und schwört
Deutsch – die Sprache des Feindes in Palästina
(Nicht nur) Symbolische Stimuli und Genugtuungen
TEIL II: Die Entzauberung
Die Ethik des Schweigens
»Ich hatte Glück«
Antisemitismus – von der Sowjetunion angeregt
Moskauer Prozesse in Ost-Berlin
»Streitet, doch tut es hier …«
Der 17. Juni 1953, das »Kronstadt« der SED
Der Versuch, Georg Lukács zu »entführen«
»Es ist euch also gelungen, unsere Idee ganz zu verhunzen«
Heiner Müller, der »Beckett des Ostens«
Schweigen und Stellungnahmen
Der Sechstagekrieg in Ost-Berlin
Die Affären Solschenizyn und Biermann
Stephan Hermlin, der »kommunistische Ästhet«
»Subpolitische« Gesten
TEIL III: Die Erben
Die Übergangsgeneration
»Mein sozialistischer Staat«
Lukács und Brecht, die Götter meiner Jugend
Lukács in der DDR
Der »DDR-Voltaire«
Den Traum der Väter retten
»Stummsein ist meine Verdammnis«
Ravensbrück ist nicht Sibirien
»Meine fabelhafte Familie«
TEIL IV: Jürgen Kuczynski – ein exemplarischer Weg
Tagebuch schreiben, um zu widerstehen
Die Dreckskerle des wütenden Kleinbürgertums
»Antisemitismus wie immer«
»Mittelmaß, überall Mittelmaß«
Der »Ghostdenker«
»Der kritischste Gegner innerhalb der Partei«
Die Parteiführer gehen, die Partei bleibt
TEIL V: Die DDR und die letzten Tage der deutsch-jüdischen Symbiose
Die jüdische Frage – ein Tabu?
Parias, Parvenus und nichtjüdische Juden
Jüdische Bürger deutschen Glaubens?
Selbsthass – ein Gemeinplatz
FAZIT: »Theaterperformance«
EPILOG: Im Schatten von Fichte, Hegel und Brecht
Nachwort der Übersetzerin
Anhang
Anmerkungen
Archivquellen
Personenregister
Dank
Die Autorin
Die Übersetzerin
»Beide waren Marxisten, Sozialisten, Antifaschisten, Materialisten, Atheisten.
Kritische Marxisten natürlich, keine dummen SED-Tölpel, sondern skeptisch und witzig.
Aber Mitglied der Partei, der SED. Beide.«
Barbara Honigmann1
»Ich nehme zur Kenntnis, daß ich einer Generation angehöre, deren Hoffnungen zusammengebrochen sind.«
Stephan Hermlin2
Vorwort
In den 1980er Jahren traf ich im Rahmen von Interviews zur Erinnerung an den Nationalsozialismus in der ostdeutschen Gesellschaft Persönlichkeiten, die nach Deutschland zurückgekehrt waren, um dort einen sozialistischen Staat aufzubauen. Sie berichteten mir von erlebter Entzauberung, aber auch davon, wie sie trotz allem ihre Überzeugungen bewahrten. Diese meist sehr kritischen Marxisten hatten damals ihre Hoffnungen noch nicht verloren; so wie auch die Folgegeneration der Schriftsteller, Künstler und Dissidenten, denen sie auf die eine oder andere Art ihre Ideen weitergeben konnten.
Es war nicht schwer, solche Menschen zu treffen. Viele von ihnen waren jüdischer Herkunft, sie bildeten eine Schicksalsgemeinschaft als Paria des Nationalsozialismus, sie gehörten zu den Verfolgten des »Dritten Reiches« und zu jenen, die es bekämpft hatten. Da sie meistens im gleichen Viertel wohnten, endete ein Gespräch selten ohne Hinweis auf eine weitere Adresse. Die Diskussionen mit ihnen waren sehr viel freier, als ich es mir vorgestellt hatte. Später erstaunte mich, wie vorsichtig meine Fragen formuliert waren und wie direkt mir meine Gesprächspartner geantwortet hatten. Gewiss, wir trafen uns im letzten Jahrzehnt der DDR. Wie Christoph Hein sich erinnerte: Damals war es schon lange her, dass man für seine Meinung ins Gefängnis gekommen war. Aus diesem Grund hielt er es übrigens auch für einen Fehler des Regisseurs des Films Das Leben der Anderen, die erzählte Geschichte in die Zeit kurz vor dem Mauerfall zu verlegen.
Im November 1989, als Kanzler Kohl den Prozess der Wiedervereinigung vorantrieb, fand man die Namen vieler Persönlichkeiten unter einem Aufruf, dessen Wortführerin die Schriftstellerin Christa Wolf war: »Für unser Land«. Es handelte sich um einen Appell für den Erhalt eines unabhängigen, den sozialistischen Werten treuen Ostdeutschlands, der DDR. Eine Utopie also, wie man seither denkt. Vielleicht. Ein Historiker ist kein Schriftsteller, und er übt sich nicht in der Praxis des Kontrafaktischen. Aber er kann sich eine andere Geschichte vorstellen als diejenige, die er nachzuzeichnen hat. Und er hat es in der Hand, eine Erinnerung zu beleben, die in der postkommunistischen Geschichtsschreibung wenig präsent ist.
Die Idee, eines Tages die Geschichte dieser Generation und ihrer biologischen wie auch geistigen Nachkommen zu erzählen, die durch die Geschichte desillusioniert worden sind, diese Idee hat mich nie verlassen. Es geht nicht um die Geschichte der mittelmäßigen und gefürchteten Apparatschiks, auch nicht um diejenigen, die aus Konformismus, Gefolgschaft oder Opportunismus Parteimitglieder waren. Es geht vielmehr um die Geschichte derer, die geschwiegen haben, aber nicht etwa aus Angst oder Feigheit, sondern weil sie ihrem Ideal treu geblieben sind. Von dieser Loyalität um jeden Preis soll in diesem Buch erzählt werden.
PROLOG: »Ein Traum, von Dummköpfen zerstört«
New York, 1945. Edith Anderson, eine politisch linksorientierte junge Amerikanerin, heiratet einen deutschen Emigranten, mit dem sie schon seit mehreren Jahren zusammenlebt. Es ist Max Schroeder, ein Schriftsteller, der während der Weimarer Republik durch die Umstände getrieben in die Kommunistische Partei eingetreten ist und dem man ein Leben als Bohémien nachsagt. Er flieht vor dem Nationalsozialismus und landet in den Vereinigten Staaten, die er Ende des Krieges verlässt. Er kehrt nach Deutschland zurück – Edith Anderson geht mit ihm –, um dort den Sozialismus aufzubauen, einen Sozialismus, der ihn zunehmend enttäuschen wird.
Edith Anderson kennt die Haltung ihres Mannes sehr gut, sodass sie später ein Zeugnis von den ersten Jahren des ostdeutschen Staates ablegen kann. Sie spricht von einem Traum, der von Dummköpfen zerstört worden sei. Obwohl sie gute Gründe hatte, Walter Ulbricht nicht zu mögen, ist ihr Buch keine Anklage gegen das Deutschland von Walter Ulbricht, Stalins Mann, der im Schutz der Roten Armee aus der Sowjetunion zurückgekehrt ist, um die Führung in dem politischen Gebilde zu übernehmen, das später die DDR werden wird. Aber die Stärke ihrer Erzählung liegt gerade in der Rekonstruktion des Kontextes, des Kalten Krieges, und jener Überzeugungen, die es ermöglichen zu verstehen, warum Männer und Frauen wie ihr Ehemann, der spätere Cheflektor des Aufbau-Verlages Max Schroeder, der Dramatiker Bertolt Brecht, die Schriftstellerin Anna Seghers und viele andere den Entschluss fassten, nach Deutschland zurückzukehren.
Warum wählten sie den Ostteil, der von den Sowjets besetzt war, und warum verließen sie ihn nicht? Warum blieben sie selbst dann, als ihre Hoffnungen nach und nach zerstört worden waren, auch wenn es bedeutete, ihre Seele und ihre Gesundheit zu opfern?
Max Schroeder heiratete Edith Anderson, nachdem seine erste deutsche Lebensgefährtin, ebenfalls Exilantin, die in einem anderen Land Zuflucht fand, drei Jahre lang nicht auf seine Briefe geantwortet hatte. Als er Ende des Krieges vom FBI einbestellt wurde, um über seine kommunistischen Aktivitäten Auskunft zu geben, entdeckte er auf dem Schreibtisch des Offiziers, für ihn absichtlich erkennbar gemacht, die nie erhaltenen Briefe seiner ersten Partnerin. Die Praxis des Abfangens von Briefen war bei den Geheimdiensten verbreitet, um die Moral jener zu untergraben, die man für gefährlich hielt.
Noch in Amerika bekam Edith Anderson einen Vorgeschmack darauf, was sie in Berlin erwarten würde. Die »Freunde« ihres Mannes nahmen sie alles andere als herzlich auf. Sie erinnert sich an ein Abendessen mit Albert Norden, dem zukünftigen Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees (ZK) der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), und Gerhart Eisler, dem späteren Vorsitzenden des Staatlichen Rundfunkkomitees der DDR, Bruder von Hanns Eisler, der auch aus dem Exil in den USA zurückgekehrt war. Norden verschwendete keine Zeit damit, ein Gespräch mit der Frau des Genossen zu führen. Gerhart Eisler hingegen fragte diese ohne Umschweife, ob sie regelmäßig zum Zahnarzt gehe. »Als ich zögerte, ermahnte er mich, daß ein Kommunist regelmäßig zur Zahnuntersuchung gehen sollte um sicherzustellen, daß er in Kampfform war.« (Er lächelte, aber er scherzte nicht, so im englischsprachigen Original.)1
Schroeder gelang es schnell, Berlin zu erreichen, während Edith Anderson mehr als ein Jahr brauchte. Sie wurde in Paris aufgehalten, wo sie das Einverständnis der amerikanischen Besatzungsmacht benötigte, um nach Berlin zu gelangen. Dieses Schicksal teilte sie mit anderen Exilanten, die nach Deutschland zurückkehren wollten. Die westlichen Verbündeten, die sich mit den Sowjets die Kontrolle über die ehemalige Hauptstadt des »Dritten Reiches« teilten, versuchten eine Rückkehr nach Deutschland zu verhindern, besonders wenn es sich um Kommunisten handelte. In diesem Vorhaben wurden sie von der einheimischen Bürokratie unterstützt. Edith Anderson schreibt: »Die Macht der deutschen Beamten, zu verhindern um der Verhinderung willen, war monströs, wenn man bedenkt, daß sie angeblich besiegt waren. […] Die Gegenwart einer sorglosen Ausländerin mit halbwegs anständigem Gepäck, falls sie überhaupt davon Notiz nahmen, verursachte ihnen wahrscheinlich ein noch mieseres Gefühl. Sie wußten, daß die Welt sie verabscheute, das stand auf ihren Gesichtern geschrieben, und sie wollten davon nichts mehr hören. Nur das über sie gefällte kollektive Urteil schien unmerklich in ihren Schädeln zu hämmern: weiterleben. Ihr habt es nicht anders gewollt, dachte ich.«2
In Berlin angekommen, fand sie einen völlig erschöpften Mann vor. Er hatte Tag und Nacht gearbeitet – für das große neue Verlagshaus der DDR, den Aufbau-Verlag. Ermüdend waren auch die Kongresse, Konferenzen und Versammlungen, die sie als »sadomasochistische Rituale« bezeichnete. Sie fanden in Räumen statt, in denen es weder Fenster noch Ventilatoren gab, wo die disziplinierten Genossen stundenlang anhörten, was die anderen zu sagen hatten, obwohl sie schon alle Inhalte kannten.
Zum Schicksal der Remigranten gehörten Armut und die Akzeptanz des Mangels. Doch diejenigen, die sich entschieden hatten, in diesen Teil Deutschlands – »o Deutschland, bleiche Mutter« dichtete Brecht 1933 – zurückzukehren, um ihn wiederaufzubauen, wurden von dem starken Wunsch getrieben, einander wiederzufinden und sich nach Exil und harten Prüfungen zu vergewissern, wer wie überlebt hatte. Nicht allen Exilanten war dies gelungen, insbesondere denjenigen nicht, die die Sowjetunion als Exilland gewählt hatten. Edith Anderson erfuhr von ihrem Ehemann ein Geheimnis über die deutschen Kommunisten, die nach »Missverständnissen« in der UdSSR verschwunden waren. Über dieses Thema herrschte Schweigen, und in der Folge zeigte sich, dass das Schweigen die Regel in jeder Hinsicht war.
Eine Person schien über jeden Verdacht erhaben zu sein: die Schriftstellerin Anna Seghers. Man verzieh ihr sogar Transit, diese schöne Geschichte über das Warten auf ein Boot mit Antifaschisten und deutschen Juden in Marseille im Jahr 1940, um aus dem besetzten Frankreich zu fliehen. Es ist nicht wirklich ein militantes Buch.3 Man präsentierte die Schriftstellerin öffentlich, animierte sie, Fabriken und Schulen zu besuchen, die ihren Namen trugen; man holte sie von ihrem Schreibtisch, um im In- und Ausland Vorträge zu halten. Sie wagte es nicht abzulehnen.
Edith Anderson beschreibt die Hauptakteure der frühen DDR-Kulturszene und skizziert typische Charaktere unter den Höflingen des Regimes. So beispielsweise Klaus Gysi, ein geborener Diplomat, der immer wieder höchste Positionen erreichte, mehrmals in Ungnade fiel, sich wieder fing, sich von Freunden lossagte, die ihn behinderten, der nur noch ein Schatten seiner selbst war und sich wie ein Boxer verhielt, der sich nicht geschlagen gibt, sondern erneut zum Angriff übergeht … Klaus Gysi wird den Fall der Mauer überleben, und sein Sohn Gregor wird versuchen, die Sozialistische Einheitspartei zu retten.
Als Edith Anderson am 17. Juni 1953 ihre Einkäufe erledigte, sah sie, dass etwas nicht stimmte: Die Geschäfte waren leer. Während die Arbeiter auf der Stalinallee in Ost-Berlin die Abschaffung der gerade beschlossenen Erhöhung ihrer Arbeitsnormen und den Rücktritt der Regierung forderten, hörte sie, wie vom Westen entsandte Agitatoren riefen: Erhängt sie! In ihr Tagebuch notierte sie: Die Remigranten kritisieren zwar die Regierung, bleiben aber trotzdem auf deren Seite. Es gibt keine Übereinstimmung, vielmehr herrscht Besorgnis.
Edith Anderson hielt noch andere »Schlachten« fest, beispielsweise die gegen den »Formalismus«. 1951 wurde der Proletkult, die sogenannte proletarische Kultur, plötzlich verboten, die einst in Moskau verordnet und in Deutschland während der Weimarer Republik geschätzt worden war. Horst Strempels Wandbilder fielen der Verurteilung anheim. Er ging in den Westen, wo er als Kommunist keinen Flüchtlingsstatus beanspruchen konnte. Er sollte sein Leben als ein von beiden Seiten der Stadt Ausgestoßener beenden. Der demokratische Westen hatte eine öffentliche Verurteilung des Sozialismus generell zur Bedingung für die Aufnahme gemacht. In gewisser Weise war das ein Pendant zu der in den kommunistischen Parteien üblichen Praxis der Selbstkritik.
Ein Jahr später wurde Hanns Eisler an den Pranger gestellt. Der Komponist hatte das Libretto eines Faust konzipiert, das bei den obersten Stellen als beispiellose Unverschämtheit Empörung auslöste. Es war, schreibt Edith Anderson, als hätte Eisler »auf das Nationaldenkmal Faust gepißt«. Das Stück spielt zur Zeit des Bauernkrieges. Es geht um das Scheitern und das berühmte »deutsche Elend« (Heinrich Heine), darum, dass Deutschland Revolutionen nicht wirklich, sondern nur theoretisch zu Ende führen kann. Diese Idee missfiel dem Parteivorsitzenden Walter Ulbricht ungemein. Prompt folgte der Beschluss, wonach es sich um ein antifaustisches Libretto handelte, das unpatriotisch und für Arbeiter völlig unverständlich sei.
Man erkennt in dem Stück auch eine Anspielung auf die Monotonie des Lebens in der DDR. Eislers Faust beklagt sich über die Langeweile, die sich über das humanistische Deutschland gelegt hat, im Gegensatz zu einer alten »unmoralischen« Stadt namens Atlanta, warum wohl? »Zurückgekehrt – leider zurückgekehrt, find ich die Heimat wieder grau und kalt […] Wie hab ich sie gern verlassen! Nun hält sie wieder in den Klauen mich. Was soll ich hier?«4 Hat Eisler Nostalgie für das korrupte Hollywood empfunden? Brecht versuchte mit Unterstützung des zukünftigen Kulturministers Johannes R. Becher, die Hysterie zu beruhigen. Becher erinnert sich, dass der Komponist – Eisler war Jude – in gewisser Weise legitimiert sei, Zweifel an der »unvergleichlichen deutschen Kultur« zu äußern. »Wie kommt es […], daß diese herrliche, strahlende, ›einmalige‹ Kulturnation es nie zu einer Revolution gebracht hat und zweitens einen Hitler an die Macht kommen ließ […]?«5 Als gebrochener Mensch schaffte Eisler es nicht, die Musik für seinen Faust fertigzustellen.
Nachdem ihr Mann eine Kröte nach der anderen schlucken musste und erkrankte, schickte Edith Anderson regelmäßig Protestbriefe an das Zentralorgan der SED Neues Deutschland, die niemals veröffentlicht worden sind. Eine Antwort erhielt sie ebenfalls nicht.
Anderson verfiel des Öfteren in Nostalgie: »Ich vermißte die jüdischen Gesichter, die mir New York so heimisch machten. Ich vermißte die schwarzen, braunen, die latein-amerikanischen und anderen fremden Gesichter, die mir immer in der U-Bahn begegneten, Gesichter hart arbeitender Menschen, die trotz Erschöpfung niemals achtlos andere Menschen anrempelten im Gegensatz zu den gleichgültigen Deutschen, sondern mit instinktiver Leichtigkeit hinein- und wieder hinausschlüpften aus dem Gedränge unter dem Times Square zwischen der Bronx-Brooklyn-Linie und dem Vorortzug.«6
Als Max Schroeder 1958 starb, beschloss sie, mit ihrer elfjährigen Tochter Cornelia ihre Familie in den USA zu besuchen. Das amerikanische Konsulat verweigerte der Kommunistin jedoch die Einreise, weil sie nicht zu einem Schuldbekenntnis bereit war. Nur dank ihrer Familie vermochte sie das Problem zu lösen. Edith blieb nicht lange in New York. Es stellte sich heraus, dass sie sich nicht wieder an das amerikanische Leben gewöhnen konnte. Sie kehrte deshalb nach Berlin zurück. Hier arbeitete sie abwechselnd als Journalistin, Übersetzerin und initiierte mehrere anspruchsvolle Editionsprojekte.
Nach einem quasi Galilei’schen inneren Exil starb Bertolt Brecht im August 1956 im Alter von 58 Jahren an einem Herzanfall. Der erste Kulturminister der DDR, der Dichter Johannes R. Becher, folgte ihm zwei Jahre später mit der gleichen Diagnose im Alter von 67 Jahren. Hanns Eisler, der Komponist der Begleitmusik von Brechts Stücken, der auch die Filmmusik zu Nuit et brouillard (Nacht und Nebel) von Alain Resnais geschrieben hatte, starb 1962 im Alter von 64 Jahren. Bis zum Ende seines Lebens war er dem Regime treu geblieben, so wie auch die Schriftstellerin Anna Seghers, die 1983 in Berlin im Alter von 82 Jahren verstarb.
Der Preis der Loyalität
Warum sollen wir uns heute für Menschen interessieren, die einer Partei treu geblieben sind, die voll gegen die Wand lief? Hat die Geschichte nicht entschieden? Im besten Fall hält man diese Menschen für naiv; ein Achselzucken reicht, um sie zu verurteilen, oder man rechnet sie jenen zu, unter denen sie gelitten haben. Alles in allem stellt sich die Frage: Waren sie Komplizen des Regimes?
Wenn ihr Traum durch »Dummköpfe« zerstört wurde, wie Edith Anderson sagte, mussten sie sich nicht ebenso dazurechnen? Das Urteil hat in jedem Fall dazu beigetragen, dass sie schnell auf die Müllhalde der Geschichte befördert worden sind.
»Es gibt Schlimmeres als den Kommunismus, nämlich das, was danach folgt.«7 So der bulgarische Regisseur Angel Wagenstein. Er wurde 1922 in Plowdiw geboren, von bulgarischen Faschisten zum Tode verurteilt, weil er als Partisan im Widerstand gekämpft hatte, war Mitglied der kommunistischen Partei, aus der er zweimal ausgeschlossen und in die er auf eigenen Wunsch, verbunden mit einem langen Kampf, wieder aufgenommen wurde. Kulturfunktionäre kritisierten seine Filme stetig, weshalb er das Schicksal kritischer Geister erlitt, die durch ein politisches System gebrochen wurden, dessen Ziel sie teilten, dessen Stil und Methoden sie jedoch nicht unterstützen konnten.8 Wenn sie es wagten, das Wort zu ergreifen, dann nur innerhalb der Partei, einer Partei, die für sie eng mit dem Ziel verbunden war, dem sie bereit waren zu dienen. Vor allem wollten sie ihr nicht schaden, denn damit hätten sie dem Feind einen Dienst erwiesen.
Die vollkommenste Figur dieser Haltung wurde wahrscheinlich von Wassili Grossman in der Novelle In Kislovodsk nachgezeichnet. Gladetsky lobt Savva Feofilovitch, einen alten Vertreter der Bolschewiki und Freund Lenins, für seinen Mut, Bucharin »im Namen der Revolution« anzuzeigen, obwohl er (Savva F.) wusste, dass dieser unschuldig war, und er (Gladetsky) hinzufügte: »Das weiß ich aus eigener Erfahrung.« Diese Passage fiel der Zensur anheim.9 Grossman war ein desillusionierter Kommunist, der in den 1950er Jahren Leben und Schicksal verfasst hatte, bevor Solschenizyn Der Archipel Gulag schrieb. Doch das Buch wurde erst zwanzig Jahre später im Westen erstmals veröffentlicht. Grossman sprach in Kenntnis der Dinge; er war dem Stalinschen Terror entgangen, der Zensur jedoch nicht.
Die Zeiten änderten sich. In der Regel waren die Protagonisten, von denen wir hier berichten, nicht derart extremen Situationen ausgesetzt. Die Tragödie, die sich in der Sowjetunion abspielte, hatte ganz andere Dimensionen. Mit einigen Ausnahmen waren unsere Protagonisten »nur« dazu veranlasst worden zu schweigen.
Diese Art von »internen« Gegnern findet man in allen Gesellschaften, die das Experiment des Sozialismus unternommen haben. Solche Gegner gab es natürlich auch innerhalb der kommunistischen Parteien in nichtsozialistischen Ländern, allerdings unter völlig anderen Umständen und mit unterschiedlichem Ausgang. Hierzu gibt es bereits zahlreiche Untersuchungen.10 Im Osten ist der Philosoph Georg Lukács11 wohl eine der bekanntesten Figuren. Sein Denkmal im Budapester Szent-István-Park wurde im März 2017 auf Antrag der rechtsradikalen Jobbik-Partei – im Ungarn unter Viktor Orbán – demontiert. Der Grund: Lukàcs’ marxistisches Engagement. Nachdem Lukács am Aufstand 1956 teilgenommen hatte, wurde er, der Autor von Geschichte und Klassenbewusstsein, aus der Partei ausgeschlossen. Zehn Jahre lang unternahm er alles Mögliche, um wieder in die Partei aufgenommen zu werden. Das hinderte ihn jedoch nicht daran, seine Kritik unter den ungarischen Dissidenten zu verbreiten. Die Philosophin Ágnes Heller, führender Kopf der Budapester Schule, war deren Repräsentantin. Lukács ging indes niemals von seiner Überzeugung ab, dass die schlimmste Form des Sozialismus immer noch dem besten Kapitalismus überlegen sei.12 Sein Briefwechsel mit dem Polen Adam Schaff, ebenfalls Philosoph und Jude, aus den Jahren 1963 bis 1969 belegt bei allen Unterschieden ihrer Einschätzungen zur Stalin-Periode die gleichen Vorbehalte gegenüber einer radikalen Verurteilung der sowjetischen Erfahrungen.13 Im August 1968 verurteilte Lukács in einem Schreiben an den ungarischen Staatschef János Kádár und an das Zentralkomitee der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei den Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes in Prag. Seine Schüler demonstrierten offen dagegen. Viele von ihnen verließen später das Land. Wahrscheinlich hinderte Lukács sein Alter an derartigen Protestformen.
Adam Schaff zeigte ein ähnliches Verhalten. Er schrieb Lukács am 12. Dezember 1968, während der polnische Staat seine heftigste antisemitische Zeit hatte: »Persönlich tue ich alles, um auch diese Periode zu überleben. In den letzten sechs Monaten arbeite ich, um nicht verrückt zu werden, fleißig an einem neuen Buch ›Geschichte und Wahrheit‹. […] Die marxistische Philosophie in Polen liegt in Trümmern. Die besten Leute sind entweder völligst zur Stille gebracht oder emigrieren.«14 Adam Schaff vermied die Emigration, die man als Zeichen des Nichteinvernehmens hätte interpretieren können. Er wurde aus der Partei ausgeschlossen, nachdem Staats- und Parteichef Wojciech Jaruzelski im Dezember 1981 durch einen Staatsstreich an die Macht gekommen war. Jedoch gelang es ihm, rehabilitiert und wieder in die Partei aufgenommen zu werden. Im Jahr 2006 starb er in Warschau.
Man könnte auch andere Beispiele für jene Loyalität nennen, aber nach 1956 schwächte sich in Polen und Ungarn und nach 1968 auch in der Tschechoslowakei die Hoffnung auf eine Reform der Partei in den Staaten sowjetischen Typs immer mehr ab. Die Gegnerschaft, die sich in der Solidarność-Bewegung in Polen oder in der Charta 77 in der Tschechoslowakei zeigte, kam aus dem Untergrund. In der UdSSR erschienen selbst verlegte Zeitschriften (Samisdat). Wenn es möglich war, verließen die Dissidenten das Land. Nimmt man Albert O. Hirschmans Typologie der Verhaltensoptionen Exit, Voice,and Loyalty auf,15 so ergriffen sie zunächst das Wort und wählten dann das Exil. In dem Moment, wo es keine Hoffnung mehr auf eine Reform der Partei gab, hatte Loyalität keinen Sinn mehr.16
Aber genau dies trifft für die DDR nicht zu. In der ostdeutschen Gesellschaft gab es gewiss Gegner, oftmals flüchteten sie gezwungenermaßen. Aber mit Ausnahme des letzten Jahrzehnts gab es hier keine organisierte Opposition. So kam es, dass Mitglieder der SED zum ersten Mal am 4. November 1989 an der Seite von Regimegegnern auf dem Alexanderplatz demonstrierten, deren Namen sie noch einige Wochen zuvor ignoriert hatten.
Gemeinsam forderten sie Reformen. Fünf Tage später wurde die Mauer geöffnet. Die Opposition innerhalb der Partei war größer geworden und zählte vor allem Intellektuelle, Dramatiker, Schriftsteller, Filmemacher und Wissenschaftler in ihren Reihen. In den 1950er Jahren konnte der Ausdruck einer Nichtübereinstimmung mit der Parteimeinung als Verrat eingestuft und mit Gefängnis bestraft werden. Später nahm die Unterdrückung ab, allerdings zugunsten einer sich immer weiter ausbreitenden Überwachung durch die Stasi.17 Kritik war nun innerhalb der Partei und in anderen ihr nahestehenden Organisationen in Grenzen erlaubt, solange außerhalb die Regel des Schweigens akzeptiert blieb. Allerdings wurden die Grenzen immer wieder verschoben, was mitunter auch größere Handlungsspielräume eröffnete. Darin unterschied sich das Herrschaftssystem der DDR zum Beispiel von dem in Rumänien und in Albanien, wo der Personenkult und das System der persönlichen Macht mit Nicolae Ceaușescu und Enver Hoxha Formen annahmen, die es in der DDR niemals gab.
Diejenigen, die das Schweigen brachen und ihre Kritik im Westen verbreiteten, wie es der Physiker Robert Havemann und der Philosoph Rudolf Bahro taten, wurden ipso facto aus der Partei ausgeschlossen. Havemann erlebte den Ausschluss aus der Partei und der Akademie der Wissenschaften, Berufsverbot und Hausarrest.18 Beide blieben Marxisten. Dennoch gehören sie zu einer anderen Kategorie als diejenigen Frauen und Männer, die die Partei von innen her reformieren wollten, die für die Loyalität optierten und in der Konsequenz das Schweigen wählten. Ein Verleger gab der Autobiographie des Wirtschaftswissenschaftlers Jürgen Kuczynski, der ein solcher kritischer Geist innerhalb der Partei war, den vielsagenden Titel Ein linientreuer Dissident.19
Das Attribut Dissident mag Historiker stören, die es eher mit jenen identifizieren, die offen und öffentlich ihre Kritik kundtaten und dafür einen hohen Preis bezahlten. Die Bezeichnung Dissident ist einem Soziologen möglicherweise zu literarisch, und es stimmt einfach, dass Kuczynski unter den Umständen und den Bedingungen, die Gegenstand dieses Buches sind, eher treu denn Dissident war.20 Gleichwohl dient dieses Oxymoron der Analyse genau der Widersprüchlichkeit, die es enthält. Es verweist auf die Spannung, die durch die Nichtübereinstimmung von Überzeugung und Verhalten entsteht. Der amerikanische Psychosoziologe Leon Festinger bezeichnete das Resultat einer derartigen Nichtübereinstimmung als »kognitive Dis-sonanz«,21 die letztlich die Handlung blockiere.
Wenn man auf charakteristische gemeinsame Merkmale von Georg Lukács und Jürgen Kuczynski blickt, zeichnet sich ein Idealtyp ab: Es handelt sich um Kommunisten, die Mitglieder der Partei sind oder ihr nahestehen, die sich durch Autonomie des Denkens auszeichnen. Finanzielle Einnahmen, zum Beispiel aus Autorenrechten oder Lehr- oder Forschungstätigkeit, machen sie von der Partei materiell unabhängig. Ihre Loyalität gründet auf intellektuellen Überzeugungen, die nicht mit Glauben gleichzusetzen sind. Und schließlich – und das ist nicht das Unwichtigste – formulieren sie niemals ihre Kritik außerhalb der Partei und der ihr verbundenen Organisationen. Obwohl Lukács und Kuczynski 20 Jahre trennten – Lukács ist 1885 geboren, Kuczynski 1904 –, gehörten beide einer Generation an, wenn man dem Begriffsverständnis von Karl Mannheim folgt. Sie erlebten die gleichen grundlegenden Ereignisse: die Oktoberrevolution, den Machtantritt der Nazis, die Säuberungen Stalins, den Zweiten Weltkrieg und den Wiederaufbau ihres Herkunftslandes. Beide wurden Marxisten, Intellektuelle in der Partei, im Gegensatz zu jenen, die Intellektuelle der Partei waren und ihr Denken den Bedürfnissen der Partei anpassten.
Weder der eine noch der andere wurde ein Parteifunktionär, ein Apparatschik, ein russischer Begriff, der Misstrauen und Missfallen erzeugt, ebenso wie das deutsche Wort Funktionär. Dieser Begriff kommt dem des Beamten nahe, über den sich Max Weber äußerte. Auch wenn der Apparatschik nicht an ein Angestelltenverhältnis in der Verwaltung gebunden ist, lassen beide, der Apparatschik und der Beamte, ihre Loyalität gegenüber ihrer Funktion erkennen, nicht gegenüber ihren Überzeugungen. Und wenn es solche gibt, dann »bleiben sie hinter dem anonymen Schleier der Funktionen verborgen«.22
Für beide, Lukács und Kuczynski, waren weder Karrierismus noch Opportunismus prägende Eigenschaften, und dies aus gutem Grund: Sie standen über den Dingen. Beide hatten bereits viel veröffentlicht und erfreuten sich einer gewissen Reputation. Wenn sie ihre abweichende Position kundtaten, dann stets innerhalb der Partei (und der ihr nahen wissenschaftlichen Institutionen), mündlich und niemals öffentlich, auch wenn man sie zwischen den Zeilen herauslesen konnte, eine Praxis, die weit verbreitet war. Sie vermieden den hölzernen Sprachjargon, der Ton ihrer Schriften war abwägend und stand im Kontrast zu dem Stil, den die meisten Mitglieder der Partei praktizierten.
Beide waren gebildet, vermochten in mehreren Sprachen zu lesen und kamen aus bürgerlichen, seit mehr als zwei Generationen assimilierten jüdischen Familien.
In der DDR gehörten diese kritischen Denker mehrheitlich der Kategorie der Westemigranten an. Wir werden aber sehen, dass auch deutsche Kommunisten, die ihr Exil in der UdSSR verbracht und die Stalinsche Schreckensherrschaft überlebt hatten, mitunter eine ähnlich kritische Haltung zeigten. Diese loyalen Kritiker waren durch gemeinsame Erfahrungen zusammengeschweißt – durch den Kampf gegen den Nationalsozialismus, erst recht durch die lebensbedrohliche Rassenverfolgung und durch die Entscheidung für die DDR.
Als sie nach dem Krieg nach Deutschland zurückkehrten, wurden sie von den Gründervätern des Regimes – Walter Ulbricht, Wilhelm Pieck, Johannes R. Becher – begrüßt, die mit der Roten Armee aus dem Exil in der Sowjetunion zurückgekehrt waren. Max Schroeder, Jürgen Kuczynski, die Schriftstellerin Anna Seghers, der Dramatiker Bertolt Brecht, der Philosoph Ernst Bloch und andere waren das intellektuelle Pfand der DDR. Aber die ideologischen Gründerväter des Regimes vermochten weit mehr. Auf versteckte Weise formten sie einen kritischen Geist der folgenden Generation, der Generation von Christa Wolf, Volker Braun und Heiner Müller. Somit praktizierten sie eine »loyale Subversion«23 und spielten eine Rolle, die von der postkommunistischen Geschichtsschreibung bislang wenig untersucht worden ist.
Die Essayistin Daniela Dahn hat etwa zehn Jahre nach dem Fall der Mauer ein Institut für eine vergleichende Forschung der deutschen Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg24 eingefordert, weil die Geschichtsschreibung zum deutschen Sozialismus weitgehend von einem antikommunistischen, eher kämpferischen als nachdenklichen Ton geprägt sei. Mehr als 30 Jahre nach dem Verschwinden des Landes haben diese Intellektuellen noch immer keinen Platz in der großen offiziellen Erzählung über die DDR gefunden. Zerstören sie etwa das (gewünschte) Bild, wenn man ihnen Rechnung tragen würde? Das Vorhaben Daniela Dahns ist bislang nicht umgesetzt.
Das öffentliche Wissen über ostdeutsche Erfahrungen wird nach wie vor stark von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur beeinflusst. Das gilt insbesondere, wenn jenes Wissen als Schaufenster nach außen und der Vorgabe des Tons dient, in dem über die DDR zu sprechen ist, wobei daran auch die Vergabe von finanziellen Mitteln für Forschungen oder Ausstellungen gebunden ist. Vergleichende Untersuchungen betreffen zumeist nicht die DDR und die Bundesrepublik Deutschland, sondern die DDR und den Nationalsozialismus, was nicht unproblematisch ist. Derartig eklatante Beispiele für eine Geschichtsschreibung durch die Sieger in solch kurzer Zeit sind selten. Sicherlich muss man in dieser Beziehung die wissenschaftliche Forschung von der breitenwirksamen Popularisierung von Wissen über die Geschichte unterscheiden, wie sie von entsprechenden Organisationen betrieben wird. Und gewiss gibt es auch in Bezug auf die Organisationen Unterschiede.
Man kann darüber hinaus auch kürzlich erschienene Arbeiten von jüngeren Historikern anführen, die für einen Paradigmenwechsel stehen; von Historikern, die ihre Arbeiten auch so verstanden wissen wollen. Zunächst sollte man aber eine Erzählung über die DDR, die über etwa 30 Jahre entwickelt wurde, in Frage stellen, in der diese auch von Historikern auf eine Diktatur reduziert worden ist, eine Erzählung, die noch dazu in den Medien sehr präsent ist. Das wäre auch die Gelegenheit zu fragen, inwiefern diese uniforme Erzählung dem Aufstieg des Rechtsradikalismus Vorschub geleistet hat. Es wäre nicht weniger wichtig gewesen, dass diejenigen, die von einem Tag auf den anderen ihre Arbeitsplätze verloren, durch reflektierendes Denken von innen heraus, nicht nur ihre Situation als Dominierte bzw. Beherrschte hätten verstehen müssen – wie es der französische Soziologe Pierre Bourdieu von ihnen verlangen würde25 –, sondern auch die Herrschafts- und Unterdrückungsform des gescheiterten Regimes. Doch sie erlebten, wie ihre Institute aufgelöst und ihre Abschlüsse nicht anerkannt wurden. Von da an waren sie ihrer akademischen Legitimation beraubt oder durch das Etikett »Ostdeutsche« diskreditiert, und in der Folge verloren sie ihre Stimme, die bislang mit Autorität verbunden war.
Die neue Bundesrepublik Deutschland machte innerhalb eines Jahres Tabula rasa mit allen Institutionen und Betrieben der DDR. Wenn sie, die kritischen Denker, vor dem Fall des sozialistischen Regimes nicht gewagt hatten, öffentlich ihre Meinung zu äußern, so waren sie auch danach nicht in der Lage dazu, es sei denn an marginalen Orten. Andere, aus der alten Bundesrepublik kommend, die nicht die Erfahrungen der besagten Intellektuellen hatten, besetzten deren Stellen und erlangten damit die Autorität, das Leben in der DDR zu erklären und von den Traumata zu berichten, die sich aus dem Leben in der Diktatur ergeben hätten.26 Und all das trotz der »einstweiligen Verfügung« eines berühmten westdeutschen Historikers, Jürgen Kocka, der gefordert hatte, solche Vokabeln wie »totalitäre Diktatur« weniger für politische als für erklärende Zwecke zu verwenden.27
Leider hat der Name des Philosophen Wolfgang Heise kaum Eingang in die Literatur über die DDR, die weitgehend aus westdeutscher Feder stammt, gefunden. So ist heute wenig bekannt, dass Heise Einführungen zu Karl Marx geschrieben hat, in denen er Marx eine aktuelle Bedeutung gab, dass Heise Einführungen in die Werke von Lukács, der Frankfurter Schule, von Jean-Paul Sartre und Michel Foucault verfasst hat, die eine ganze Generation im Widerstand gegen den Dogmatismus prägte.28 Steht diese Ignoranz im Zusammenhang damit, dass Heise niemals daran gedacht hat, die Partei oder die DDR zu verlassen?
Als Wolfgang Heise 1987 im Alter von 61 Jahren starb, hat er keine Memoiren hinterlassen. Wenn man Autobiographien, Tagebücher, Briefwechsel seiner Zeitgenossen, die nach dem Mauerfall veröffentlicht wurden, liest und sie mit Archivmaterial über sie konfrontiert, sei es aus den Archiven der Verbände (der Schriftsteller und Künstler etc.), der Partei oder auch des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS), so ergibt sich ein differenzierter Blick auf die Erfahrungen im »real existierenden Sozialismus«,29 der allerdings nicht minder traurig ist. Mit Hilfe dieser Quellen kann man nachverfolgen, inwiefern sich zu DDR-Zeiten, in verschiedenen Instanzen wirkliche Konflikte abspielten und ein pluralistisches Denken zur Sprache kam. Darin besteht eine der wichtigsten Einsichten, die sich aus der Öffnung der Archive der DDR ergaben. Allerdings wurde diese Einsicht bislang kaum weiterverfolgt.
Die amerikanische Forscherin Catherine Epstein hat in einer Studie zu den »letzten revolutionären deutschen Kommunisten« aufgezeigt, wie die Öffnung der Archive die herrschende Vorstellung von der DDR in Frage gestellt hat. Auf Fragen zu ihrem Nichteinverständnis mit der Politik der Partei antworteten diese Kommunisten – so Epstein – dass sie in den Parteiversammlungen das Wort ergriffen, mit den verantwortlichen Stellen Stück für Stück diskutiert und ihnen zahlreiche Briefe geschickt hätten. Doch sie gestanden ein, nicht genügend getan zu haben.30 Leserbriefe, die an das Zentralorgan der SED Neues Deutschland gerichtet wurden, bestätigen ihr Bestreben, kritische Äußerungen auch an die Öffentlichkeit zu bringen. Man antwortete ihnen meistens persönlich, aber druckte sie nicht ab.31 »Ich dachte und ich denke immer noch, wenn alle Genossen den Mut gehabt hätten, ihre Kritik an der Parteipolitik zu äußern, hätte man viele Dinge verhindern können«, schreibt Herbert Crüger in seinen Erinnerungen32
Auch wir werden sehen, dass die Partei keineswegs ein homogener Block war, wie es gern glaubhaft gemacht wird.33 Und wir werden ebenfalls erkennen, in welchem Maße die Genossen eher eine Ethik des Schweigens praktizierten als eine wirkliche Disziplin, denn die Disziplin war eher vereinbart als erlitten. Ohne den Einfluss dieser Intellektuellen, die zumeist charismatische Persönlichkeiten waren und als moralische Instanzen in der Gesellschaft galten, ist die beeindruckende Stabilität des Systems nicht zu verstehen, die für die DDR über so viele Jahre hinweg, bis zu ihrem letzten Atemzug, so charakteristisch war. Die Bücher dieser Intellektuellen hatten zwar nur geringe Auflagen, doch waren sie, kaum erschienen, immer schnell vergriffen.
Die Untersuchung dieser Akteure erhellt einen wichtigen, bislang wenig bekannten Bereich der DDR-Geschichte. Allerdings empfiehlt sich ein Analyseansatz, der von der Totalitarismusdoktrin Abstand nimmt, die sich von der mehr oder weniger direkt formulierten These einer Äquivalenz der beiden deutschen Diktaturen leiten lässt. Eine solche Gleichsetzung ist schon allein deshalb nicht gerechtfertigt, weil – wie der israelische Philosoph Avishai Margalit in seiner Studie34 über »gute« und »schlechte« Kompromisse besonders betont – diese Männer und Frauen aus moralischen Gründen Partei für den Kommunismus ergriffen haben, aus einer Motivation heraus, die für niemanden Anlass war, Anhänger des Nationalsozialismus zu werden. Margalit bemerkt auch: »Das bedeutet jedoch nicht, daß wir uns nicht mit der Frage beschweren sollten, warum es unter unseren Freunden keine ehemaligen Hitleristen, wohl aber ehemalige Stalinisten gibt und warum wir ihnen Zugeständnisse machen, die wir Hitleristen niemals zu machen wagen.«35
Eine Verbindung zwischen gestern und heute herzustellen ist vielmehr in dem Sinne angeraten, dass man danach fragen sollte, was sich vor 30 Jahren abgespielt hat, was sich nicht abspielen konnte und was heute geschieht. Die Tatsache, dass es Ostdeutsche gibt, die rechtsextrem wählen, auf deren angebliche Unreife und das Fehlen einer demokratischen Kultur in der DDR zurückzuführen, ist eine einseitige und partielle Sicht auf das Verhältnis von Staat und Gesellschaft in der DDR. Ihre Ziele konnte die Staatsmacht niemals wirklich erreichen. Dem Regime gelang es nicht, den Widerstand des berühmten »Eigensinns«36 auf allen Ebenen – beginnend in den Reihen der Partei – zu brechen.
Man weiß vor allem, dass sich nach den Reprivatisierungen und den Modalitäten des Einigungsprozesses im Jahre 1990 bei vielen Ostdeutschen das Gefühl von Deklassierung und von Verletzungen, im Zeitalter von Globalisierung und Liberalismus, noch verstärkt hat. Ein solches Gefühl breitete sich in den entindustrialisierten Regionen aus, wo Westdeutsche in einer Rekordzeit alle Spitzenpositionen der Macht, von der Wirtschaft bis zur Universität, eroberten.37 Da die intellektuelle Elite der DDR den Habitus der Ethik des Schweigens zu spät abgelegte, verlor sie ihre Autorität. Der Aufruf »Für unser Land«, initiiert von Christa Wolf und von nahezu allen kritischen Geistern in der DDR unterzeichnet, kam zu spät. Er wurde auf einer Pressekonferenz am 28. November 1989 bekannt gemacht und sollte den Erhalt sozialistischer Werte in der DDR sichern, »nicht einer DDR, so wie sie war, sondern so, wie sie hätte werden sollen«. Der Aufruf wurde durch die schnell eröffnete Perspektive der Vereinigung hinweggefegt. Gewiss konnte diese Elite die schnelle und von Helmut Kohl mit Elan vorangetriebene Inkorporation nicht verhindern. Es war tatsächlich ein bedingungsloser Beitritt ohne Übergang, unter dem Deutschland – so kann man denken – bis heute leidet.
Hatte die Loyalität der ostdeutschen Marxisten ihre Niederlage zum Preis? Auch die Frage nach den Wurzeln dieser Loyalität ist zu stellen. Was war die Triebfeder für diese Loyalität für oder gegen alles? Welche Mechanismen gab es für eine Anhängerschaft, und welche Unterschiede lassen sich ausmachen? Zustimmung, gütliche Einigung und Unterwerfung lagen zwischen Hoffnung und einem langen Prozess der Entzauberung.
Um Antworten auf diese Fragen zu finden, muss man sich in die Zeit zurückversetzen, die dem »Tod der Ideologien« vorausging, das heißt, als die großen Ideologien noch lebendig waren und Überzeugungen das psychische Fundament der engagierten Intellektuellen bildeten. Dieser Kontext ist das »kurze 20. Jahrhundert«, wie es der kommunistische britische Historiker Eric Hobsbawm beschreibt. Er selbst ist als ein »linientreuer Dissident«38 gegenüber der Partei zu bezeichnen, von dem wir dank der Akten des Geheimdienstes »Ihrer Majestät« wissen, dass er – genau wie die Protagonisten dieses Buches – in der Partei schlecht angesehen war, weil er nicht aufhörte, seine Kritik vorzutragen, von der er stets dachte, dass sie den Parteiausschluss zur Folge hätte.
TEIL I: Die Hoffnung
Die Rückkehr
Während es Max Schroeder gelang, aus den USA nach Deutschland zurückzukehren und Edith Anderson in Paris wartete, saß Bertolt Brecht, der ebenfalls aus Amerika kam, in Zürich fest, wo er für zwei Jahre bleiben sollte. Ermutigt durch Jürgen Kuczynski verließ Anna Seghers ihr Exilland Mexiko. Da sie einen mexikanischen Pass besaß, hatte sie weniger Schwierigkeiten als der staatenlose Bertolt Brecht. Der nationalsozialistische Staat hatte allen, die geflohen waren, die Staatsbürgerschaft aberkannt. Von ihrer Seite schickten die Sowjets sorgfältig ausgesuchte deutsche Antifaschisten in ihr Herkunftsland zurück, damit sie sich am Aufbau der künftigen »Volksdemokratien« in den Gebieten beteiligten, die dieser Siegermacht in Jalta zugesprochen worden waren. Die Rückkehr aus den westlichen Staaten in die Sowjetische Besatzungszone wurde über Prag organisiert, das noch von der Roten Armee besetzt war.
Zahlen, die Auskunft über die deutschsprachige Emigration geben, können nicht präzise angegeben werden. Man schätzt, dass annähernd 500.000 Menschen das Naziregime in Deutschland und Österreich verlassen hatten. Davon gelangten ungefähr 130.000 in die USA.1 Weniger als die Hälfte, so einige Quellen, entschieden sich nach Kriegsende für die Rückkehr, nur vier Prozent davon waren Juden. Aber auch in dieser Hinsicht gibt es – wie für die Zahlen der Emigranten – keine offizielle Statistik. Historiker unterstreichen in beiden Fällen die Probleme der Quellen. Weder in der DDR noch in der Bundesrepublik existierten offizielle Stellen, die sich mit der Identifikation der Emigranten beziehungsweise der Remigranten beschäftigt hätten. Eines aber ist sicher: Anders als die Emigration war die Rückkehr kein massenhaftes Phänomen. Als das Ausmaß der Verbrechen der Nazis bekannt wurde, entschieden sich zahlreiche Flüchtlinge, in ihrem Aufnahmeland zu bleiben. Ein nicht unerheblicher, aber schwer zu quantifizierender Teil der Nazigegner beschloss, in keinen der beiden Teile Deutschlands zurückzukehren. Man weiß dies vor allem von jenen, die eine gewisse Bekanntheit erlangten. Dem Beispiel von Thomas Mann folgend, hatten sich viele in der Schweiz niedergelassen oder es war ihnen nicht gelungen, sich zu integrieren, weder in dem Land ihrer Zuflucht noch in Deutschland. Mitunter machten sie jedoch, wie beispielsweise Hans Sahl,2 das Exil zu ihrer Heimat.
Die Entscheidung für die Rückkehr nach Deutschland hing von mehreren Faktoren ab: von dem Grad der Integration im Zufluchtsland, von ideologischen Überzeugungen und von dem politischen Klima diesseits und jenseits des Atlantik.
Länder wie Mexiko, in das Anna Seghers wie etwa 300 andere Mitbürger geflohen waren, oder wie die Türkei oder auch Shanghai boten weniger Möglichkeiten der Integration als Frankreich, Großbritannien, die Schweiz oder Argentinien und noch weniger als die Vereinigten Staaten. Aus Großbritannien kehrte eine weitestgehend fest zusammenhaltende Gruppe von 200 Familien zurück. Zu ihnen zählten junge Erwachsene, die als Waisen mit den Kindertransporten3 kamen. Für sie war die kommunistische Jugendbewegung eine Ersatzfamilie geworden, und die hier geknüpften Verbindungen blieben meist bestehen.4 Die Frage einer möglichen Rückkehr nach Deutschland stellte sich auf andere Weise für die etwa 80.000 deutschen, deutschsprachigen tschechischen und österreichischen Juden, die Palästina erreicht hatten. Viele waren Zionisten, für andere war Palästina ein erzwungener Zufluchtsort.5 Die meisten stellten sich darauf ein, dort zu bleiben.
Von den Emigranten, die in die Vereinigten Staaten gekommen waren, beabsichtigte eine Mehrheit zu bleiben und sich zu integrieren.6 Wissenschaftler wie Albert Einstein, der vom Institute for Advanced Study in Princeton eingeladen worden war, fanden dort – wie andere weniger Berühmte – zufriedenstellende Arbeitsbedingungen vor und nahmen wieder Positionen als Gelehrte ein. In New York bildete sich an der New School for Social Research eine Oase für zahlreiche Intellektuelle, denen man Visa ausstellte, um in die Vereinigten Staaten fliehen zu können. Auf dem Gebiet der Künste, insbesondere des Kinofilms, machten Fritz Lang und der aus Österreich stammende Billy Wilder ihren Weg in Hollywood, während Kurt Weill, Komponist der ersten Brecht-Opern, den Broadway bevorzugte, dessen musikalische Komödien seiner Vorstellung von einer Volksoper entgegenkamen.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Nur die Kommunisten hatten bis 1947 nahezu komplett die Vereinigten Staaten verlassen, um in die sowjetisch besetzte Zone Deutschlands zu gehen.7 Mit Sicherheit war diese Entscheidung ihrer politischen Überzeugung geschuldet, dennoch mögen sich Zweifel und Zögern eingestellt haben, denn der Kalte Krieg zog bereits am Horizont auf. Doch die heute oftmals verwendete Rede von einer »Falle«, in die sie geraten seien, entspringt einer teleologischen Sicht der Geschichte. Bis zum Ende der McCarthy-Ära gab es für deutsche Antifaschisten, die Sympathien für die Kommunisten hatten, reale Gründe, sich auf amerikanischem Boden in Gefahr zu sehen.
Die »communazis«
Ein Klima der Gefahr stellte sich nach der berühmten Rede Winston Churchills vom 5. März 1946 ein, in der er erklärt hatte, von Stettin an der Ostsee bis Triest an der Adria habe sich ein Eiserner Vorhang auf den europäischen Kontinent herabgesenkt. Diese Rede beflügelte die Paranoia und führte zu einer Intensivierung der Überwachung von Flüchtlingen. Kaum hatten sie ihren Fuß auf amerikanischen Boden gesetzt, wurden diejenigen unter ihnen, die als Sympathisanten des Kommunismus oder einfach nur als Linke bekannt waren, unter Beobachtung gestellt und abgehört, ihr Briefverkehr – unter Verletzung des Postgeheimnisses – kontrolliert, Papierkörbe inspiziert und Maßnahmen ergriffen, um ihre Psyche zu destabilisieren. Das Zurückhalten von Briefen, über das Edith Anderson im Falle von Max Schroeder berichtete, gehörte dazu.
Die Neigung des Federal Bureau of Investigation (FBI), in jeder Person mit einer Sensibilität für »links« einen Kommunisten oder einen Sympathisanten der Kommunisten zu sehen, trug dazu bei, dass sich in jener Zeit das Feld der Beobachtung ungemein erweiterte. So enthielt zum Beispiel allein die Akte des Komponisten Leonard Bernstein, der niemals auch nur im Entferntesten ein Freund oder Anhänger des Kommunismus war, 666 Seiten.8 Nazigegner standen besonders im Visier, und die Agenten des FBI zögerten nicht, eine zweifelhafte Verkürzung zu kreieren und sie »communazis«9 (Nazikommunisten) zu nennen. Die Akte von Thomas Mann und seiner Familie umfasste mehr als 1.000 Seiten, die von Brecht nicht weniger als 400 Seiten. Auch Anna Seghers’ Akte war mit 1.500 Seiten sehr umfangreich. Ihr hatte man das Asyl in den Vereinigten Staaten verweigert, als sie 1941 aus Marseille ankam. Sie musste deshalb mit einem Schiff zurück nach Mexiko reisen. Das Office of Strategic Services (OSS), die Vorläuferorganisation der Central Intelligence Agency (CIA), stellte sie in Mexiko weiter unter Beobachtung.10
Das House Committee on Un-American Activities (HUAC) hatte 1938 noch vor dem FBI die Untersuchungskommission zu unamerikanischen Aktivitäten aufgebaut. Mit dem Ende des Krieges bestand die vordringliche Aufgabe dieses Ausschusses darin, die Rückkehr von Kommunisten nach Deutschland zu verhindern. Der Antikommunismus war die virulente offizielle Ideologie in den Vereinigten Staaten bis zum Sturz von Joseph McCarthy im Jahre 1954, als der Senator den Verdacht äußerte, Kommunisten und sowjetische Spione seien bis in die höchsten Sphären der amerikanischen Regierung vorgedrungen. Aber zwischenzeitlich hatte er Unterstützung durch Exkommunisten bekommen, die Hannah Arendt, die nach New York geflüchtet war, als Antikommunisten »von Berufs wegen« bezeichnete. Diese Besessenen, vor denen man sich in Acht nehmen solle, hätten im Kontext einer Mission gehandelt, die darin bestand, Amerika amerikanischer zu machen. Hannah Arendt prägte dafür die berühmt gewordene Wendung, es handele sich um »auf den Kopf gestellte Kommunisten«.11 So meinte der Philosoph Sidney Hook, früher Marxist, dass ein Kommunist nicht an einer Universität lehren dürfe, weil er kein freier Denker sei, und forderte dessen Entlassung. Die Arbeit für das FBI war nach Meinung von Sidney Hook eine staatsbürgerliche Pflicht. In einigen Universitäten verlangte man sogar, einen patriotischen Eid zu leisten. Sicherlich gab es wenige Kommunisten unter den Universitätsangehörigen, hingegen zahlreiche Sympathisanten, die ebenso gefährdet waren. Diejenigen, die wegen einer Sympathie für Kommunisten verdächtigt wurden, mussten sich vor demütigenden Kommissionen des Kongresses verantworten, wo man eine »Denunziation für die richtige Sache« einforderte. In diesem Zusammenhang wurden 10.000 Menschen in den USA zu Befragungen vorgeladen, die zum Ziel hatten, sie auszubürgern. 12.000 Ausländer lebten in der Gefahr, wegen »subversiver Aktivitäten« ausgewiesen zu werden.12
Während die Autorin von Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft beschloss, um jeden Preis in den USA zu bleiben, und laut ihrer Freundin Mary McCarthy niemals eine Rückkehr nach Deutschland ins Auge fasste, entschied sich Thomas Mann für die Ausreise, obgleich er wegen seiner Bekanntheit einem gewissen Schutz unterstand. Er war immerhin in Besitz der amerikanischen Staatsbürgerschaft. Nachdem Thomas Mann ein Glückwunschschreiben an den Präsidenten des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands Johannes R. Becher zu dessen Geburtstag geschickt hatte, bezichtigte ihn ein Kongressmitglied 1951 in den USA undankbar zu sein. Er war ein Symbol des Widerstands gegen den Nationalsozialismus





























