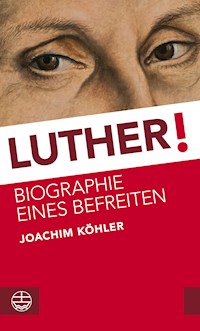
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Evangelische Verlagsanstalt
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Mit entschiedener Sympathie und beeindruckendem psychologischen Gespür lässt Joachim Köhler, Autor zahlreicher biographischer und kulturgeschichtlicher Werke, den großen Glaubenskämpfer der deutschen Geschichte lebendig werden. "Christsein heißt, von Tag zu Tag mehr hineingerissen werden in Christus." Dieses leidenschaftliche Bekenntnis des Reformators steht im Mittelpunkt von Köhlers brillanter Biographie, die Luthers dramatische Entwicklung in drei Stadien – Bedrängnis, Befreiung und Bewahrung – darstellt. Sie zeichnet sowohl Luthers existenzielle Glaubenserfahrungen nach als auch die Anfechtungen psychologischer und politischer Art, mit denen er lebenslang zu ringen hatte. Köhler schreibt uns den großen Luther ins Herz, ohne den manchmal kleinlichen und irrenden zu beschönigen. Er lässt symbolträchtige, aber in ihrer Faktizität teils umstrittene Momente wie Turmerlebnis oder Thesenanschlag in ihrer Authentizität einsichtig werden. Vor allem aber zeigt er: Luther ist nicht von gestern. Er hat vor 500 Jahren Fragen aufgeworfen und beantwortet, die wir uns heute wieder stellen müssen. Lesen Sie Luther mit Köhler!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JOACHIM KÖHLER
LUTHER!
BIOGRAPHIE EINES BEFREITEN
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
2., korr. Auflage 2017
© 2016 by Evangelische Verlagsanstalt GmbH·Leipzig
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Weiterverarbeitung in elektronischen Systemen.
Cover: NORDSONNE IDENTITY GmbH, Berlin
Coverbild: Ausschnitt aus dem »Lutherbildnis« von Lucas Cranach d.Ä.,
1528, Foto: © Kunstsammlungen der Veste Coburg
Innengestaltung und Satz: Friederike Arndt · Formenorm, Leipzig
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2016
ISBN 978-3-374-04640-9
www.eva-leipzig.de
VORWORT
»EIN WAHRHAFT MENSCHLICHER MENSCH«
Luther steht bei mir in solcher Verehrung, dass es mir, alles wohl überlegt, recht lieb ist, einige kleine Mängel an ihm entdeckt zu haben, weil ich in der Tat der Gefahr sonst nahe war, ihn zu vergöttern.1Gotthold Ephraim Lessing 1753
Wie seltsam: Da hat man einen deutschen Festtag, bei dem man ein halbes Jahrtausend Weltveränderung feiern kann, aber vielen ist nicht zum Feiern zumute. Noch seltsamer: Da hat man einen Mann, der auf der ganzen Welt als großer Deutscher verehrt wird, aber sein eigenes Land hat zu viel an ihm auszusetzen, um ihn wirklich zu mögen. Mit ihrem nationalen Erbe, so scheint es, gehen die Deutschen verschwenderisch um.
Über den Reformator, der jahrhundertelang zu den populärsten Deutschen zählte, rümpft man heute die Nase. Irgendwie hält man ihn für »typisch deutsch« – zu derb, zu spießig, zu fanatisch in seiner Intoleranz. Zudem befremdlich »antieuropäisch«,2 wie Thomas Mann bemäkelte. Wenn dagegen der Religionskritiker Ludwig Feuerbach in Luther einen Mann sah, »dessen die heutigen Deutschen nicht mehr wert«3 seien, so gilt heute das Umgekehrte: Man findet, dass Luther der heutigen Deutschen nicht mehr wert sei.
Er scheint einfach zu viel auf dem Kerbholz zu haben. Nach heutigen Begriffen stand er zwar auf dem »Boden des Grundgesetzes«, aber nur mit einem Bein. Auch als Demokraten kann man ihn kaum bezeichnen. Die »multikulturelle Gesellschaft« war ihm fremd, und für Feindbilder hatte er eine Schwäche. Zudem moniert man seinen Autoritätsglauben, mit dem er den Menschen das Untertanentum schmackhaft gemacht hatte. Kurz: An politischer Korrektheit lässt Luther sehr zu wünschen übrig.
Auch an Aktualität. Sein Denken, so meint man heute, sei mittelalterlich, seine Sprache altmodisch. Wenn noch im neunzehnten Jahrhundert der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel sagte, es sei eine der »größten Revolutionen« der Geschichte gewesen, »den deutschen Christen das Buch ihres Glaubens in ihre Muttersprache übersetzt zu haben«,4 glaubt man das heute differenzierter sehen zu müssen: Bibelübersetzungen gab es schließlich schon vor Luther, und dass seine Version überhaupt zum modernen Selbstverständnis passt, wird weithin angezweifelt.
Selbst die großen Augenblicke, mit denen er in die Geschichte einging, scheinen bei näherer Betrachtung ihren Glanz zu verlieren. Die mutigen Worte, mit denen er in Worms vor Kaiser und Kirche auftrumpfte, sollen, so meinen Historiker, eher kleinlaut gewesen sein. Statt des markigen Hier stehe ich, ich kann nicht anders soll ihm nur ein banges »Gott helfe mir« über die Lippen gekommen sein. Und seine Reformationshymne »Ein feste Burg ist unser Gott« klingt heute mit ihren »Wehr und Waffen« zu martialisch, um wirklich populär zu sein.
Selbst der Tag seines Thesenanschlags, der sich 2017 zum fünfhundertsten Mal jährt, löst Stirnrunzeln aus. Die einen sagen, er habe die Thesen gar nicht selbst an die Kirchentür angeschlagen. Andere meinen, dass es überhaupt keinen Anschlag gegeben habe, weil er die Thesen diskret auf dem Postweg verbreitete. Und eine dritte Partei versichert, dass die Reformation erst lange nach dem 31. Oktober begonnen habe. Den Namen »Reformationstag« könne man sich schenken.
War sonst noch etwas?
Allerdings. Das ablehnende Bild, das man heute von ihm zeichnet, stimmt nämlich nicht. Nicht Fakten folgt es, sondern ideologischen Deutungsmustern. Und selbst wenn manches zutreffen sollte, dann nicht so, wie es sich die Lutherkritiker vorstellen. Er war kein Demokrat, gewiss, aber keiner vor ihm hat dem Einzelnen eine so souveräne Stellung zugewiesen wie er. Nicht Papst, Kaiser oder Staat waren maßgebend für den Menschen, sondern allein Gott. Und der saß nicht irgendwo im Jenseits, sondern war schlicht da. Man war auch nur ihm verantwortlich. Wer Luther als Obrigkeitsdiener bezeichnet, hat diese epochale Befreiung nicht begriffen.
Luthers gesellschaftliche Kreuzzüge, so deprimierend sie heute wirken, lassen sich großenteils auf zeitbedingte Missverständnisse zurückführen. Und wer ihn für einen autoritären Konformisten hält, sitzt selbst einem Missverständnis auf. Nicht der Benimmkodex der Gesellschaft zählte für ihn, sondern allein Christus. Wer dessen Angebot annahm, brauchte kein Grundgesetz. Der musste auch keiner humanistischen oder pazifistischen oder sozialistischen Ideologie folgen. Nach Luther genügte es, ein christlicher, das heißt, ein wahrhaft menschlicher Mensch5 zu sein.
Die große, nun schon über hundert Jahre währende Abrechnung mit dem Reformator hat in Wahrheit nicht ihn demontiert, sondern nur das falsche Bild, das man über Generationen hinweg von ihm zeichnete. Entmythologisiert wurde nur der Mythos, ihn selbst verlor man aus dem Auge. Die einen hoben ihn auf den Sockel, von dem die anderen ihn stürzten. Er selbst wollte nie aufs Podest, und von Denkmälern, vor denen man die Knie beugt, hielt er ohnehin nichts. In jenem talartragenden Bronzekoloss, der breitbeinig und mit der Bibel unterm Arm auf die Menschheit herabblickte, hätte er sich nicht wiedererkannt.
Gewiss gab es den bissigen Reformator, der oft genug die Grenzen der Höflichkeit und des guten Geschmacks ignorierte. Doch dafür brachte er die Heiterkeit in die Religion zurück. Christus ist ein Gott der Freude, rief er allen frommen Sauertöpfen zu. Ein Christ soll und muss ein fröhlicher Mensch sein.6 Und jene, denen die Freiheit eines Christenmenschen aufging, konnte er sich gar nicht anders vorstellen, als dass sie vor Freude am liebsten in die Luft gesprungen wären. Ja, wenn einer diese Glaubensrevolution ganz begriffe, so sagte er einmal, wäre es kein Wunder, wenn es ihn vor Freude schier zerrisse.7 Den Bierernst der Theologen wie die Steifheit des Klerus hielt er für lächerlich. Sein Gott war kein zorniger, sondern ein lachender Gott8. Wer sich nicht mitfreuen konnte, sollte sich auch nicht Christ nennen. Nur wer überall und immer lachen kann, versicherte er, ist ein wahrer Doktor der Theologie.9
Wer dem Reformator heute seine oft wenig delikate Ausdrucksweise vorwirft, übersieht, wie sehr dieser immer zum Scherzen aufgelegte Mann dem gesellschafts- und kirchenkritischen Till Eulenspiegel glich – sowohl in der verletzenden Direktheit wie in der feinsinnigen Ironie. Übrigens wusste die christliche Tradition seit Paulus, dass der Narr der Wahrheit Gottes näher stand als der gelehrte Alleswisser. Noch die mystische Theologie, die Luther in sich aufnahm, pries den Narren als wahren Weisen. Der scholastischen Selbstherrlichkeit setzte er dessen »wissendes Nichtwissen« entgegen. Als es für ihn in Worms um Leben und Tod ging, sei er, so berichtete ein entsetzter Papstlegat, wie »ein Narr mit fröhlichem Gesicht«10 vor den Kaiser getreten. Als Christ eben.
Gesellschaftlichem Ansehen maß er keine Bedeutung zu. Er machte sich nichts aus sich selbst. Auf Vermögensbildung legte er keinen Wert. Er brachte den Menschen ihre neue Freiheit, das genügte. Wo Ich war, sollte Christus sein. Und der thronte nicht auf Wolken, sondern lag in der armseligen Krippe und hing am bitteren Kreuz. Und war doch, trotz allem Leid und aller Verzweiflung, trotz Tod und schmählichem Untergang, wieder auferstanden. Einen Christen kann nichts umbringen.
Einen Luther auch nicht. Er ist auch nicht von gestern. Vor fünfhundert Jahren hat er Fragen beantwortet, denen wir uns heute wieder stellen müssen, ob es uns angenehm ist oder nicht. Wohin uns diese von sich selbst besessene Gesellschaft bringt, in der nur das Ich und seine Facebook-Likes zählen, wird sich zeigen. Ich will nichts heißen, auch nichts befehlen, sagte der Reformator von sich selbst, will auch nicht Autor genannt werden. Und für seine Anhänger fügte er die Mahnung an: Ich bitte, man wolle meines Namens schweigen und sich nicht lutherisch, sondern Christen nennen.11 Sein letzter Satz, kurz vor seinem Tod niedergeschrieben, lautete denn auch nicht: »Hoch lebe das Luthertum!«, sondern: Wir sind Bettler, das ist wahr.12
Auch in dem Buch, das der Leser in Händen hält, wird man keinen Hochruf auf das Luthertum finden. Ein deutliches »Hoch lebe Luther!« wird er aber doch hören. Nicht allzu laut gesprochen, aber auch nicht zu zaghaft. Und nicht nur zwischen den Zeilen. Der Luther dieses Buches ist ein Luther mit Ausrufezeichen.
Bleibt nur noch der Hinweis, dass die Zitate um leichterer Lesbarkeit willen in flüssige Sprache übersetzt und gelegentlich leicht gekürzt wurden. Die Zitatquellen wurden nach ihrer stilistischen Qualität ausgesucht. Luthers eigene Worte sind kursiv gedruckt. Mein herzlicher Dank gilt der Verlegerin der Evangelischen Verlagsanstalt, Frau Dr.Annette Weidhas, die zur Niederschrift den letzten Anstoß gab und sie in anregenden Gesprächen begleitete.
Joachim Köhler Hamburg, Pfingsten 2016
INHALT
Cover
Titel
Impressum
Vorwort
ERSTER TEIL: BEDRÄNGNIS
Kapitel Eins: Der programmierte Sohn
1.Mit dem Silberlöffel im Mund2.Ein aufstrebendes Familienunternehmen3.Vom Horror des Erzogenwerdens4.Eine Lektion in Sanftmut5.Der eingemauerte Prophet6.Im »Hurhaus und Bierhaus«7.Auf dem Denkweg der Moderne8.»Es ist eine Lust zu leben!«9.Der Befreiungsschlag
Kapitel Zwei: Im Fegefeuer
1.Zwischen Teufelsspuk und Himmelsgnade2.Kehraus in der Himmelspforte2.Die Schule der Demütigung4.Im Hamsterrad der Heiligkeit5.»Tristissimus«6.Der schreckliche Herr Christus7.Das Duell der ungleichen Fechter8.Martins Höllenfahrt9.Die missglückte Primiz
Kapitel Drei: Der »wahre Vater«
1.Tugendrose für Ketzerjäger2.»O meine Sünde, Sünde, Sünde!«3.Die Gelassenheit des Seelenführers4.Einweihung in eine »neue Kunst«5.Der Herr der Knochen und Knöpfe6.Bauboom in Wittenberg7.Von heiligen Zähnen und goldenen Nasen8.Die Wunder der Stadt Rom9.Bei der Hungerheiligen
ZWEITER TEIL: BEFREIUNG
Kapitel Vier: Vom Alleswissen zum Nichtwissen
1.Unterm Birnbaum2.Gottes Generalbevollmächtigter 3.Die Kathedralen der Weisheit4.Der Weltarchitekt und seine Erklärer5.Vom »stillschweigenden Leugnen Gottes«6.Ockhams Rasiermesser7.Wo Freud und Descartes irrten8.»Nimm und lies!«9.Statt römischer Scholastik eine deutsche Theologie
Kapitel Fünf: Anschlag auf die Kirche
1.Käufliche Liebe2.Die Erfindung des Franchise-Unternehmens3.Vom deutschen Michel4.Eine fromme Intrige5.»Aufgereizt gegen den Papst«6.Der verladene Ablassprofiteur7.»Mit dem Feuer in die Furcht gejagt«8.Hat er nicht oder hat er doch?9.Das Wackeln der Tiara10.»Die Engel als Botenläufer«
Kapitel Sechs: Auf Kollisionskurs
1.Theta heißt Tod2.»Du hast nur noch das Martyrium zu erwarten«3.Der Hirt und die Kröte4.»Wir haben keinen größeren Feind als uns selbst«5.Der in sich verkrümmte Mensch6.»Hat man Christus, hat man alles«7.Toilettenturm mit Gartenblick8.»Da riss ich hindurch«9.»Er selbst tut’s durch uns«
Kapitel Sieben: Kräftemessen
1.Der »Fürst der Scholastiker«2.»Revoca!«3.Der verzagte Retter4.»Gott ist hier, und Gott ist überall«5.Der Drachentöter aus Ingolstadt6.Eine alte Wunde wird aufgerissen7.Das Murmeltier verkriecht sich
Kapitel Acht: Posaunenstöße
1.Die Ikone der Reformation2.Die Gelassenheit der Gottesmutter3.»Du machst uns singen, wenn du uns weinen lässt«4.Wie Gott einen Heiligen enttäuschte5.Eine »neue Gestalt des Geistes«6.»Wildschwein aus dem Walde«7.Die Paradoxie der Freiheit8.Wie Braut und Bräutigam
DRITTER TEIL: BEWAHRUNG
Kapitel Neun: Die zwei Seiten des Gottesreichs
1.Der Narr und der Kaiser2.Das unerhörte Wort3.Versteckspiel mit Karl4.Hieronymus im Gehäuse5.Als Luther nicht mehr beten konnte6.
ERSTER TEIL
BEDRÄNGNIS
KAPITEL EINS
DER PROGRAMMIERTE SOHN
Weil die Kinder vor einem jeden Wort des Vaters oder der Mutter erzittern, fürchten sie sich auch später ihr Leben lang selbst vor einem rauschenden Blatt.13
1. Mit dem Silberlöffel im Mund
Martin Luther erblickte das Licht der Welt neun Jahre, bevor Columbus die Neue Welt entdeckte. Nicht Frömmelei und Fürstenfurcht standen an seiner Wiege Pate, sondern Wirtschaft und Welthandel. Die Loslösung vom Mittelalter hatte ihm der Vater abgenommen, als er Pferd und Pflug im Dörfchen Möhra zurückließ und für die Zukunft auf die Metallindustrie setzte.
Sein erster Sohn lag auch nicht auf Stroh gebettet, sondern trug einen silbernen Löffel im Mund. Im Mansfelder Erzbergwerk geschürft, an dem sein Vater Anteile hielt, im Feuer von dessen Schmelzöfen geläutert und zur klingenden Münze geprägt, war Silber die Währung, mit der sich Kaiser und Päpste, ja sogar das Seelenheil kaufen ließen. Als dies dem Sohn des Unternehmers aufging, entdeckte er selbst eine neue Welt.
Mit Columbus trat Europa in die Epoche der Globalisierung ein. Der »Weltmarkt«, basierend auf Bankgewerbe, Industrieproduktion und Logistik, entstand. Wer gestern noch seinen Acker bebaut hatte, nahm heute einen Kredit auf, um Waren zu produzieren und zum Verkauf in ferne Länder zu exportieren. Dass man sich damit an anderen Völkern vergriff, war dem Reformator sehr wohl bewusst. Nie zuvor in der Geschichte, so würde er dereinst sagen, hätten so viel Irrtum, Sünde und Lügen geherrscht wie in dieser Epoche, wo die Kaufmannschaft um die Welt fährt und alle Welt verschlingt.14 Für seine Zeitgenossen war das kein Thema. Man besorgte seine Geschäfte, und im Gegenzug kam Reichtum ins Haus.
Auch in das der Luders, wie der eigentliche Familienname lautete. Als ihr erster Sohn am 10. November 1483 in Eisleben geboren wurde, standen sie kurz vor der Übersiedlung in seine zukünftige Heimat Mansfeld. Überspitzt ließe sich sagen, dass Luther nur in Eisleben war, um dort geboren zu werden, wie er 63 Jahre später nach Eisleben zurückkehrte, um dort zu sterben. In der Leichenpredigt auf den berühmten Mann wurde gemutmaßt, er stamme »dem Namen und Herkommen nach von Kaiser Lothar«15 ab. Doch scheinen dessen Nachfahren keinen Anspruch auf den Reformator erhoben zu haben.
Wann genau Martin Luther geboren wurde, blieb zwischen seiner Mutter und Philipp Melanchthon strittig. Der Lutherfreund und leidenschaftliche Astrologe hatte horoskopisch berechnet, dass der Reformator in der neunten Stunde geboren sein müsse. Da die Mutter das Geburtsjahr nicht mehr genau angeben konnte, sich aber deutlich erinnerte, es sei gegen Mitternacht gewesen, blieb Melanchthon nur die bedauernde Feststellung, »ich nehme an, sie hat sich getäuscht«16.
Schon bald florierte Vater Hans’ Geschäft in der Mansfelder Montanindustrie. Die dortigen Erzvorkommen lieferten das Material für die Modernisierung Europas: Mit sächsischem Kupfer wurden die Dächer der Kirchen und Paläste gedeckt, Kanonen geformt oder die Gießinstrumente der Buchdrucker hergestellt. Noch wichtiger aber wurde das edle Metall, das sich aus dem Kupfer herausschmelzen ließ: Silber.
Um sich an dem lukrativen Geschäft beteiligen zu können, hatte der Metaller17, wie sein Sohn ihn nannte, erst einmal eine Menge Geld aufbringen müssen. Für das nötige Betriebskapital, das ein einfacher Bergmann niemals zusammensparen konnte, dürfte ein Kredit der begüterten Familie Lindemann gesorgt haben, aus der seine Frau Margarethe, Luthers Mutter, stammte. Auch sonst scheinen die im Bergbau engagierten Lindemanns dem jungen Schwager unter die Arme gegriffen zu haben. Ein Onkel Antonius diente den Grafen von Mansfeld als oberster Bergverwalter.
Wenn Martin Luther im Alter betonte, er sei ein Bauernsohn, der Urgroßvater, mein Großvater, der Vater sind richtige Bauern gewesen18, so mochte das von seinem Selbstverständnis her zutreffen. Geprägt hat es ihn nicht. Denn im Mansfelder Haushalt, der sich zur Oberschicht zählen durfte, standen nicht das Wetter und die Ernte, sondern der Marktpreis von Edelmetall auf der Tagesordnung, und wohl auch die Unmöglichkeit, zwei Herren gleichzeitig zu dienen: Hans Luder musste nicht nur den Mansfelder Grafen die Pacht bezahlen, sondern vermutlich auch das vorgeschossene Gründungskapital an die Lindemanns. Dazu kam ein weiterer Kostenfaktor: Da sich sein Geschäft gut anließ, lieh Luder sich bei einer Kreditgesellschaft hohe Summen, mit denen er weitere Hüttenfeuer pachten konnte. Wie sich später zeigen sollte, war er allzu optimistisch gewesen. Am Ende konnte er die alten Schulden nicht abstottern und musste sie seinem Sohn Jacob hinterlassen.19
2. Ein aufstrebendes Familienunternehmen
Die Gewinnung von Silber war ein arbeitsaufwendiges Geschäft. Aus tausend Zentnern Rohkupfer, die im gepachteten Bergwerk geschürft wurden, ließen sich bei der Verhüttung gerade einmal fünf Zentner Silber gewinnen. Nach Abzug des Pachtzinses blieb einem Pächter wie Hans Luder nicht allzu viel übrig. Den Löwenanteil sicherten sich die eigentlichen Nutznießer, die adligen Bergwerksbesitzer und Landesfürsten.
Hans Luders Pachtherren waren die Grafen von Mansfeld. Auf einem schroffen Berg hoch über der Stadt bewohnten sie eine imposante Burg, die mehreren Belagerungen getrotzt hatte. Der Grafenfamilie gehörte das Bergwerk, das Hans Luder anteilig bewirtschaftete und für dessen Schmelzöfen er ihnen Rechenschaft schuldig war. Das Wohlergehen von Martins Familie hing von der Gunst der Herrschaft ab. Hans Luder konnte sich noch darauf verlassen, seine Nachkommen nicht mehr.
Auch dank der Mansfelder Industrie, zeitweise Europas größter Silberproduzent, verfügten die sächsischen Fürsten über die bedeutendsten Finanzreserven des Kontinents. Kaiser KarlV. schwärmte, dass die Aristokratie aus dem Montanwesen größeren Gewinn ziehe als aus jedem anderen Wirtschaftszweig. Mit dem auch in Mansfeld geprägten Silbergeld, das den Goldgulden als Hauptzahlungsmittel verdrängte, sollte der Habsburger die Welt erobern. Doch nicht nur Handelsflotten und Söldnerheere ließen sich damit ausrüsten. Hans Luders sächsischem Landesherrn, Kurfürst Friedrich dem Weisen, schenkte der Silberreichtum ein ungleich kostbareres Gut: die Unabhängigkeit von Kaiser und Kirche.
Vom Geldsegen, mit dem Weltpolitik gemacht wurde, blieb bei Luders einiges hängen. Gegen Ende seines Lebens hat der Montanunternehmer sich in seinem stattlichen Mansfelder Bürgerhaus in Öl porträtieren lassen. Vom dunklen Hintergrund hebt sich ein tief gefurchtes Gesicht mit kleinen, wachsamen Augen ab. Den Daumen im patrizischen Pelzkragen, blickt er unter emporgezogenen Brauen an Lucas Cranach, dem befreundeten Maler, vorbei, als fasse er ein fernes Ziel ins Auge. Die zusammengepressten Lippen und die scharf gekrümmte Falte über der Nasenwurzel lassen ahnen, dass er, wie ein Lutherbiograph schrieb, »seine Interessen hartnäckig zu verfolgen wusste«20.
Das Porträt der Mutter, ebenfalls von Lucas Cranach gemalt, zeigt nicht die Bürgerstochter aus wohlhabender Familie, sondern, nach Blick und Tracht, eher die Magd des Hüttenmeisters. Sie hatte acht oder neun Kinder zur Welt gebracht und einige früh begraben müssen. In der Anfangszeit ihrer Ehe sammelte sie im Wald Reisig, das sie auf dem Rücken nach Hause trug. Die resignierten Worte ihres Lieblingslieds, »Mir und dir ist keiner hold, das ist unser beider Schuld«, hat ihr Ältester nie vergessen. Sah der Sohn gar schüchtern21 zum übergroßen Vater auf, wirkte Mutter Margarete vollends eingeschüchtert. Dass »Dr.Martin«, wie sein Freund Spalatin meinte, »sowohl an Körperbau als Gesichtszügen seiner Mutter«22 glich, lässt sich auf dem Cranach-Bild jedoch nicht erkennen.
In Mansfeld war Hans Luder schnell zu Ansehen gelangt. Seit 1491 gehörte er zum Magistrat, den Grafen diente er als Berater und Vertrauensmann. Als moderne Archäologen die Abfallgrube unter seinem Anwesen untersuchten, entdeckten sie dort einen kleinen Schatz aus dreihundert Silbermünzen, sogenannten Eisleber Hohlpfennigen.23 Auch sonst deutete vieles auf gehobenen Lebensstil hin. Man »trank aus filigranen Pokalen und benutzte zierliche Messer«. Die verbrannten Überreste edler Kleidungsstücke erinnerten daran, dass zwei von Martins Brüdern 1505 an der Pest gestorben waren. Wie die beiden hatte auch Martin nach Hans Luders Plan »eine Funktion im florierenden Familienbetrieb« übernehmen sollen. Doch lebte er damals schon im Kloster.
Martins vier Geschwistern, Bruder Jacob und drei Schwestern, fiel die Aufgabe zu, den Fortbestand des Unternehmens zu sichern. Denn die von den Grafen gepachteten Schmelzöfen, die sogenannten »Herrenfeuer«, blieben in der Familie, zumindest solange, bis die Mansfelder Herren es sich anders überlegten. Martins Schwestern wurden, wohl aus Geschäftsraison, mit Hüttenmeistern verheiratet, der Bruder, im Bergwerk angelernt, übernahm die väterliche Pacht. Auch Martins Jugendfreund Hans Reinecke, vom Vater für ihn ausgesucht, war Sohn eines Kollegen und stand ebenso für dessen Nachfolge bereit, wie Martin dereinst in die Fußstapfen seines Vaters treten sollte.
Vermutlich hatte Hans Luder seinem Stammhalter einen Ehrenplatz in der Geschäfts- und Familienplanung zugedacht. Da die »komplizierten Lehensverhältnisse im Mansfelder Bergbau« zu ständigen Querelen mit anderen Pächtern und geldgierigen Adligen führten, war es sehr nützlich, »einen Juristen in der Hüttenmeisterfamilie zu haben«24. Für den Vater würde der Sohn Verträge aufsetzen, Schürfrechte aushandeln und Prozesse führen können. Dazu sollte er, wie viele Hüttenmeister vor ihm, Jura studieren und den Doktor der Rechte erwerben. So war Martins Leben, noch bevor er das Licht der Welt erblickte, von Hans Luder fest verplant. Als seinem Sohn dies bewusst wurde, brach er mit dem Vater und einem Leben, das nicht das seine war.
Bis der berühmte Blitz neben ihm einschlug, war es das seine gewesen. Für den Juniorchef gab es nur einen Lebenssinn, die Mehrung des Familienvermögens, und nur eine Zukunft, die Silbergewinnung aus gepachteten Bergwerken. Wie Martin auf diese Karriere vorzubereiten war, darüber hatte Vater Hans genaue Vorstellungen. Ob er dem begabten Jungen, wie Heinrich Heine glaubte, »die unterirdische Werkstatt zeigte, wo die mächtigen Metalle wachsen und die starken Urquellen rieseln«25, ist nicht überliefert.
Hans Luder trug große Verantwortung. Er organisierte die »gesamte Rohkupferproduktion vom Abbau des Kupferschiefers über das Schmelzen in der gepachteten Hütte bis zur Ablieferung des Rohkupfers in die Waage zu Eisleben«26. Seinen Sohn wird er gelegentlich durch das oberirdische Labyrinth der prasselnden Schmelzöfen und ohrenbetäubenden Stampfhämmer geführt haben, vorbei an Holzkohlehäusern, Aschenschuppen und Erzwaschanlagen, die von kunstvoll regulierten Bergbächen gespeist wurden. An der Hand des Vaters ging es mitten durch ein wimmelndes Heer von geschwärzten Kapuzenträgern, denen die Schrecken der Tiefe und des Feuers ins Gesicht geschrieben standen.
Herzstück der pulsierenden Bergwerksmaschine war das neu entwickelte Verfahren der »Kupferseigerung«. Hatte man das silberhaltige Kupfererz aus engen Stollen zu Tage gefördert, wurde es »geklaubt, gepocht, gequetscht, gemahlen, gesiebt und gewaschen«. Nach der äußerlichen Bearbeitung wurde das Material »sieben Mal geröstet und wieder verschmolzen«. Erst nach dieser Läuterung begann die eigentliche »Seigerung«, die Scheidung der Elemente im Feuerofen.
Das Ergebnis, schimmernde Silberstücke, erhielt nach Bestehen einer letzten »Feuerprobe« das Siegel des adligen Besitzers und konnte, gemünzt und poliert, in Umlauf gehen. Später würde Martin Luther diese Erfahrung in einem seiner Kirchenlieder verarbeiten. Wie erst nach langer Läuterung das Silber, durchs Feuer siebenmal bewährt, den Zustand der Reinheit erreichte, konnte auch nur demjenigen das Gotteswort aufgehen, der durch das Feuer der Anfechtungen gegangen war: Erst dann, so der Reformator, begriff man die Heilsbotschaft, wurde Gottes Kraft erkannt und scheint und leucht’ stark in die Lande27.
3. Vom Horror des Erzogenwerdens
Im Bild, das der Reformator von seinem Vater zeichnete, wurde der Glanz von Düsternis überwogen. Als Kind sei er von den Eltern hart gehalten worden, erzählte er, und der Vater habe ihn einmal so heftig mit der Rute geschlagen, dass er sich eine Zeitlang verbittert vor ihm versteckte. Wer das strenge Cranach-Porträt betrachtet, wird sich kaum darüber wundern.
Vermutlich hat der Vater gar nicht bemerkt, wie bedrückend er auf seinen Sohn wirkte. Als der Reformator gegen Ende seines Lebens auf Körperstrafen zu sprechen kam, wies er auf die unsichtbaren Wunden in der Seele der Kinder hin. Die Strafe, so sagte er, haftet viel fester als die Wohltat. Auch wenn die Mutter, nachdem die Kleinen mit der Rute geschlagen wurden, gute Worte gibt und allerlei Versöhnung vorwendet, so steckt ihnen das Leid doch so tief im Herzen, dass sie oft seufzen und hernach lange schlucken müssen.28
Rückblickend schrieb Luther, seine Eltern hätten es zwar herzlich gut gemeint, aber kein Fingerspitzengefühl dafür besessen, wie die Züchtigungen zu bemessen sind. Es sei ein bös Ding, wenn Kinder um harter Bestrafung willen den Eltern gram29 würden. Wo eine solche Furcht in der Kindheit bei einem Menschen einreißt, so bemerkte er noch im Alter, mag sie schwerlich wieder ausgerottet werden ein Leben lang.30 Luther wusste, wovon er sprach.
Für seinen Vater gehörte autoritäres Auftreten zum Handwerk. Unternehmersein hieß, sich durchzusetzen, wenn nötig, handgreiflich. Wer sein Vermögen in eine Zeche gesteckt hatte, so empfahl ein zeitgenössisches Lehrbuch, sollte die Grubenarbeiter gehörig »einschüchtern«. Ertappte man einen bei Nachlässigkeit oder Diebstahl, hielt man sich nicht mit Diskussionen auf. Die Hüttenmeister, so das Lehrbuch, »strafen ihre Leute selbst«. Dann schlägt, bildlich gesprochen, der Blitz ein.
Auch sonst war das Bergwerk ein gefährlicher Ort. Jederzeit konnten Schlagende Wetter die Stollen zum Einsturz bringen, das herabstürzende Gestein die Bergleute unter sich begraben. In deren Köpfen brütete das ewige Dunkel Monster aus. So hörte Hans Luder von einem verunglückten Bergmann, dass der Teufel selbst ihm die tödlichen Wunden beigebracht hätte. Von der Mutter wusste Martin, dass die Familie von einer zauberkundigen Nachbarin schikaniert wurde. Wenn die Hexe mit magischer Kraft auf seine Geschwister schoss, schrien die Kleinen sich schier zu Tode.31 Wer derlei nicht glaubte, konnte es im soeben erschienenen Handbuch für Inquisitoren, dem »Hexenhammer«, nachlesen. Martin glaubte es.
Auf den zarten Knaben, der manchmal zur Schule getragen wurde, schien es der Teufel besonders abgesehen zu haben. Wenn der Reformator später den Bösen persönlich für die Gefährdungen seiner Kindheit verantwortlich machte, meinte er dies durchaus wörtlich. Satan, so verriet er einmal bei Tisch, hätte mich oft gern umgebracht.32 Als hätte der Teufel geahnt, welche Gefahr ihm in Luther erwachsen sollte, war er mit unglaublichen Mitteln darauf aus, mich umzubringen und mich zu fesseln, so dass ich mich öfters gefragt habe, ob ich wohl der Einzige unter den Sterblichen sei, auf den er es abgesehen hatte.33
Die Schauermärchen aus der »Teufe« des Bergwerks, die am heimischen Tisch erzählt wurden, reimten sich auf die Allgegenwart des »Teufels«. Nach der Kirchenlehre war jedes Neugeborene von ihm besessen, bis es als »Täufling« im geweihten Wasserbad von ihm befreit wurde, vorläufig. Überall wurde er sprichwörtlich an die Wand gemalt, und in der Mansfelder St. Georgskirche konnte man ihn sogar als buntes Fresko bestaunen. Damals glaubte der Junge, für seine Ängste den universalen Deutungsschlüssel gefunden zu haben.
Nie gab es vor Satan Sicherheit, das wusste Martin, jederzeit konnte er niederfahren wie ein Blitz oder Schlagendes Wetter. Gerade wenn man sich am Geborgensten fühlte, so sollte der Große Katechismus dereinst warnen, kann der Teufel noch diese Stunde einen solchen Pfeil ins Herz treiben, dass ich kaum bestehen bleibe.34 Nicht alles war nur Phantasie. Martin ist auch durch eine wirkliche Hölle gegangen. Was Strenge und Härte einem Menschen antun können, hat er schon in Mansfeld gelernt. Gleich neben der Kirche stand die »Trivialschule«, in der ihm Grammatik, Logik und Rhetorik eingebläut wurden. Jahrelang quälten sich die Söhne der Stadt, um einmal eine Stelle als Kanzlist oder eine Pfründe als Kleriker zu ergattern. Sie quälten sich und wurden gequält. Alles musste auswendig gelernt werden. Sprechen durften sie nur in der Kirchensprache Latein. Kam ihnen ein Wort in der Bauernsprache Deutsch über die Lippen, gab es die Rute.
Bei den Lehrern, die laut Luther selbst nichts gekonnt hatten, galt dieses Marterinstrument als ideale Gedächtnisstütze. Die barbarische Abstrafung hat sich Martin tief eingegraben. In diesem vermeintlichen Tempel der Gelehrsamkeit, so klagte er später, hätten in Wahrheit nur Zittern, Angst und Jammer geherrscht. Hatte der Schüler noch einen Funken Lebenslust in sich, wurde er ihm bald ausgetreten. Selbst aus langer zeitlicher Distanz erschienen Luther die Lehrer so grausam wie Henker, die Schule als vorweggenommene Hölle und Fegefeuer, darinnen wir gemartert sind.35
Sechs Jahre lang wurde der Sohn des Hüttenmeisters auch in die Martern des Spitzel- und Bußwesens eingewiesen. Jeder hatte die Pflicht, auf einem »Wolfszettel« die Sünden der anderen festzuhalten. Ende der Woche wurden sie mit Stock und Rute abgebüßt. Die Angst davor und die Schmerzen danach waren für die Kleinen kaum zu ertragen. Ähnlichkeiten mit dem Jüngsten Gericht, an dem ebenfalls zum Schluss abgerechnet wurde, waren kein Zufall.
Angst scheint Martins vorherrschendes Lebensgefühl gewesen zu sein, und nicht nur die vor dem Teufel. Wenn er nach einem schweren Schultag nach Hause ging, kam er womöglich vom Regen in die Traufe. Denn die hohen Ansprüche der Lehrer wurden noch übertroffen von denen des Vaters, der Großes von seinem Stammhalter erwartete. Er wollte Fortschritte sehen und allabendlich hören, was sein Filius auf der Schulbank gelernt hatte.
Kam er ins Stocken, setzte es Schläge. Der Grausamkeit der Schulmeister und dem Jähzorn des Vaters ausgeliefert, fühlte Martin sich wie zwischen zwei Mühlsteinen. Er konnte sich drehen und wenden, wie er wollte, aus dieser Zwangslage gab es keinen Ausweg. Deutlich glaubte er die zerstörerische Kraft dessen zu spüren, der ihn so gerne getötet hätte. Aber, so konstatierte Luther später, er konnte es nicht.36
4. Eine Lektion in Sanftmut
Mit dreizehn Jahren war der Hoffnungsträger der Mansfelder Rute entwachsen. Dass er über eine anmutige Singstimme verfügte und außerdem zum Träumen neigte, scheint den Vater nicht weiter beunruhigt zu haben. Solange das große Ziel vor Augen blieb, war er’s zufrieden. Zur weiteren Ausbildung schickte er den Jungen in die Domstadt Magdeburg, wo er zu den Nullbrüdern37 in die Schule ging. Diese »Brüder vom gemeinsamen Leben«, die um den Kopf eine enge Kapuze, die »Nolle«, trugen, unterrichteten mit erzbischöflichem Segen an der Domschule, wo die Zöglinge auf das akademische Studium vorbereitet wurden.
Der Geist dieser im vierzehnten Jahrhundert gegründeten Reformgemeinschaft für Laien widersprach allem, was Martin Luther in Mansfeld erfahren hatte. Nicht das väterliche Besitzstreben galt hier, sondern die Besitzlosigkeit. Statt der lärmenden Betriebsamkeit des Bergwerks herrschte die Stille der Meditation. Das auftrumpfende Selbstbewusstsein des Unternehmers wurde durch die Demut der Brüder ersetzt. Keinen Unterschied gab es mehr zwischen Arm und Reich, zwischen Laien und Priesterschaft. Man war fromm, ohne bigott zu sein.
Selbst auf Mönchsgelübde und einträgliche Straßenbettelei wurde verzichtet. Lieber lebte und arbeitete man wie andere Menschen auch. Mit Vorliebe aber wurde unterrichtet, und zwar ohne den Mansfelder Horror. Nicht Duckmäuser sollten herangezogen werden, sondern freie, weltoffene Christen. Daneben pflegte man auch die klassischen Sprachen und die Philosophie des Altertums. Für Martin bekam der einstige Schreckensbegriff »Schule« einen neuen Sinn: Der Terror der Rute war der Macht des Wortes gewichen.
Die Glaubensrichtung, der die Bruderschaft folgte, hieß »Devotio moderna«. Im Mittelpunkt dieser »Modernen Frömmigkeit« standen nicht klerikale Hierarchie und Zeremonien, sondern Christus selbst. Wie in der Mystik sollte sich zwischen ihm und dem Gläubigen eine Beziehung entwickeln, die ohne die Vermittlung kirchlicher Institutionen auskam. Eine solche Gemeinschaft mit Gott, die bis zur Einswerdung ging, hatte die spätmittelalterliche Mystik gelehrt.
»Die Grundzüge der Devotio moderna«, so schrieb ein Kirchenhistoriker, »sind unwiderleglich mystischen Charakters«.38 Christus war demnach, wie schon der Apostel Paulus gelehrt hatte, dem Menschen näher als dieser sich selbst. Für den wahrhaft Glaubenden war der Klerus überflüssig. Auch deshalb hatte sich die Laienbewegung den Argwohn der Kirche zugezogen. Selbstständigkeit im Glauben und ein zu enges Verhältnis zu Gott waren verdächtig. Beim Konstanzer Konzil, das Hus auf den Scheiterhaufen brachte, wurde der Bruderschaft denn auch von der Inquisition Ketzerei vorgeworfen.
Viele Wegbereiter der Neuzeit wie der Kardinal Nicolaus Cusanus aus Bernkastel-Kues oder der Humanist Erasmus von Rotterdam sind durch diese Schule der Moderne gegangen, vermutlich auch der Maler Hieronymus Bosch, der die Schrecken der Hölle und die Wonnen des Paradieses auf die Leinwand bannte. Sie alle wurden geprägt von einem Glauben, für den nicht Unterwürfigkeit, sondern die von Christus geschenkte Freiheit zählte.
Wenn es zutraf, dass Martin bei dieser Reformgemeinschaft gelernt, ja »mit Sicherheit« in deren Internat gewohnt hat, dann dürfte sich seine spätere Lebenswende bereits hier angebahnt haben. Zum ersten Mal hatte er den Geist einer Erneuerung kennen gelernt, der aus Gottes Wort selbst das Recht ableitete, jede menschliche Institution in Frage zu stellen.
Sprach man ihn später auf die Brüder vom gemeinsamen Leben an, machte er aus der Geistesverwandtschaft kein Hehl, ja versicherte sogar, dass die Bruderhäuser ihm über die Maßen gefallen39 hätten. Das Gefallen war gegenseitig. Das niederländische Reformkloster Agnetenberg, in dem der Mystiker Thomas von Kempen seine berühmte »Nachfolge Christi« schrieb, sollte zum Ausgangspunkt von Luthers Reformation im Westen werden.
5. Der eingemauerte Prophet
Nach kaum einem Jahr endete Martins vergessene Lehrzeit. Warum der Vierzehnjährige sein Bündel packen und Magdeburg verlassen musste, blieb im Dunkel. Möglicherweise hing sein Ausscheiden bei den Nullbrüdern mit diesen selbst zusammen. Dem Vater mag hinterbracht worden sein, dass sein Junge sich in der Bruderschaft zu heimisch gefühlt hatte. Derlei Abwege waren für ihn nicht hinnehmbar. Denn vom Mönchswesen hielt Hans Luder nichts, und Martins Zukunft war ohnehin schon verplant.
Der Schüler wurde in die Heimat der Mutter nach Eisenach beordert, wohl damit ihn die Verwandtschaft im Auge behalten konnte. Auch hier hatte es an Tonsurträgern keinen Mangel. Das Wartburg-Städtchen, vom Reformator später als Pfaffennest und Stapelplatz der Geistlichkeit40 verspottet, besaß zwei Nonnen- und fünf Mönchsklöster, die sich großenteils vom Bettel ernährten. Reformbrüder gab es keine, was zu Hans Luders Ortswahl beigetragen haben könnte.
Auch in Eisenach, wo Martin die Lateinschule besuchte, bekam er von väterlichen Silbermünzen wenig zu sehen. Vielleicht deshalb hat ihn seine Gastfamilie nicht gerade verwöhnt. Zur Abrundung seines Speiseplans ließ sie ihn, nach Sitte der Zeit, mit Leidensgenossen auf Betteltour gehen. Wie später der junge Johann Sebastian Bach hat Martin »das Brot vor den Häusern genommen« und zum Dank fromme Choräle gesungen. Auch weltliches Liedgut lernte er hier kennen: Ein Vikar des Marienstifts, der den musikalischen Schüler förderte, brachte ihn mit sangesfreudigen Franziskanermönchen zusammen. Bei ihnen lernte er nicht nur mehrstimmige Choräle kennen, sondern auch allerlei Geheimnisse, die sonst hinter Klostermauern verschlossen blieben.
Voller Mitleid, so berichtete Luther später, habe ihm sein Hauswirt, der für den Orden arbeitete, von einem legendenumwobenen Franziskaner erzählt. Keiner hatte ihn je zu Gesicht bekommen, denn der Mönch, der Johannes Hilten hieß, saß seit Langem eingemauert in strenger Klosterhaft. Da die Georgenschule, die der Vierzehnjährige besuchte, direkt neben dem Kloster lag, könnte er »manches Mal mit Grauen nach den düsteren Mauern hinübergeblickt haben, hinter denen der Ketzer Hilten gefangen lag«.41
Dessen Verbrechen hatte darin bestanden, verbotenes Gedankengut zu verbreiten. Begeistert von den Lehren des heiligen Franziskus und des Mystikers Joachim von Fiore, der den Anbruch des Gottesreichs vorausgesagt hatte, war der Theologe zum »Spiritualen« geworden. Vom Geist der religiösen Erneuerung beflügelt, geißelte er die Kirche, die vom Evangelium abgefallen sei, verwarf die Trennung zwischen Laien- und Priesterschaft und prophezeite die baldige Wiederkehr Christi, deren apokalyptische Vorzeichen er bereits zu erkennen glaubte. Als Hilten auch noch scharfe Kritik am Papsttum übte, verurteilte man ihn als Ketzer und mauerte ihn in ein Verließ ein, wo er nach zwölfjähriger Haft 1507 verstarb. Luther selbst war überzeugt, die barfußen Mörder zu Eisenach42 hätten den lebendig Toten am Ende erwürgt43.
Zum düsteren Geheimnis gehörte eine Prophezeiung, die hinter vorgehaltener Hand weitergetragen wurde. Als Hilten hat sterben müssen, so der Reformator, habe er geweissagt, um das Jahr 1516 werde ein Eremit aufstehen, um sein Martyrium zu rächen und das Papsttum zu stürzen. Ein anderer wird nach mir kommen, soll er zu seinen Brüdern gesagt haben, den werdet ihr sehen!44 Als Martin Luther, mittlerweile Augustiner-Eremit, ab 1516 die Geldgier der Papstkirche angriff und im Jahr darauf seine revolutionären Thesen anschlug, zweifelten Eingeweihte nicht, dass der zum Schweigen gebrachte Dissident ihn und »die Reformation vorausgesagt« hatte.
6. Im »Hurhaus und Bierhaus«
Mit Sechzehn hatte Martin sich zum Musterschüler entwickelt. Die Bildung, die man Hans Luder vorenthalten hatte, wurde von seinem Ältesten flugs nachgeholt. Der Sohn des Mannes, der zwar rechnen, aber kaum lesen konnte, erwies sich als Sprachwunder. Vor seinen Lehrern glänzte er mit Latein, der Sprache der Bibel, aber auch der antiken Klassiker. An beiden geschult, erhob er sich später zum ersten Theologen seiner Zeit und erfand, kaum dass er sich selbst gefunden hatte, die eigene Sprache neu. Im Klang des Wortes »Deutsch« schwingt seitdem »Luther« mit.
Nach drei Jahren Eisenach immatrikulierte Martin sich 1501 als Martinus Ludher an der Universität Erfurt, einer der angesehensten des Landes. Da er über kein eigenes Einkommen verfügte, blieb er von der väterlichen Finanzierung abhängig. Um dem Sohn das Studium bezahlen zu können, soll Graf Günther von Mansfeld dem Vater, als einem »ehrlichen Mann«, die »zwei Herrenfeuer über dem Möllendorfer Teich« zur Pacht überlassen haben.45 Insgesamt war Hans Luder an einem halben Dutzend Schmelzhütten beteiligt. Entsprechend bestand er darauf, im Leben des Sohnes die Fäden in der Hand zu behalten. Damit war Martins Laufbahn vorgezeichnet. Weit entfernt, sein eigener Herr zu sein und seinen Neigungen folgen zu dürfen, war er designierter Jurist und zukünftiger Mehrer des Familienvermögens.
Bevor er sich, wie vom Vater gefordert, mit dem Bergrecht beschäftigen konnte, musste er sich in die sieben »freien Künste« von Grammatik, Rhetorik, Logik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie einarbeiten. Besonderes Gewicht wurde auf die Philosophie des Aristoteles gelegt, den die kirchliche Schullehre zu ihrem wichtigsten Lehrmeister erhoben hatte. Luther lernte dessen logische Denkmethoden kennen, aber auch die ethischen Grundprinzipien, die es, wie bei dem Griechen nachzulesen, lange vor dem Christentum gegeben hatte.
Bei seinen scholastischen Studien entdeckte Luther, dass Johannes Hilten nicht der Einzige gewesen war, den der Klerus eingemauert hatte. Im Jahrhundert zuvor war der in Erfurt lehrende Theologe Johannes Rucherath aus dem rheinischen Oberwesel mit der Autorität zusammengestoßen. Unter Verweis auf die Heilige Schrift hatte er als Rektor der Erfurter Universität die Verweltlichung der Kirche verurteilt, den Zölibat angezweifelt und den Papst als Stellvertreter Christi abgelehnt.
Vom päpstlichen Großinquisitor wurde ihm in Mainz der Prozess gemacht. Seine Schriften kamen auf den Scheiterhaufen, ihn selbst verurteilte man, wie Johannes Hilten, zu lebenslanger Klosterhaft, in der er 1481 starb. Später klagte Luther über die verzweifelten, hoffärtigen Mörder, genannt Inquisitoren des ketzerischen Unglaubens46, die den bedeutenden Theologen auf dem Gewissen hatten. Zu Rucheraths Richtern hatte auch der Dominikanermönch Jakob Sprenger gehört, der es als Mitverfasser des »Hexenhammers« zu trauriger Berühmtheit brachte.
Einer der Hauptanklagepunkte gegen den Theologen betraf seine Einstellung zur kirchlichen Geldbeschaffung. Im »Traktat über den Ablass« hatte Rucherath die gängige Praxis, begangene Sünden durch eine Geldbuße zu tilgen, für Betrug erklärt. Die Reaktion des Klerus, der seine Haupteinnahmequelle verunglimpft sah, war vorauszusehen. Gerade in Ablassfragen ließ man nicht mit sich spaßen. Denn von dieser wundersam sprudelnden, schier unerschöpflichen Geldquelle hing die päpstliche Macht- und Prachtentfaltung ab. Wer sie anzutasten wagte, wurde vom Angesicht der Erde getilgt.
Im großstädtischen Erfurt, dem Kreuzungspunkt der nordeuropäischen Handelswege, wo sämtliche Bettelorden die Straßen nach Almosen abgrasten, lernte Luther die mönchische Lebensweise aus der Nähe kennen. Lange bevor er ins Kloster ging, konnte er die dort gepflogene Strenge am eigenen Leib erfahren. Denn auch in den Studentenwohnheimen, Bursen genannt, herrschte fromme Zucht, als sollten die Bewohner auf ein mönchisches Leben vorbereitet werden.
Der Stundenplan ließ kaum Zeit zum Atemholen. Im gemeinsamen Schlafsaal wurde um vier Uhr morgens aufgestanden, zu Bett ging es um acht. Neben den akademischen Obliegenheiten, die sich mit weltlichen Gegenständen beschäftigten, hatte sich jeder Bursianer reglementierten Frömmigkeitsübungen zu unterwerfen. Achtmal täglich waren die Studenten zu Gebetsandachten in der Kirche angehalten. Der Psalter war Pflichtlektüre. In vierzehn Tagen hatte man ihn durchzuackern und dann von vorn zu beginnen. Man trug Talar, sprach Latein und fühlte sich wie im Gefängnis.
Bei den kargen Mahlzeiten mussten je vier Schüler aus einer Schüssel löffeln. Essbares durfte grundsätzlich nicht gehamstert werden. Was übrigblieb, bekamen die Hausknechte, was diese nicht aßen, wurde den Armen in der Küche vorgesetzt. Während der Speisung gab es für die Scholaren keine Erholung. Um einen möglichen, wenn auch unwahrscheinlichen Genuss auszuschließen, wurde wie im Kloster aus der Heiligen Schrift vorgelesen. Zu allen ausgewählten Bibelstellen gab es passende Deutungen, die »Postille« genannt wurden, weil sie nach jenen, lateinisch »post illa«, kamen. Der Name gefiel Luther so gut, dass er ihn als Reformator für seine eigenen Predigtsammlungen beibehielt.
Natürlich entzogen sich die Studenten, die sich zu Unrecht wie Mönche behandelt fühlten, dem Reglement nach Kräften. Nachts schlichen sie sich aus den Bursen, besuchten lokale Attraktionen, tranken, karteten und kegelten, suchten Händel mit Einheimischen und Trost bei käuflichen Schönen. Später erinnerte Luther humorvoll an die Annehmlichkeiten, mit denen das Hurhaus und Bierhaus Erfurt die Bursenbewohner in Versuchung geführt hatte. Diese zwei Lektionen, fügte er sarkastisch hinzu, haben die Studenten in dieser Schule beherrscht.47 Ob er selbst über die Stränge schlug, ist nicht überliefert. Augenzwinkernd bekannte der Zwanzigjährige in einem Brief, durch Fressen und Saufen gehindert, habe ich bisher nichts Gutes gelesen und geschrieben.48
7. Auf dem Denkweg der Moderne
Während Martins Studienzeit vollzog sich in der modernen Handelsstadt ein anachronistisches Spektakel. 1502 hielt der päpstliche Kardinallegat Raimund Peraudi seinen festlichen Einzug. Die Stadt war in Feierlaune, die Glocken aller 36 Kirchen läuteten. Trotz finanzieller Ebbe hieß der Stadtrat den hochmögenden Besuch mit Pomp und Feuerwerk willkommen. Denn in ihm ehrte man die Macht des Papstes, der ihn gesandt hatte, und indirekt auch jene des Allmächtigen, den dieser auf Erden vertrat.
Anlässlich seiner Deutschlandtournee wollte der Franzose Peraudi, der nebenbei noch Bischof im österreichischen Gurk war, den neuesten Jubiläumsablass verkünden und die fälligen Gelder mittels zahlreicher Bußprediger, Beichtväter und Schatzmeister einziehen. Im Dom ließ er ein überdimensioniertes rot bemaltes Kreuz aufrichten, vor dem ein ebenfalls gewaltiger eisenbeschlagener Kasten darauf wartete, gefüllt zu werden. Dann hielt Peraudi seine bewährten Bußpredigten, und »das Geld in der Stadt wurde knapp«49.
Was Gott dem jungen Studenten damals bedeutete, ist unbekannt. Eine eindeutige Antwort dürfte ihm selbst schwergefallen sein. Denn so viele unterschiedliche Richtungen es in der Kirche gab, so vielgesichtig erschien ihm der Schöpfer. Das Papsttum präsentierte ihn als allmächtigen Herrscher, der, wie sein Stellvertreter Christus und dessen irdischer Repräsentant, unnahbar über der Welt thronte und ihr Treiben mit strengem Auge verfolgte.
Dagegen war der Gott der Laienbrüder verborgen und doch zugleich ganz nahe. Er brauchte keine Pfaffen, weil er selbst gegenwärtig war. Ohne klerikales Zeremonienwesen waren auch Reformatoren wie Hus, Hilten oder Rucherath ausgekommen. Ihr Gott sprach durch das Evangelium seines Sohnes. Als Heiland brachte er den Menschen die frohe Botschaft ihrer Gotteskindschaft, dem angemaßten Generalbevollmächtigten aber, der sich den Thron erschlichen hatte, verkündete er seinen donnernden Abgang.
Selbst in der Scholastik, die als offizielle Kirchenlehre die Universität beherrschte, gab es widersprüchliche Wege. Die einen schworen auf die Lehren des heiliggesprochenen Thomas von Aquin, die für Kirchenrecht und Konzilien maßgebend waren. Andere priesen Wilhelm von Ockham, der zwischen wissenschaftlicher und theologischer Wahrheit unterschied. Seinen Anhängern, den »Nominalisten«, bot dies die Möglichkeit, gefahrlos der Vernunft zu dienen und zugleich vor der Kirche zu dienern. Auch die Erfurter Ordinarien schlossen ihre wissenschaftlichen Abhandlungen, so weltlich sie sein mochten, mit frommem Gebet und Amen ab.
Was das Fundament ihres Glaubens betraf, boten auch die Scholastiker keine eindeutige Antwort. Neben dem Schöpfer Himmels und der Erden verehrten sie auch einen anderen, der Himmel und Erde bis dahin wie kein Zweiter erklären konnte: Aristoteles. Der Universalgelehrte, der mit seiner Logik, Physik, Astronomie und Ethik auch auf Martins Lehrplan stand, war Zentralfigur der christlichen Schullehre und damit der Erfurter Universität. »Ohne Aristoteles«, erklärte ein Bischof, der nebenbei noch Erfurter Professor war, »wird niemand ein Doktor der Theologie«.50
Und ohne Ockham gab es in Erfurt keinen Aristoteles. Alle Dozenten dieser Hochschule mussten sich mit erhobener Hand verpflichten, in ihren Vorlesungen die Werke des Griechen im Sinne des Engländers auszulegen. Man nannte dies die »Via moderna«. Hatte Martin in Eisenach die »Moderne Frömmigkeit« kennengelernt, wurde er nun als Student auf den »Weg der Moderne« gebracht.
Seine Examina ging der Student aus dem Mansfelder Erzrevier im Eilschritt an. Zum frühestmöglichen Termin absolvierte er im September 1502 die Prüfung zum Baccalaureus, dem »Lorbeerbekränzten«, womit das Recht, einen Degen zu tragen, verbunden war. Den nächsten akademischen Rang erreichte er Anfang 1505, als er, Zweitbester unter siebzehn Prüflingen, das Magisterexamen abschloss. Zur Belohnung gab es nicht nur den obligatorischen Fackelzug, sondern auch ein braunrotes Barett samt Siegelring, die ihn mit besonderem Stolz erfüllten.
Sein nicht minder stolzer Erzeuger war vom bestandenen Examen so gerührt, dass er den Sohn ab sofort mit dem herrschaftlichen »Ihr« anredete. Geschmeichelt übersah Martin allerdings, worauf die höfliche Geste abzielte: Mit dem Magistertitel hatte er sich endlich für das Jurastudium qualifiziert. Bald würde er die väterlichen Auslagen für Schul- und Studienzeit zurückzahlen, indem er die Stelle antrat, in der er dessen expandierendem Unternehmen nützlich sein konnte.
Dem Ziel seiner Bemühungen nahe, übersah der Vater allerdings, dass der frischgebackene Magister nicht mehr der eingeschüchterte Junge war, den er vor Jahren nach Magdeburg geschickt hatte. Er sprach auch nicht mehr seine Sprache. Geschult an klassischen Rhetorikern wie Cicero, handhabte er das Latein mit einer Virtuosität, die seine Lehrer zum Staunen brachte. Außerdem komponierte Martin vierstimmige Chorsätze und glänzte in dialektischen Disputationen, die er aus dem Stegreif führen konnte. Kommilitonen bewunderten ihn als »gelehrten Philosophen und Musikus«51.
Martin selbst sah sich am liebsten als Mann der Wissenschaft.52 Aber wie passte Wissenschaft zu Religion? Und wie passte die Religion der prunkenden Erzbischöfe zu jener der Brüder vom gemeinsamen Leben? Wie der weihrauchumnebelte Heiligenkult zum schlichten Gotteswort? Und war nicht ein Philosoph ein halber Ketzer? Und ein halber Ketzer fast schon eine ganze Leiche? Oder was bedeutete es, dass ihm, dem grünen Jüngling, ein alter Erfurter die Prophezeiung ins Ohr flüsterte, es muss eine Änderung werden, und die ist groß;
es kann also nicht bestehen?53
8. »Es ist eine Lust zu leben!«
Keiner in der Familie Luder ahnte, dass ihr Hoffnungsträger in Erfurt ein anderer Mensch geworden war. Da er sich Bücher nach eigener Wahl besorgen und diese in geselliger Runde diskutieren konnte, fühlte er sich frei, und er genoss diese Freiheit. Er war auch nicht der Einzige, der sich verwandelte. An den Universitäten breitete sich ein neuer Menschentyp aus, von dem die Kirche sich nichts träumen ließ. Die hypnotische Macht ihrer Dogmen wurde vom Reiz des freien Denkens verdrängt.
Man nannte es Humanismus. Seine frohe Botschaft, die sich mit der italienischen Renaissance ausbreitete, eroberte im Sturm die deutschen Universitäten. Dort ersetzte sie die alte unfrohe, mit der die Kirche geherrscht hatte. Nicht länger standen der strafende Gott und seine Heiligen im Mittelpunkt, sondern das Ebenbild Gottes selbst, der Mensch. Nicht in Messopfern und Wallfahrten bestand der neue Gottesdienst, sondern in der Entwicklung von Kreativität und naturwissenschaftlichen Einsichten über Gottes Schöpfung. An die Stelle der alten Frömmigkeit war, zuerst in den Köpfen der Gelehrten, dann auch im Volk, der Wunsch nach individueller Freiheit getreten.
»O Jahrhundert, o Wissenschaften! Es ist eine Lust zu leben!«, so drückte der Humanist Ulrich von Hutten die Gefühle dieses Aufbruchs aus, nicht ohne warnend in Richtung Rom anzufügen: »Du aber, Barbarei, nimm einen Strick und erwarte deine Verbannung!«54 Sein Jubel kam verfrüht. Dass die neue Weltanschauung eine stillschweigende Kriegserklärung an die Kirche darstellte, wollte keiner offen aussprechen. Es wäre ihm auch schlecht bekommen. Die Folterkeller und Scheiterhaufen, für Hexen und Andersdenkende reserviert, waren schlagende Argumente. Die Studenten wiederum, denen nach wie vor scholastische Lehren eingetrichtert wurden, bestärkte es in der Abneigung gegen die geistliche Zwangsjacke.
Erwacht aus dem Dornröschenschlaf, in den das Christentum sie gesenkt hatte, brachten die verbotenen Bücher des Altertums einen neuen, lebensfrohen Geist in die Welt. Wer das wahre Leben suchte, so riefen die Humanisten der Menschheit zu, konnte es bei Cäsar und Cicero, bei Ovid und Catull, Petronius und Martial und all den anderen Heiden finden, die ganz gut ohne Papst und Fegefeuer ausgekommen waren. Ihre alten Handschriften lagen zur Übersetzung bereit.
»Zu den Quellen!« lautete deshalb der Schlachtruf der Humanisten. Das Medium dieser Quellen war die Sprache. Aus dem Griechischen und Lateinischen übersetzt, stellten die antiken Autoren mit ihrer Unbefangenheit und Lebensnähe scheinbar selbst die Bibel in den Schatten. Mit jedem wiedergefundenen Buch erweiterte sich der kulturelle Horizont, nahm das Bild vom wahren Menschentum immer deutlicher Gestalt an.
Nicht mehr die züchtigen Heiligen waren es, an denen man sich orientierte, sondern die Rhetoriker Roms, die Helden Homers und Vergils, die Komödien des Plautus oder Satiren Juvenals. Statt der Genesis las man die Aeneis. Ganz nebenbei bestaunte man die laszive Nacktheit der Marmorstatuen und das erotische Raffinement der römischen Kaiserzeit, wie man es bei Sueton beschrieben fand. All dies, so hoffte man, würde nun seine Auferstehung erleben. In der Kunst war sie bereits Wirklichkeit geworden. Mit nie gekannter Wirklichkeitstreue und räumlicher Perspektive feierten die Renaissancemaler die Wiederentdeckung der antiken Schönheit. Es war die Geburtsstunde des »Universalen Menschen«.
Als Zeichen ihrer Universalität legten viele Humanisten ihre allzu gewöhnlichen Taufnamen ab und übersetzten sie in die Gelehrtensprache. So wurde aus dem Hüttenmeistersohn Luther vorübergehend ein Martinus Viropolitanus, Martin aus Mansfeld. Auch die Galionsfigur der Humanisten, der Holländer Gerhard Gerhards, schmückte sich mit dem lateinischen Pseudonym »Erasmus Roterodamus«. Als Mann aus Rotterdam verkörperte er wie kein anderer das neue Menschheitsideal.
Doch auch Luthers späterer Widersacher Erasmus kam nicht ohne Widersprüche aus. Als Zögling der Brüder vom gemeinsamen Leben vertrat er die »Devotio moderna«, als geweihter Priester die Papstkirche und als Philosoph die heidnisch-humanistische Weltanschauung. Mit derselben profunden Gelehrsamkeit edierte er den römischen Rhetoriker Cicero, Kirchenväter wie Origenes oder das griechische Neue Testament, das Luther 1521 auf der Wartburg seiner Bibelübersetzung zugrunde legte. Der neue Menschentyp war nicht zur Unterwerfung unter Dogmen und Gebote geschaffen, sondern entschied sich aus freien Stücken, das Gute zu tun. Das war die schöne, neue Welt des Erasmus Roterodamus, und Martinus Viropolitanus nahm sie in vollen Zügen in sich auf.
9. Der Befreiungsschlag
Vier Jahre lang konnte Martin Luther diesen Traum mitträumen. Begeistert arbeitete er sich in Philosophie, Musik und auch die nominalistische Theologie ein, die sich nahtlos in das große Panorama des Wissens einfügte. So sehr für ihn bald das humanistische Erbe hinter die Botschaft des Glaubens zurücktreten sollte, blieb er der antiken Weisheit doch lebenslang treu. In vielen seiner Schriften berief er sich auf klassische Autoren, führte Äsopsche Tierfabeln an, bewunderte Juvenal für seine genaue Schilderung von Menschen, die unter ihrem Gewissen leiden, und bezeichnete Cicero gar als frommen Mann55. Noch zwei Tage vor seinem Tode nannte Luther die römischen Autoren Vergil und Cicero in einem Atemzug mit der Bibel und bezeichnete die Evangelien als göttliche Aeneis56.
Der 1505 erworbene Magistertitel, der zur Aufnahme des Jurastudiums berechtigte, markierte für Luther das Ende dieser Freiheit. An deren Stelle trat die Gewissheit, in absehbarer Zeit mit dem Doktorhut auf dem Kopf in die heimische Firma eintreten zu müssen, um »als Jurist das mühsam erworbene Vermögen der Familie sichern zu helfen«57. Dann konnte er seine Lieblingsautoren ins Feuer werfen und seine Laute an den Nagel hängen, um stattdessen schlaue Verträge zu entwerfen oder mit den händelsüchtigen Mansfelder Grafen zu streiten. Hans Luder war es nämlich gewohnt, seine Interessen wenn nötig vor dem Berggericht zu verfolgen. Für Martins humanistische Gelehrsamkeit würde kein Platz sein. Hier war nur Mensch, wer Geld verdiente.
Wer den Studiosus als »hurtigen und fröhlichen Gesellen« erlebt hatte, konnte in der Folge eine Eintrübung seiner Stimmungslage bemerken. Als er in Erfurt ein junger Magister war, so bekannte er später, sei er durch die Anfechtung der Traurigkeit immer traurig58 umhergegangen. Da der Pest, die von 1503 bis 1505 wütete, neben seinen Brüdern auch mehrere Kommilitonen zum Opfer fielen, wurde Martin von Depressionen heimgesucht. Zu allem Überfluss starb auch noch ein Freund, nach offizieller Version an einer »Lungenentzündung«, nach anderer an einem Stich in die Lunge, den er sich bei einem Degenduell zugezogen haben soll.59 Zwar sind keine Dokumente überliefert, doch wird von Luthers Tischgenossen Johann Mathesius bestätigt, dass ihm damals »ein guter Gesell erstochen wurde«.
Bereits im Vorjahr war Luther mit einer spitzen Waffe in schmerzhaften Kontakt gekommen. Kaum war er, vermutlich in den Osterferien 1504, zu seinen Eltern nach Mansfeld aufgebrochen, als ihm bei der Ortschaft Stotternheim die Spitze des eigenen Degens in den Schenkel drang. Ein Kommilitone, der ihn begleitete, holte eilig aus dem nahen Erfurt einen Chirurgen zu Hilfe. Obwohl Martin die Arterie abzudrücken versuchte, quoll das Blut immer weiter aus dem anschwellenden Schenkel. Mit vereinten Kräften trug man ihn zum Studentenwohnheim zurück. Die Wochen der Genesung, die er auf seiner Stube verbringen musste, nutzte er zum gründlichen Erlernen der Laute.
Zur düsteren Zukunftsaussicht kam sein Missfallen am Gesetzesstudium, bei dem stures Einpauken wie in Mansfeld nötig war. Auf der Suche nach Ablenkung oder Trost stieß er in der Universitätsbibliothek auf eine Bibel. Das war Neuland für ihn. Denn trotz seiner zwanzig Jahre, so bekannte er, hatte ich noch keine gesehen.60 Die Beschäftigung mit den heiligen Texten galt nämlich als Privileg der Geistlichkeit. Noch als Mönch wurde ihm von der Lektüre abgeraten. »Ei, Bruder Martinus«, warnte ein Theologieprofessor, »man soll die alten Lehrer lesen, die haben den Saft der Wahrheit aus der Bibel gesogen«.61
Zufällig hatte er das Buch gefunden, zufällig schlug er es an einer Stelle auf, in der es um die plötzliche Rettung aus einer Notlage ging. Die unglückliche Hanna, die ihr Leben lang unfruchtbar gewesen war, hatte wider jede Wahrscheinlichkeit durch Gottes Hilfe einen Sohn, den Propheten Samuel, geboren. Ihr Dankpsalm an den Gott, der das Unglaubliche möglich machte, musste in Martins Ohren geklungen haben, als wäre er direkt an ihn adressiert: »Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab in die Hölle und wieder heraus.« Wunderbar gefiel mir das Buch, erzählte er später, und ich meinte, ich würde glücklich sein, wenn ich einmal ein solches Buch haben könnte.62
Kaum hatte Martin sechs deprimierende Wochen Jurisprudenz absolviert, als er, vermutlich durch einen Brief des Vaters, nach Mansfeld zitiert wurde. Da er seiner Gehorsamspflicht nachzukommen hatte, dürfte er sein Bündel höchst widerwillig geschnürt haben. Den Grund, wenn er nicht schon im Brief offengelegt war, konnte Martin ahnen. Das Ende seiner Ausbildung war absehbar, und Hans Luder hatte sich nach einer Braut für ihn umgesehen. Offenbar war er fündig geworden. Zwei Jahre vor seinem Tod erwähnte Luther im selben Zusammenhang eine fromme Jungfer63, die der Hüttenmeister für ihn vorgesehen hatte. Deine Absicht war es sogar, schrieb er dem Vater als Mönch, mich durch eine ehrenvolle und reiche Heirat zu fesseln.64
Der designierte Bräutigam blieb ein paar Tage im Vaterhaus, wo er vermutlich mit der Braut zusammengeführt wurde. Am 2. Juli 1505, dem Tag Mariä Heimsuchung, begab Luther sich zu Fuß auf den neunzig Kilometer langen Rückweg. Schon fast am Ziel, näherte er sich jener Stelle bei Stotternheim, an der ihm im Vorjahr das Malheur mit dem Degen passiert war.
Ausgerechnet hier, nicht weit vom Galgenhügel, brach ein ziemlich heftiges Gewitter los. Der ganze Himmel kracht, die Erde erzittert, so beschrieb er später das Wetterphänomen, und alles ist am Zusammenfallen, dass selbst die Hölle sich öffnet und uns verschlingen will. Dieses Gefühl ist in unserem Herzen, jene entsetzlichen Geräusche und schrecklichen Erscheinungen hören und sehen wir.65
Er hörte und sah, und zu allem Überfluss schlug ein Blitz neben ihm ein, der ihn zu Boden warf. Vor Schrecken und Angst vor einem plötzlichen Tode66, so berichtete der Reformator, drang ihm ein Stoßgebet über die Lippen. Hilf du, St. Anna, schrie er in den Donner hinein, nicht ohne das gefährliche Versprechen hinzuzufügen: Ich will ein Mönch werden.67
Als der Sturm sich verzogen hatte, konnte er beruhigt feststellen, dass er unverletzt geblieben war. Außerdem kam ihm zu Bewusstsein, dass in seinem Leben nichts mehr sein würde wie zuvor. Von väterlicher Gängelung, von Jurastudium und Zwangsheirat konnte nicht mehr die Rede sein. Nach Erfurt zurückgekehrt, verschenkte er seine Habseligkeiten und verkaufte seine juristischen Bücher. Er brauchte sie nicht mehr. Mit einem Schlag, so schien es, waren all seine Probleme gelöst.
KAPITEL ZWEI
IM FEGEFEUER
Ich dachte, wir hätten den Teufel allein in den Klöstern.68
1. Zwischen Teufelsspuk und Himmelsgnade
Der Blitz von Stotternheim war nicht nur in Luthers Leben, sondern auch in die Weltgeschichte eingeschlagen. So zumindest sah es der Philosoph Hegel, bekennender Lutheraner und Vordenker von Karl Marx. In der gewaltsamen Entladung, die vernichtet und zugleich erleuchtet, erblickte er das Urbild jeder Revolution: Nachdem die alte Welt »allmählich zerbröckelt« ist, tritt die Verwandlung schlagartig ein. »Ein Blitz« leuchtet auf, der mit »einem Male das Gebilde der neuen Welt hinstellt.«69
Noch war davon für Martin nichts zu sehen. Im Gegenteil, sein Gelübde hatte ihn an die alte Welt zurückverwiesen, in der schon der bloße Gedanke an Reformation zum Tod bei lebendigem Leib führen konnte. Derlei hatte ihm, wenn auch in milderer Form, bei einem Leben in Vaters Schatten gedroht. Solange ihn das Mönchsdasein von dieser trüben Aussicht befreite, sollte ihm alles recht sein.
Das entscheidende Problem, ob Hans Luder oder er selbst über seine Zukunft bestimmen konnte, hatte sich wie von selbst gelöst. Doch blieben Fragen: Wie etwa würde der düpierte Bergwerksherr reagieren? Und warum hatte Martin bei jenem welthistorischen Donnerschlag nicht Gottvater oder Maria zu Hilfe gerufen, sondern deren Mutter, die in der Bibel gar nicht vorkam?
Die Antwort auf die erste Frage würde nicht lange auf sich warten lassen. Und was die Nothelferin Anna betraf, so hatte ihm nicht der Glaube die Worte in den Mund gelegt, sondern die Mode der Zeit. Die heilige Anna, von der man kaum mehr wusste, als dass sie heilig war, stand damals im Zenit ihrer Popularität. Zu ihren Ehren wurden Feste gefeiert und Wallfahrten veranstaltet, Mädchen, Kirchen und Ortschaften benannt. Einer neu gegründeten Bergbaustadt verlieh Herzog Georg von Sachsen den Ehrentitel Annaberg. Und Friedrich der Weise, Luthers Kurfürst, führte den Annentag als hohes Fest ein, mit allerhöchstem Segen von Papst AlexanderVI. Zum Zeichen seiner Verehrung der Heiligen ließ Friedrich Silbermünzen mit jenem gläubigen Stoßseufzer »Hilf, Sancta Anna!«70prägen, der auch über Luthers Lippen gekommen war.
Bergbau schien Annas Spezialgebiet zu sein. Auch in Mansfeld, wo die Luders schürften, schworen die Knappen auf ihre schützende Hand. Annas heilbringenden Daumen präsentierte Kurfürst Friedrich, der eine Schwäche für die nebulose Heilige hatte, in seiner Wittenberger Reliquienschau. Der fromme Sammler hatte ihn 1493 von einer Pilgerfahrt ins Heilige Land mitgebracht.
Hans Luders Antwort auf die zweite Frage kam prompt. Selbst wie vom Blitz getroffen, reagierte er, so Luther im Rückblick, toll und töricht. Dem ungehorsamen Sohn schrieb er einen bösen Brief71, in dem er das Tischtuch zwischen ihnen zerschnitt. Schon immer hatte er das Mönchtum für »eitel Gleisnerei und Buberei« gehalten. Dass sein Ältester sich dieser Bande anschließen wollte, war für ihn ein unerträglicher Gedanke. Das ominöse Gewitter erklärte er auf seine Weise: Mit dem in Sachen Höllenspuk erfahrenen Auge des Bergmanns glaubte er zu erkennen, dass dieser Blitz nicht von Gott gekommen war, sondern von dessen dämonischem Widersacher.
Ob Martins Entschluss, auf ewig hinter grauen Mauern zu verschwinden, auf himmlisches oder teuflisches Eingreifen zurückzuführen war, konnte der Studienabbrecher selbst nicht mit Gewissheit sagen. Streng genommen war ihm gar keine Wahl geblieben. Er ging ja nicht aus freien Stücken ins Kloster, sondern weil ihm das Gelöbnis sozusagen herausgerutscht war. Im Augenblick des Todesschreckens, da war er sich sicher, hatte jemand ihm diese Entscheidung abgenommen.
Fragte sich nur, wer es gewesen war. Die Ungewissheit darüber trieb ihn jahrelang um: Diente sein Mönchsversprechen in Wahrheit allein dem, der ihn schlau dazu verleitet hatte, sich dem väterlichen Machtbereich zu entziehen? Waren Heiligenanrufung und Eintritt in die Möncherei lediglich eine Fortsetzung der einfallsreichen Versuche Satans gewesen, ihn zu fangen oder gleich umzubringen?72 Nicht nur Blitz und Donner, sondern auch die Anrufung der fragwürdigen Heiligen erschienen ihm nachträglich als Teufelswerk. Der Böse selbst also hatte ihn provoziert, reflexartig Anna anzurufen und ihr das Wunder seiner Errettung zuzuschreiben.
In diesem Detail steckte tatsächlich der Teufel. Denn sobald jemand gesund wird, sagte der Reformator später, so denken sie, dieser oder jener Heilige hat mir geholfen. Damit aber hätte der Teufel erlangt, was er mit seinen falschen Zeichen





























