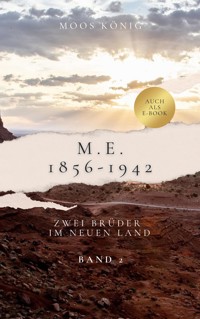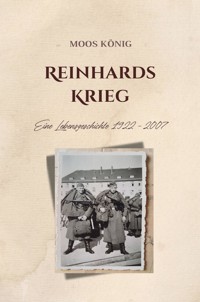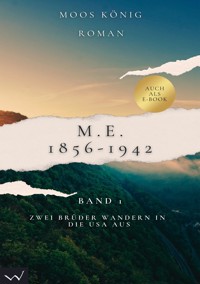
5,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: M.E.
- Sprache: Deutsch
Im Jahre 1856 wagen zwei Brüder aus Süddeutschland den mutigen Schritt, in die aufstrebenden USA auszuwandern. Ihre Reise beginnt mit der Wanderung nach Hamburg, wo sie hart arbeiten, um sich die Überfahrt auf einem Dampfschiff nach New York City zu verdienen. Doch die Ankunft in der Neuen Welt stellt sie vor unerwartete Herausforderungen und Gefahren. Das Buch beschreibt die fesselnde Lebensgeschichte von Martin Engel und seinem Bruder Reinhard - ein Abenteuer voller Spannung, Mut und Brüderlichkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Moos König, Anne Woeller
M.E. 1856 -1942
Zwei Brüder wandern in die USA aus Band 1
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1Erinnerungen
2Ein gut gelebtes Leben
3Es roch nach frisch gebackenem Apfelkuchen
4Charles Mayen – Ein Freund der Familie und eine schicksalhafte Begegnung
5Die Allgemeine Auswanderungszeitung
6Im Schatten des Aufbruchs
7Der Plan zur Auswanderung nach Amerika
8Das letzte Weihnachtsfest in der alten Heimat
9Der Aufbruch – Wir ziehen
10Zwei Wanderer
11Hamburg Hamburg
12Mit dem Dampfschiff nach New York
13Ankunft
14Neue Wege, alte Gewohnheiten
15Rückblick
16Vorschau M.E. 1856 – 1942: Band 2
17Danksagung des Autors Moos König
18Personen in diesem M.E.-Roman 1856 - 1942:
Impressum neobooks
1Erinnerungen
Alles Lebendige beginnt für sich, und doch ist es auf wunderbare Weise miteinander verflochten. Es trägt die stille Verbundenheit des Ganzen in sich, manchmal sichtbar, manchmal unsichtbar.
Manche Geschichten schlummern tief im Inneren und warten nur darauf, erzählt zu werden:
Mein Name ist Kristian Ari Collin Wells. Man nennt mich Collin. Ich bin der Enkel von Martin Engel, dessen Initialen M.E. diesem Buchtitel seinen Namen geben. Die Ereignisse dieses Buches trugen sich zwischen 1856 und 1942 zu. Mein Großvater, Martin Engel, wurde im Jahr 1840 im heutigen Deutschland geboren und verstarb im Alter von 102 Jahren in den Vereinigten Staaten. Er starb an einem kalten Wintertag im Jahre 1942. Die Monate vor dem Tod meines Großvaters verbrachten wir gemeinsam auf seiner Farm in Nebraska. Diese Farm erstreckt sich über 900 Acres und wird von mehreren Farmern bewirtschaftet. Ein großer Teil des Landes liegt unberührt. Die Vielfalt und die Schönheit der Gegend sind atemberaubend. Seen, Flüsse und Berge prägen das Gebiet. Mein Großvater erwarb dieses Land vor vielen Jahren, als es noch den Wilden Westen gab.
Mein Großvater war mit seinen 102 Jahren recht gesund. Er diskutierte mit mir über alles Mögliche und ich holte mir gerne und oft seinen Rat ein. Er ritt jeden Tag mit seinem Pferd hinaus und verbrachte viel Zeit in der Natur. Wenn mein Großvater im Jahre 1942 die Nachrichten in den Zeitungen las, schüttelte er oft den Kopf und sagte: »Was ist aus der Welt nur geworden? Wandel und Handel sollten die Welt antreiben. Nicht Krieg und Hass. Wann lernen die Menschen aus ihrer Geschichte?«
Eines Tages rief er mich zu sich und bat mich eine staubige, mit Eisen beschlagene Kiste aus der Garage zu holen. Als er sie öffnete, hatte er auf einmal einen völlig anderen Gesichtsausdruck. Selbst seine Körperhaltung war eine andere. Er war nicht mehr der alte Großvater, der mit seinem Enkel seine Zeit verbringen wollte. Er war auf einmal wieder der junge Martin Engel, so wie er die meiste Zeit durch das Leben gegangen war. Aufrecht, seine Stimme hatte mehr Gewicht und seine Augen waren wacher und klarer. Er fragte mich, ob ich wissen wollte, was er im Leben alles gesehen hatte. Damals, als es noch den Wilden Westen gab. Als man nicht nur aus Spaß mit seinem Pferd ritt und sich über die Eisenbahn als Wunder der Technik unterhielt. Ich bejahte natürlich. Und dann erzählte er mir seine Geschichte. Er zeigte mir seine alten, vergilbten Notizbücher. Die älteste Notiz stammt aus dem Jahr 1856. Zusätzlich überreichte er mir Briefe, die er erhalten oder nie abgeschickt hatte. »Es war ein gut gelebtes Leben«, hatte er immer wieder gesagt. Auf die Frage hin, was seine schönsten Augenblicke waren, sagte er: »Viele. Denn vielen Augenblicken liegt ein ganz bestimmter Zauber inne. Es liegt an dir, was du daraus machst. Wenn du aber wissen möchtest, woran ich gerne zurückdenke, mit meinen 102 Jahren auf dem Buckel, dann kann ich dir sagen, an euch Kinder. An die Menschen, an das Lachen meines Bruders, an die weite, unberührte Landschaft der Vereinigten Staaten. An den weiten Himmel. An das ewig fließende Wasser.«
Ich schrieb alles auf, was er mir erzählte. Er begann nicht, wie in einer üblichen Geschichte, mit geborenwurdeich, oder eswareinmal. Nein, er hatte seine Augen geschlossen und begann mit den Worten: »Ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich. Ich kann die weite Landschaft vor mir sehen, ich rieche das Gras, die Kräuter, die unbelastete, frische Luft. Ich spüre die Wärme der Sonne auf meinem Gesicht. Es war alles noch so rein, so unbeschwert. Ein unbeschwertes Leben. Wir waren so aufgeregt und freuten uns, wie kleine Kinder.«
Als Martin Engel und sein Bruder Reinhard 1856 nach Amerika kamen, fanden sie dort mehr oder weniger unberührte Natur vor. Nur wenige Gebiete waren besiedelt. Viele Siedlungen im Innern des Landes entstanden erst und wurden später zu großen Städten. Bevor die Ankömmlinge, die neuen Menschen, sich für immer niederließen, waren es dichte, undurchdringliche Wälder, reich an Tieren, weite, unendlich scheinende Graslandschaften und natürlich verlaufende Flüsse, die glitzernd, rein und voller Fische waren.
Dies ist die Geschichte von Martin Engel und seinem Bruder Reinhard. Die Geschichte ist in Romanform geschrieben. Als ich meinem Großvater das Manuskript zum Lesen gab, kommentierte er hin und wieder einige Stellen. Diese Kommentare habe ich ebenfalls in das Buch eingefügt. Sie sind kursiv und mit Anführungszeichen dargestellt:
»Ich denke gerne an mein Leben zurück. Auch an die nicht so schönen Stunden. Sind es doch diese, die uns die wahren Sonnenstunden schätzen lassen.«
2Ein gut gelebtes Leben
Martin saß im Zugwagen mit der Nummer 2. In der Luft lag ein Geruch von heißem Dampf, Öl und Rauch. Die hölzernen Bänke kamen ihm recht unbequem vor. Das Rumpeln und Ruckeln des Zugwagons schmerzten ihm in seinen alten Knochen. Hatte er doch die letzten Wochen damit verbracht, in Alaska Steine aufzulesen. Das viele Bücken hatte seinen Tribut verlangt, er war nicht mehr der Jüngste. Doch es hatte sich gelohnt. Man schrieb das Jahr 1916. Martin war 76 Jahre alt. In diesen Tagen fühlte er sich wie 100. In seinem Rücken zwickte es hin und wieder, seine Beine kamen ihm die letzten Tage schwerer vor als sonst.
Die große schwarze Dampflok stampfte voran und zog die Waggons Richtung ostamerikanische Küste, zurück nach New York City. Es waren nun über 60 Jahre vergangen, seitdem Martin und sein Bruder Reinhard nach Amerika kamen. Eine lange Zeit. Der Wilde Westen war erschlossen. Viele Menschen drangen bis in die entlegensten Winkel vor und das einst so freie Leben wurde mit Zäunen begrenzt, an denen ein Schild baumelte, mit der Aufschrift NO TRESPASSING – KEIN DURCHGANG. So fühlte Martin sich an diesem Tag, im Zugwagen Nr. 2. Er fühlte sich eingesperrt. Nach all den Jahren, die er durch das Land gestreift war, kam ihm die gegenwärtige Situation nicht nur wie das Ende des Wilden Westens vor, sondern auch wie sein eigenes.
'Nichts ist mehr, wie es einmal war', dachte Martin, während er aus dem Zugfenster die Landschaft betrachtete. Das Gras sah immer noch saftig grün aus. Doch es hatte sich etwas verändert. Die anfängliche Freiheit, das ungebundene Umherstreifen, die Unbeschwertheit waren eingeschränkt worden. 'Eingezäunt könnte man sagen', überlegte Martin. Ihm fehlte sein Bruder. Mehr, als er zugeben wollte. Um sich abzulenken, sah er sich um. Im Waggon saßen die unterschiedlichsten Menschen. Manche Damen hatten schicke Kleider an, mit passender Kopfbedeckung und Handschuhen. Die mitreisenden Herren waren nicht weniger elegant, mit feiner Weste und Hut. Andere waren schlicht gekleidet. Manche Kleidung war staubig und zeugte von einem längeren Marsch, bis sie die Eisenbahn erreicht hatten. Martin erinnerte sich an die Ankunft in New York City. Damals vor vielen, vielen Jahren. Da trugen die meisten europäische Mode. Wenn er sich jetzt umsah, sah er zwar auch die typischen Anzüge der betuchten Amerikaner, aber ohne europäische Melone oder Zylinder. Hier trug man einen eleganten, breitkrempigen Hut. Diese Hüte waren praktisch und schützten den Träger vor Wind, Sonne und Regen. Martin hatte sich für diese Reise extra weniger fein herausgeputzt. Er sah aus wie ein gewöhnlicher Mann, nicht arm und nicht reich. Nur sein Cowboyhut hätte verraten können, dass er gut betucht war. Der Hut war aus dem Unterhaar eines Biberfells gefertigt. Er war besonders warm, hielt dem Regen stand und selbst nach vielen Jahrzehnten war er immer noch ansehnlich. Zum Hut trug er ein beigefarbenes Hemd, braune Hosen und lange getragene und dadurch sehr bequeme Stiefel. Neben ihm lag ein einfacher Stoffbeutel. Diesen hatte er damals aus Deutschland mitgebracht. Nur der Inhalt hatte sich über all die Jahre verändert, so wie sich die Farbe seines Haares veränderte hatte. Auch Martin hatte sich verändert. Er hatte schneeweißes Haar bekommen, das an manchen Stellen unter seinem Hut hervor lugte. Seine Gesichtszüge waren vom Wetter gezeichnet, trotzdem war sein Blick weich und zufrieden. Seine braune Haut verriet, seinen häufigen Aufenthalt in der Sonne. Er war groß und selbst im Alter noch muskulös.
Der Zug hielt in Westland City. Eine kleine Stadt am Rande Kaliforniens. Auf dem Bahnsteig tummelten sich die Fahrgäste. Niemand wollte aussteigen. Alle wollten einsteigen. Eine junge Frau mit lilafarbenem, pompösem Kleid kam in den Waggon. In ihrer mit einem Handschuh bekleideten Hand hielt sie einen schwarzen Fächer, der mit lila Bändchen zu ihrem Kleid passte. Dazu trug sie einen Hut mit lila Feder, den sie auf ihre hochgesteckten Haare toupiert hatte. Martin erinnerte sich, wie er und sein Bruder Reinhard sich über solche Kleidung lustig gemacht hatten. Damals, ach es war schon so lange her. Wie unpraktisch solche Kleider waren. Martin erinnerte sich an die Worte Reinhards: ‚Die Dame hat bestimmt schon lange kein Pferd mehr gestriegelt.‘
Wie sehr vermisste Martin seinen Bruder. Als er an die Worte dachte, wurde ihm das Herz schwer und sein Blick fiel zu Boden. Die harten Schritte der Frau im lila Kleid ließen ihn wieder aufblicken. Hinter der Frau stakste ein Mann drein. Seinem Äußeren nach zu urteilen, war er ebenfalls vermögend. Während die Frau forsch und selbstsicher voranging, lief der Mann tollpatschig hinter ihr her. Er stieß an den Koffer eines Mitreisenden, entschuldigte sich eingehend, aber nicht, ohne den Reisenden darüber zu belehren, dass das Gepäck nicht im Gang stehen dürfe. Dann wandte er sich arrogant von ihm ab. Die Frau kam zielgerichtet auf Martin zu. Die Sitzbank ihm gegenüber war frei. Sie drehte sich vor der leeren Bank so rasch, dass ihr Kleid an Martins Beine schlug und er den schweren Stoff zu spüren bekam.
»Ich sehe, bei ihnen ist noch Platz!«, piepste die Dame mit einer unglaublich hohen Stimme.
»Ja«, antwortete Martin freundlich.
Sie setzte sich und hielt Blickkontakt mit Martin. Der Mann setzte sich neben sie.
»Wo reisen sie hin?«, fragte die lila Dame.
»Nach New York.«
Sie lachte und fächerte sich Luft zu. »Da haben sie ja noch eine weite Reise vor sich. Wir fahren nur nach Big City zurück.«
Sie musterte Martin und man sah ihre Neugier an der Nasenspitze an.
»Was machen sie in New York?«
Martin lächelte höflich, wohl war ihm allerdings nicht. »Ich besuche einen alten Freund«, sagte er so gelangweilt wie möglich, um das Gespräch nicht noch weiter führen zu müssen.
»Oh wie nett. Das haben wir in San Francisco gemacht. Sehr nettes Städtchen. Aber so weit weg. Diese Städte im Westen können sich nie mit denen im Osten vergleichen. Sie sind einfach zu weit draußen und nicht so bedeutsam wie die unseren.«
Sie wedelte leidenschaftlich mit ihrem Fächer und betrachtete dabei Martins Kleidung.
»Es ist heiß heute, nicht wahr? Sind sie ein Cowboy?«
Der Mann neben ihr berührte sie sanft am Arm und flüsterte: »Liebes, ich weiß nicht, ob der Mann an einem Gespräch über sein Cowboyleben interessiert ist. Es wird ihm durchaus peinlich sein.«
»Wieso sollte es mir peinlich sein?«
Der Mann räusperte sich, bevor er altklug zum Besten gab: »Nun ja, der Wilde Westen ist Vergangenheit. Die Großfabriken bestimmen die Neuzeit. Damit verdient man heutzutage sein Geld. Das Land ist erschlossen. Haben sie es gelesen? Die Viehhaltung ist nicht mehr rentabel. Wir blicken in eine grandiose Zukunft, die da heißt, Massenproduktion, kaufen und verkaufen. Massentierhaltung, anstelle vieler kleine Farmen und Möchtegern-Viehzüchter.«
Er klopfte sich dabei auf seine Weste, die aus feinem Stoff aufwändig gefertigt war. Martin wollte sagen: 'Du kleiner Hänfling. Was weißt du schon in deinen jungen Jahren? Außerdem reist man nicht mit solch teurem Gewand. Man weiß nie, wem man begegnet.'
Aber Martin lächelte nur, während er freundlich fragte: »Wie alt mögen sie wohl sein?«
»Ich bin 21«, sagte der Mann.
‚Der hat wohl die Weisheit mit Löffeln gefressen‘, dachte Martin, ‚mit 21 Jahren war ich nicht so überheblich den Älteren gegenüber. Und wenn er so gut betucht ist, wie er vorzugeben scheint, warum reist er dann nicht erster Klasse, sondern sitzt hier bei uns auf den harten Brettern?'
Die Frau lächelte Martin vergnügt an: »Oh bitte erzählen sie uns vom Leben als Cowboy. Ich stelle es mir romantisch vor, unter freiem Sternenhimmel zu nächtigen und die Präriewölfe in der Ferne jaulen zu hören. Haben sie Indianer getroffen? Zu welcher Farm gehörten sie? War es eine bekannte und war diese groß? Lebten sie ihr ganzes Leben in Kalifornien? Oh, sie hatten bestimmt ein aufregendes Leben! Haben sie viele Indianer gesehen?«
Ihre Stimme überschlug sich fast vor Neugierde und ihre Augen waren weit geöffnet. Martin schüttelte den Kopf, was ihre Begeisterung abrupt beendete. Er log: »Nein, ich habe keine Indianer gesehen. Wir waren nie weit draußen, immer nur in der Nähe der Farm.«
'Wenn die wüssten', dachte Martin, 'ja, wir haben Indianer gesehen. Ich gehörte zu keiner Farm, sondern die Farm gehörte zu mir und Kalifornien war nur eine weitere Station in meinem Leben.‘
Der Mann tippte sich wieder auf seine Weste, während er sagte: »Man verdient doch nichts als Farmer. Oder Farmarbeiter, wie sie es waren. Nehmen sie mir das bitte nicht übel, aber man sieht es ja an ihrer Kleidung.«
Martin lächelte zufrieden. Er hatte im Laufe seines Lebens gelernt, nicht allzu viel von sich preiszugeben.
'Wenn ihr wüsstet, dass ich die Taschen voller Gold habe.'
Aber ebenso wenig wusste Martin, was ihnen noch auf dieser Reise bevorstand. Der Zug sollte überfallen werden. Doch dieser Moment lag noch in der Zukunft. Jetzt sah Martin aus dem Fenster. Sie verließen den Bahnhof und fuhren weiter. Schnell hatten sie die Häuser und menschengemachte Landschaft hinter sich gelassen. Die Sonne tauchte das Land in die wunderbaren Farben, die es so einzigartig machten. Die Eisenbahn schien kerzengerade durch das kalifornische Land zu verlaufen. Hin und wieder sah Martin die typischen grünen Farbtupfer der Bäume und Büsche, die in rasantem Tempo an ihm vorbeihuschten. Langsam warf die Landschaft ihr kalifornisches Aussehen ab und verwandelte sich in das steinige Terrain von Arizona. Die grünen Farbtupfer wichen rotem Sand und felsigen Hügeln. Das Gold fiel in ein ausgetrocknetes Gelb und das Grün verwandelte sich in braune Sandtöne.
Die Luft im Zugwagen wurde spürbar heißer. Das Himmelsblau, das Martin in Kalifornien so liebte, wandelte sich in ein gleißendes Licht, das den Horizont flimmern ließ. Es roch immer mehr nach dem trockenen Staub der Wüste. Während sich in Kalifornien hohe, schlanke Palmen gen Himmel streckten, sah man hier die stacheligen Kakteen, die mächtig und aufrecht aus dem kargen Boden wuchsen. Zu gerne hätte Martin an einem dieser großen Stachelpflanzen Halt gemacht, um sie aus der Nähe zu betrachten. Oh, er vermisste die langen Ausritte mit seinem Pferd. Er vermisste es mit der Natur verbunden zu sein, sie anzufassen, sie zu begreifen. Die Eisenbahn erlaubte keinen Halt, um sich einen Kaktus anzusehen. Unbeeindruckt stampfte sie vorwärts und zog die Wagen hinter sich her.
Die Worte der Frau »...sie hatten bestimmt ein aufregendes Leben«, hallten in Martins Kopf nach. 'Ja, das hatte ich', dachte Martin und nickte innerlich. Die Weite der Gegend öffnete Martins Herz und er erinnerte sich, wie alles angefangen hatte. Er kniff die Augen zusammen, um den Gedanken festzuhalten. Er erinnerte sich an den Geruch und an das Geräusch der Ofentür. Seine Mutter stand davor und lächelte ihn an. Es roch nach Zimt und frisch gebackenen Plätzchen. Es war Weihnachten. Auch wenn schon viele Jahrzehnte ins Land gegangen waren, das Gesicht seiner Mutter sah Martin klar und deutlich vor sich. Ihre blauen Augen strahlten, ihr Mund schmunzelte und wie eh und je zauberte diese Erinnerung ein Lächeln in Martins Gesicht.
3Es roch nach frisch gebackenem Apfelkuchen
Martin und Reinhard waren die mittleren Kinder des Bürgermeisters Gustav Engel, der mit seiner Frau, zwei Bediensteten und der Kinderschar in einem schönen, großen Haus am Rande des Dorfes wohnte. Der Vater war Bürgermeister einer 1135 Seelen Gemeinde im damaligen Königreich Württemberg. Vom Dorf aus konnte man auf die drei Kaiserberge und die Schwäbische Alb blicken. Um das Haus herum standen unzählige Apfel-, Kirsch-, Mirabellen- und Birnbäume, die jedes Jahr eine prachtvolle Blütenpracht präsentierten und reichlich Früchte trugen.
Der Erstgeborene der Familie, Hans-Christian, nahm seine Rolle als solcher sehr ernst. Er hielt besonders die beiden Jüngsten, Trudchen und Gustav, beisammen und gab den Ton an. Diesen Ton durchbrachen Martin und Reinhard des Öfteren. Sie waren die Lausbuben der Familie. Ständig waren sie irgendwo unterwegs. Am liebsten hielten sie sich auf dem Bauernhof der Familie Seybolt auf. Es war ein großer Hof mit Kühen, Hühnern, zwei Pferden und vielen Schafen, die die typische Heidelandschaft der Schwäbischen Alb abgrasten. Der Knecht Herr Ettinger, liebte die beiden Jungs wie seine eigenen Söhne und freute sich, wenn sie auf den Hof kamen. Er brachte ihnen bei, was man als Bauer wissen musste. Wenn die beiden Brüder nicht dort waren, waren sie auf dem Grünenberg in der Gastwirtschaft oder in der Brauerei Zum Adler inSüßenund halfen dort aus. Nach der Meinung ihres Vaters hatten sie nur Unfug im Sinn. Wie oft schüttelte er seinen Kopf über die beiden. Wenn er es tat, dann stets mit einem versteckten Lächeln. Denn so kannte und liebte er seine Kinder. Insgeheim bewunderte und beneidete er die beiden, denn ihr Leben war voller Abenteuer, ihr Geist war frei und kannte keine Grenzen.
»Es gibt nichts, was die beiden nicht können«, hatte einst ihre ältere Schwester Margarete gesagt.
Die beiden Brüder waren von Anbeginn unzertrennlich. Martin war anderthalb Jahre älter als Reinhard. Seine Statur war groß und kräftig. Braune, wache Augen schauten unter einem dunkelbraunen Haarschopf hervor. Voller Güte und innerer Zufriedenheit blickte er in die Welt. Seine Handlungen waren stets überlegt, während seine Bewegungen trotz der großen Gestalt Freundlichkeit und Anstand ausstrahlten. Bislang hatten ihm seine Größe und seine Gutmütigkeit den Sieg in jeglichen Streitereien eingetragen. Reinhard war etwas kleiner und zierlicher, aber immer noch groß gewachsen. Sein Gesicht war scharf geschnitten, charmant und in seinen großen, blauen Augen lag ein Leuchten, wenn er von den Dingen erzählte, die ihn begeisterten. Wenn er Beschäftigungen zu erledigen hatte, die ihm nicht gefielen, konnten diese Augen scharfe Blitze abfeuern und sein Gesicht wurde tiefrot. Reinhard hatte blondes Haar, das er an den Seiten etwas kürzer trug. Ihm sagte man nach, er sei der Fantasievollere von beiden. Seine Neugierde und seine manchmal nachlässige Art brachten ihn immer wieder Stubenarrest ein und bescherte ihm eine Schelte der Eltern: »Man wirft keine Steine über das Hausdach, nur um zu sehen, wie hoch man werfen kann, Reinhard!«, hatte die Mutter ihn geschimpft.
»Wer das Pferd ärgert, der darf sich nicht wundern, wenn es einen beißt!«, rüffelte der Vater.
»Ich habe es nicht geärgert, ich wollte nur wissen, wie hoch es seinen Kopf heben kann.«
Schon als kleine Buben waren sie im Dorf wohl bekannt und gerne gesehen. Wenn sie gefragt wurden: »Was hat es für eine Bewandtnis mit eurem Treiben?«, bekam man stets die Antwort: »Wir sind in geheimer Mission unterwegs.«
Trotz aller Scherereien und des kindlichen Unfugs hatte man die Engel-Buben doch sehr gerne und ließ ihnen den einen oder anderen Streich durchgehen.
»Wenn ihr fertig seid, Römer spielen, dann lasst die armen Hunde wieder frei und nehmt ihnen die Umhänge ab!«
Vater Engel bestand stets auf gute Schulnoten und die Förderung der Kreativität. Er unterrichtete seine Kinder selbst in Kalligraphie, sprach hin und wieder Französisch mit ihnen, lud Gäste aus verschiedenen Regionen ein, um seinem Nachwuchs eine Welt außerhalb des Dorfes zu zeigen. Was er allerdings mit dem Besuch des Händlers Charles Mayen aus England anrichtete würde, hatte er nicht ahnen können.
4Charles Mayen – Ein Freund der Familie und eine schicksalhafte Begegnung
Manche Menschen spielen im Leben eines anderen eine wichtige Rolle. Sie sind maßgeblich am Lauf der Dinge beteiligt. Sie können Charaktere beeinflussen, dem Lebensweg eine Richtung weisen oder Hoffnung verbreiten. Hoffnung, die über einem neu entdeckten Horizont aufblüht. Für Reinhard und Martin war Charles Mayen so ein Mensch. Er kam aus Manchester in England. Er war im Handel tätig und gut betucht. Er war stets herrschaftlich gekleidet, hatte einen aufrechten Gang, wache blaugrüne Augen, eine sehr helle Haut, wie es sich für einen Briten gehörte und rotbraunes Haar. Er brachte besonders gut schmeckenden Tee mit, exotische Gewürze und aß sein Essen gerne zwischen zwei dicken Brotscheiben. Er nannte es Sandwich, nach dem vierten Earl von Sandwich John Montagu. Charles Mayen war im ganzen Dorf beliebt, da er stets höflich und spendabel war. Woher sich Gustav Engel und Charles Mayen kannten, wusste niemand. Anscheinend waren sie irgendwie miteinander verwandt. Gewiss war Charles Mayen ein Magnet für die Kinder. Reinhard faszinierte die englische Sprache. Martin musste sie, wie all seine anderen Geschwister, ebenfalls lernen. Wenn Mr. Mayen zu Besuch kam, blieb er meistens mehrere Wochen. Reinhard und Martin hörten gebannt zu, wenn die beiden Erwachsenen Englisch sprachen. Sie unterhielten sich bei jedem Besuch über die Ehe des Prinzen Albert von Sachsen-Coburg und Gotha mit der britischen Königin Victoria. Friedrich Wilhelm der IV. sorgte immer für Gesprächsstoff und ein besonders diskutables Thema war die Neue Welt, Amerika. Sie sprachen über den Mexikanisch-Amerikanischen Krieg und von der Tragödie des George Donner: »Stell dir vor Gustav, wie es gewesen sein muss: Als Führer des Trecks mit rund 87 Siedlern, die alle ein besseres Leben in der Neuen Welt erhofften und alles ging schief.«
»Vorbereitung, mein lieber Charles. Vorbereitung ist alles.«
»Ja aber, Gustav. Wenn du nicht weißt, worauf du dich vorbereiten sollst? Winter? Sommer? Schnee? Hitze? Denke an die vielen giftigen Tiere, die es dort gibt. Tiere die wir noch nie gesehen haben. Auf die man nicht vorbereitet sein kann, die man vielleicht auch nicht sieht, weil man so etwas noch nie gesehen hat!«
»Deswegen ist es so wichtig, sich vorzubereiten. Warum sind sie gleich mit ihren Familien losgezogen und haben nicht erst zwei leicht berittene Späher vorausgeschickt, um den Weg auszukundschaften? Dann wären nicht so viele ums Leben gekommen.«
»Aber hatten sie das nicht? Sie folgten doch dem California Trail oder dem Hastings Cutoff. Blind gingen sie nicht los.«
»Sie hatten vor Hunger ihre Schuhe gegessen. Und später, na du weißt schon«, sagte er und deutete auf die Kinder.