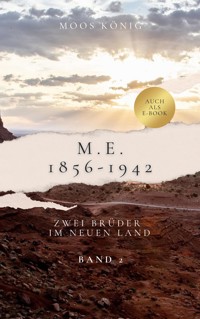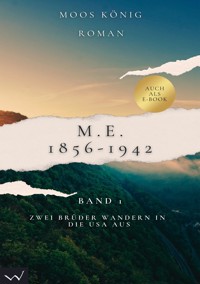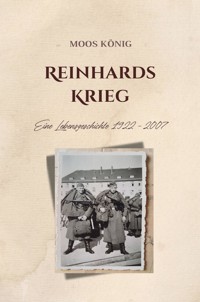
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1922: Reinhard Engel wächst in einer Zeit voller Spannungen und Möglichkeiten auf. Er erlebt, wie sich die Welt um ihn langsam verdunkelt. 1939: Als der Krieg kommt, meint er, keine Wahl zu haben. Was macht der Krieg aus einem Menschen, der eigentlich nur leben wollte? 1945: Auf der Flucht durch ein zerstörtes Land findet er einen kleinen Jungen, allein und verängstigt. Er wird zu seinem Beschützer. Nicht aus Pflicht, sondern aus Menschlichkeit. Ein zutiefst bewegender Roman über Schuld, Verantwortung und die Kraft des Menschlichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Moos König
Reinhards Krieg
Eine Lebensgeschichte 1922 - 2007
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1Ein Kind in kalter Nacht
2Hitlerjugend
3Das kleine Mädchen namens Thorra
4Vom Gerücht zur Last
5Die Frau im Wald
6Jenseits der deutschen Grenzen
7Zurück in Gorsleben
8Reinhard geht
9Reinhards neues Leben
10Aufbruch. Wir ziehen!
11Winter 1940 – In der Nähe von Zwittau
12Die Fahrt nach Russland
13Briefe und Tagebücher
14Der Krieg ist vorbei
15Irgendwo auf dem Weg von Russland nach Deutschland
16Martins Alpträume
17Reinhard und Martin – Zurück in Gorsleben
18Trümmer in Landshut
19Der Almhof von Marie Springfeld
20Die Jahre nach dem Krieg
21Frankreich
22Erinnerungen
23Die Jahre vergingen
24Der Anfang vom Ende
25Nachwort des Verlags
26Nachwort des Autors
Impressum neobooks
1Ein Kind in kalter Nacht
Im Januar 1927 war es klirrend kalt. Der Mond hing wie eine bleiche Eisscheibe am sternenklaren Himmel. Der Schnee auf den Feldern glitzerte im fahlen Licht und durchbrach die tiefe Dunkelheit. Reinhard war damals fünf Jahre alt. Er stapfte durch den Schnee und zog dabei einen Strick hinter sich her, an dem ein störrisches Pferd ging. Von zu Hause war er weggelaufen. Die Kälte drang durch seine dünne Kleidung und ließ ihn zittern. Obwohl das Pferd sich immer wieder umdrehte, stehen blieb und eindeutig nicht mit ihm mitgehen wollte, betrachtete er es als seinen einzigen Freund. Immer wieder zog Reinhard an dem Strick und versuchte, das Pferd zu überreden, mit ihm zu kommen. Doch dann riss es den Kopf so hoch, dass der Strick dem kleinen Jungen aus der Hand glitt. Das Pferd fühlte sich frei und trabte zurück zum Aussiedlerhof. Reinhard sah, wie es in der Dunkelheit verschwand. Er wollte nicht zurück. Nie wieder. Zu Hause lauerte die Angst, die panische Furcht vor seinem Vater. Sein Ziel in dieser Nacht war das Schulgebäude im Dorf. Dort fühlte er sich sicher, geborgen. Seine Mutter hatte durchgesetzt, dass er trotz seines jungen Alters bereits eingeschult wurde. Der Rektor, Herr Wöller, hatte eine Ausnahme gemacht. Nicht, weil der Junge besonders begabt war, sondern weil er wusste, dass er aus diesem Haus rausmusste. Die Nächte voller Schreie und unkontrollierbare Wutausbrüche seines Vaters und das tagelange Schweigen seiner Mutter. Ein Zuhause war das nicht mehr, schon gar kein sicherer Ort für ein Kind. Eigentlich durften Kinder erst mit sechs Jahren eingeschult werden. Aber Herr Wöller drückte ein Auge zu. Er ließ ihn am Unterricht teilnehmen, auch wenn Reinhard noch keine Prüfungen ablegen musste, durfte er dabei sein. Lernen. Ruhig atmen. In Sicherheit sein. So wandte sich der kleine Junge Richtung Dorf und stapfte unbeirrt durch den Schnee. Er ignorierte seine taub gefrorenen Zehen, die eiskalten Backen und Finger. Er lief einfach weiter. Ihm war es egal, ob er in dieser Nacht sterben würde oder nicht. Hauptsache weg von zu Hause. Während Reinhard durch die Nacht stapfte, wanderten seine Gedanken zurück an die Ursache seiner Flucht.
Als sein Vater 1919, ein Jahr nach Kriegsende, zurückgekehrt war, hatte seine Mutter ihn mit Freuden empfangen. Sie war überglücklich gewesen, ihren Mann wieder zu haben. Doch bald darauf musste sie erkennen, dass ihr Mann im Krieg geblieben war. Nur seine äußere Hülle war heimgekehrt. Selbst sein Gesicht war ein anderes. Er war ein Schatten seiner selbst geworden. Seine Bewegungen waren unruhig, hektisch, ebenso wie sein Blick. Wenn er jemanden ansah, erkannte man, dass seine Augen etwas sahen, das nicht zu ihm gehörte. Etwas, das er einst gesehen hatte und das immer noch in seiner Seele brannte. Die Angst hatte ihn ergriffen und nie wieder losgelassen. Der Krieg hatte nicht nur seinen Körper gezeichnet, sondern auch seine Seele zerfressen. Er blieb ein Gefangener seiner eigenen Gedanken, die sein Leben zur Hölle machten. Und das Leben aller um ihn herum. Bald hatte die Mutter ihren Sohn aus dem Haus verbannt. »Es ist sicherer für dich, wenn du im Pferdestall schläfst«, hatte sie ihm mit trauriger Miene erklärt. Selbst dort hörte Reinhard die Schreie seines Vaters in der Nacht. Sobald sich die Dunkelheit senkte, zündete sie etwas in Reinhards Vater. In seiner Verwirrung sprach er von Feinden. Er wollte sich verbarrikadieren, sich eingraben, suchte fieberhaft nach Waffen zur Verteidigung. Er schrie und heulte. Rief Namen seiner Kameraden. Mit zitterndem Körper und weit aufgerissenen Augen kämpfte er gegen unsichtbare Gegner, bis er tief in der Nacht vor Erschöpfung auf dem Boden einschlief. Wenn er am Morgen erwachte, lag er wie gelähmt da, unfähig seine Glieder zu bewegen, was seine Panik nur verstärkte. Er schrie nach Reinhards Mutter, die versuchte, ihn zu beruhigen. Doch die Last war zu schwer für sie alleine. Während ihr Mann im Haus mit seinen Dämonen kämpfte, musste sie dem Tagesgeschäft des Bauernhofes nachgehen. Alleine, erschöpft und ohne Aussicht auf bessere Zeiten.
In dieser verhängnisvollen Nacht hatten die Angstzustände seines Vaters einen neuen Höhepunkt erreicht. Reinhard hörte ihn schreien, doch diesmal näherten sich die schweren Schritte dem Pferdestall, in dem er kauerte. Plötzlich wurde die Türe aufgerissen und sein Vater stand im Rahmen. Das Gesicht war verzerrt: »Hab‘ ich dich!« Mit weit aufgerissenen Augen, in denen kein Erkennen lag, fixierte er Reinhard. Sein Atem ging schwer und hektisch, als er den kleinen Jungen am Kragen packte und mit sich zerrte. Reinhard fing an zu weinen und schrie verzweifelt nach seiner Mutter. Sie kam nicht. In seinem Wahn warf der Vater den fünfjährigen Jungen vor sich auf den Boden und versuchte, ihn zu treten, doch Reinhard rollte sich zur Seite. Er hörte sich selber schreien. Er wusste, dass er von hier weg musste. Sofort! Er nahm all seinen Mut und seine kindliche Kraft zusammen, rappelte sich auf und stürzte zurück in den schützenden Pferdestall. Panisch legte er dem Pferd das Halfter an, kletterte auf seinen Rücken und trieb es aus dem Stall. Aus dem Augenwinkel sah er seinen Vater, wie er mit bloßen Händen versuchte, ein Loch in den gefrorenen Boden zu graben. In seinem Kopf war er wieder im Schützengraben, suchte Deckung, schrie nach Kameraden. Das Pferd trabte in die Nacht hinaus. Der Weg ins Dorf war nicht weit. Seit einigen Wochen ging Reinhard jeden Wochentag diesen Weg alleine. Zur Schule. Weg vom Aussiedlerhof. Weg von diesem Mann, dessen Geist im Krieg geblieben war.
Reinhard stellte sich vor, wie man ihn am nächsten Morgen bei Tageslicht finden würde. Steifgefroren. Er malte sich aus, wie die Leute sagen: ‚Besser, als vom Vater erschlagen zu werden.‘ Ein Schauer durchlief ihn. Nicht nur wegen dieser düsteren Gedanken, sondern vor allem wegen der beißenden Kälte. Der Schnee knirschte und die kalte Luft brannte in seinen Lungen. Vor ihm lag das schlafende Dorf. Die Turmuhr der alten Kirche schlug fünf Uhr. Bis zum Schulbeginn waren es noch Stunden. Er würde warten müssen. Immer steifer frierend. Mit einem letzten Blick zurück sah Reinhard, wie das Mondlicht in den Fenstern des Hofes verblasste. Wie eine letzte Verbindung, die erlosch.
Die Steinstufen des Schulgebäudes waren eiskalt. Alles war kalt. Reinhards Körper zitterte wie Espenlaub. Alles fühlte sich stumpf an. Die Kälte hatte kein Erbarmen mit dem kleinen Kind. Seine Hände waren gefühllos und schmerzten gleichzeitig. Reinhard stellte sich an die Hauswand des gegenüberliegenden Gebäudes und betrachtete das Schulgebäude. Es war ganz aus Stein gebaut, mit einem Erdgeschoss und einem Dachgeschoss mit zwei Giebelfenstern. Unter dem Dach befand sich eine kleine Wohnung. Das Domizil des Schuldirektors Herrn Wöller. Reinhard bemerkte, wie sein Atem flacher wurde. Die eisige Luft schnitt in seine Lunge, als bestünde sie selbst aus scharfen Eiskristallen. Da sah Reinhard, wie sich hinter einem der Giebelfenster etwas bewegte. Dann nochmal. Sein Blick wurde zunehmend trüber, die Umrisse verschwammen immer mehr. Er trat ins fahle Mondlicht und versuchte zu erkennen, was er dort oben gesehen hatte. Dann hörte er, wie ein Fenster geöffnet wurde und die Stimme des Rektors sagte laut: »Reinhard! Das bist ja du!« Dies waren die letzten Worte, die er vernahm, bevor sein erschöpfter Körper bewusstlos in den Schnee sank. Herr Wöller eilte die Treppen hinunter und riss die Nebentüre an der Seite des Schulgebäudes auf. Barfuß und im Schlafanzug rannte er zu dem kleinen Kind, das reglos im Schnee lag. Behutsam hob er Reinhard auf und trug ihn ins Rektorzimmer. Dort kam der Junge rasch wieder zu sich. »Menschenskind Reinhard, was machst du denn hier? Du bist ja halb erfroren«, sagte der Rektor besorgt. Reinhard war so kalt, dass er nicht sprechen konnte. Herr Wöller setzte ihn auf das Sofa in seinem Arbeitszimmer, deckte ihn fürsorglich mit einem warmen Schaffell zu und entzündete ein Feuer im Kamin. Er zog den Kaminhaken zu sich heran und füllte den Topf mit Wasser. »Ich zünde dir ein Feuer. Das Wasser im Topf wird schnell warm sein, das trinkst du dann. Ich bringe noch mehr Decken von oben. Warte hier.« Reinhard sank tiefer in das Sofa und sein letzter Gedanke, bevor er vor Erschöpfung einschlief, war von einer tiefen Erleichterung getragen: »Jetzt bin ich sicher.«
Herr Wöller war ein großgewachsener Mann, geboren 1867. Als Reinhard zu ihm kam, war er 60 Jahre alt. Er besaß ein freundliches Gemüt, hatte sein Leben lang als Lehrer und Rektor in der Grundschule in Gorsleben gewirkt und war bei allen wegen seiner Gutmütigkeit sehr beliebt. Vor fünf Jahren war seine Frau gestorben. Gemeinsam hatten sie die Direktorwohnung im Schulgebäude bewohnt. Nun lebte er alleine dort und seine Frau fehlte ihm jeden Tag. Er liebte es, tiefsinnige Gespräche über Gott und die Welt zu führen, dabei überraschte er manche im Dorf mit seinen ungewöhnlichen Ansichten, konnte aber auch Widerspruch gut vertragen. Herr Wöller empfing von überall her viel Besuch und solche Disputationen dehnten sich oft bis weit über Mitternacht aus. Seine Gesprächspartner hatten sich nicht nur durch eine tüchtige Redseligkeit auszuzeichnen, sondern auch durch einen gewissen Verstand. Das trug dazu bei, ihm die Achtung und das Wohlwollen als Schulrektors zu erhalten. Erworben hatte er sich beides durch die gerade Ehrlichkeit, dazu sein Studium in Weimar und die freie Stelle des Rektors an der Grundschule. Obwohl er für gewöhnlich seine Gefühle vor der Welt verbarg, hatte sein täglicher Gang zum Grab seiner Frau, die Herzen jener erobert, die ihn sonst als zu gelehrt und unnahbar mieden.
Als Reinhard kurz erwachte, sah er, wie Herr Wöller an seinem großen, hölzernen Schreibtisch saß und im Schein einer Kerze etwas durchlas. Ihre Blicke trafen sich. »Ist dir wieder warm, mein Junge?«, fragte Herr Wöller mit väterlicher Stimme. Reinhard nickte. Tränen stiegen in seine Augen. Herr Wöller nickte verständnisvoll. Seine Augen strahlten eine tiefe Empathie aus. Es war ein urteilsfreier Blick. Sanft und hell, als ob er die Last des kleinen Jungen tragen wollte. Nicht nur das Feuer im Kamin und die Kerze auf dem Schreibtisch erfüllten den Raum mit Wärme. Es war auch die Präsenz des Herrn Wöller selbst, der mit einer tiefen Gelassenheit in der Stimme sagte: »Ruhe dich erstmal aus. Morgen sehen wir weiter.« Reinhards Ängste und Sorgen rückten für einen Moment in den Hintergrund und er schlief fast mit einem Lächeln im Gesicht wieder ein.
Es war sieben Uhr, als Reinhard erwachte. Herr Wöller saß nicht mehr an seinem Schreibtisch. Auf dem kleinen Sofatisch vor ihm bemerkte Reinhard ein Brett, über das ein sauberes Tuch gebreitet war. Darunter lagen ein Apfel und ein Butterbrot mit viel Butter. Daneben stand ein Glas Milch. Zusätzlich waren auf dem Tisch ein Füllfederhalter und ein neues Schreibheft fein säuberlich arrangiert. ‚Herr Wöller hat an alles gedacht‘, ging es Reinhard durch den Kopf. Doch dann erfüllte ihn ein bedrückendes Gefühl. Es war ihm peinlich. Was mochte Herr Wöller von ihm denken? Da ging die Türe langsam auf und Herr Wöller trat ein. In seiner Hand hatte er eine Strickjacke in Reinhards Größe. »Das müsste dir passen. Magst du mir helfen? Morgens, bevor die Kinder und Lehrer kommen, gehe ich durch alle Klassenräume und lege die Klassenbücher auf die Pulte. Dann schließe ich die große Haustüre auf.« Dankbar für die Aufgabe trug Reinhard die Klassenbücher, während Herr Wöller sie sorgsam auf den entsprechenden Pulten legte. Als sie die große Tür aufschlossen, sagte Herr Wöller: »Wenn du so weit bist, dann sagst du mir, warum du mitten in der Nacht vor der Schule standest. Aber erst, wenn du so weit bist.« Reinhard nickte, wieder erfüllt von Dankbarkeit. In den letzten Stunden war Dankbarkeit das vorherrschende Gefühl in ihm.
Als Herr Wöller am Nachmittag mit dem Fahrrad zum Aussiedlerhof fuhr, um Reinhards Mutter mitzuteilen, dass es ihrem Sohn gut ginge und er nicht erfroren sei, musste er verblüfft feststellen, dass sie Reinhards Verschwinden nicht einmal bemerkt hatte. Sie hatte sich nur über die offene Stalltüre gewundert, aber nicht weiter darüber nachgedacht. »Er schläft im Pferdestall, weil es dort für ihn sicherer ist«, erklärte sie nüchtern, »wie sie wissen, leidet mein Mann unter Granatenschock. Alles kann bei ihm Angst- und Wahnzustände auslösen. Da ist es besser, wenn der Junge nicht im Haus ist.« Herr Wöller nickte nur stumm. Seine Gedanken wanderten zurück zu seiner eigenen Zeit in diesem schrecklichen Krieg. Bilder der Vergangenheit schossen ihm durch den Kopf. Für einen kurzen Augenblick meinte er den Tod wieder riechen zu können. Der Geruch, den sie in den Schützengräben tagtäglich ertragen mussten: Ein Gemisch aus Metall, Schießpulver, verrottetem Fleisch und feuchtem Schlamm. Rasch schluckte Herr Wöller diese Erinnerung hinunter und konzentrierte sich auf die Frau vor ihm. Reinhards Mutter sah müde aus. Die Arbeit auf dem Hof, die Ängste und Sorgen um ihren Mann, hatten sie gezeichnet. Die Tatsache, dass sie nicht besonders besorgt um ihren Sohn schien, unterstrich ihre schwierige Situation und emotionale Erschöpfung. »Wie haben sie ihn gefunden?«, fragte sie dennoch nach einer Weile. »Ich wache zurzeit sehr früh auf und schaute aus dem Fenster. Da bemerkte ich einen Schatten an der gegenüberliegenden Hauswand. Erst dachte ich, der Nachbar sei ungewöhnlich früh unterwegs. Doch es ließ mir keine Ruhe und ich sah genauer hin. Da erkannte ich, dass es ein Kind sein musste. Erst als es in das Licht des Mondscheins trat, sah ich, dass es Reinhard war. Ich dachte mir schon, dass zu Hause etwas vorgefallen sein musste und er Reißaus genommen hat.«
»Es ist jede Nacht das Gleiche. Mein Mann wähnt sich im Krieg. Er will sich verbuddeln, sucht nach Waffen, schreit imaginäre Feinde an. Er rennt von einer Ecke in die andere. Bis zum Morgengrauen. Mit weit aufgerissenen, irren Augen. Dann schläft er erschöpft dort ein, wo er zuletzt kauerte.«
Mit traurigem Blick fragte sie Herrn Wöller: »Hört das irgendwann auf?« Herr Wöller schüttelte den Kopf: »Ich befürchte nein.«
»Sie waren doch auch im Krieg. Warum haben sie es nicht?«
»Ich weiß es nicht. Vielleicht täte es ihrem Mann gut, öfter zu uns ins Dorf zu kommen. Wir pflegen jeden Montagabend einen Stammtisch. Manchmal reden wir, manchmal schweigen wir. Beides tut gut.«
»Er sieht nicht mal mehr mich! Seine eigene Frau! Wie soll er dann euch erkennen? Auch wenn sein Blick auf mir ruht, scheint er durch mich hindurchzusehen.«
Herr Wöller presste leicht die Lippen aufeinander. Sein Blick schweifte kurz in die Ferne, bevor er wieder Reinhards Mutter direkt in die Augen sah: »Es wird nicht besser werden. Ich biete ihnen an, dass ihr Junge so oft er will, Herberge im Schulgebäude hat. Doch er sollte sich künftig rechtzeitig auf den Weg machen, bevor die Kälte ihm etwas anhaben kann.« Reinhards Mutter nickte. Sie wollte etwas erwidern, aber die aufsteigenden Tränen erstickten ihre Worte. »Es ist nicht ihre Schuld«, sagte Herr Wöller sanft. Dann stieg er auf sein Fahrrad und fuhr zurück ins Dorf.
Herr Wöller zeigte Reinhard, wo er einen Hausschlüssel für die hintere Tür versteckte. »Dieser Backstein ist lose und ich habe ihn etwas abgeschlagen, so dass er einen kleinen Hohlraum lässt. Da liegt der Schlüssel zum kleinen Eingang. Wenn du des Nachts im Rektorzimmer schlafen möchtest, aus welchen Gründen auch immer, weißt du jetzt, wie du hineinkommst. Du weißt, wie man ein Feuer im Kamin zündet und ich werde dir immer einen Topf mit Wasser am Kaminhaken hängen lassen, so hast du etwas zu trinken. Unter dem Sofa liegen Decken und Kissen. Wenn ich dir einen sicheren Schlafplatz schaffen kann, dann mache ich das gerne und ich möchte nicht, dass du dich zu Dankbarkeit verpflichtet fühlst. Der liebe Gott nennt dies Nächstenliebe. Man hilft, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Mein Arbeitstag beginnt um 7 Uhr morgens. Du kannst bis halb acht im Rektorzimmer bleiben. Dann kommen die Lehrer herein und melden sich für den Tag. Wir besprechen die Lehrziele für die Woche und organisieren den Unterricht. Um 8 Uhr sitzt du gewaschen und gekämmt an deinem Platz im Klassenzimmer, einverstanden?« Reinhard nickte. Er konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Er war froh. Froh einen Ort zu haben, wo er des Nachts sicher schlafen konnte. In Frieden, ohne Angst, sein Vater könnte ihn in einem Wahnzustand mit einem russischen Soldaten verwechseln oder das Pferd könnte aus Versehen auf ihn treten. Reinhard lächelte. Es war das unbeschwerte Lächeln eines Kindes, das endlich ein Stück zu Hause gefunden hatte.
Herr Wöller hatte Reinhard ein kleines Täschlein gegeben, das eine Zahnbürste, Zahnpulver und einen Kamm enthielt. Anfangs ging Reinhard nach der Schule noch auf den Aussiedlerhof. Bevor es dunkelte, machte er sich auf den Weg ins Dorf, zum Schulgebäude. Er schloss mit dem versteckten Schlüssel die Hintertür auf und legte sich im Rektorzimmer schlafen. Bald merkte Reinhard, dass seine Mutter ihn für die Arbeiten auf dem Hof kaum brauchte und so blieb er nach dem Unterricht gleich bei Herrn Wöller. Nachdem alle Kinder gegangen waren, legten die Lehrer die Klassentagebücher auf Herrn Wöllers Schreibtisch und verließen ebenfalls das Schulhaus. Herr Wöller nahm dann einen großen Besen zur Hand und kehrte das Schulgebäude aus. Danach schloss er die Klassenräume ab, sowie die große Eingangstüre und radelte mit seinem Fahrrad zum Friedhof, um das Grab seiner Frau zu besuchen. Das machte er jeden Tag. Seit Reinhard bei ihm war, half der kleine Junge, wo er konnte. Gemeinsam fegten sie die Räume aus. »Tüchtiges Bienchen«, lobte Herr Wöller stets mit einem warmen Lächeln, »früher hat meine Frau sauber gemacht. Seitdem sie gestorben ist, habe ich es übernommen. Es gibt mir das Gefühl, dass sie immer noch da ist. Weißt du, Reinhard, alles ist miteinander verbunden. Die Vergangenheit und auch die Zukunft. Manchmal können wir sie in bestimmten Augenblicken spüren, wohl aber nie greifen. Der einzig wahre Augenblick ist die Gegenwart. Die Zukunft ist das, was du daraus machst, während die Vergangenheit unsere Gefühlswelt erhellt und uns Orientierung gibt.«
So vergingen die Jahre. Während Reinhard im Rektorzimmer schlief, nächtigte Herr Wöller in seiner Wohnung unterm Dach. An Schultagen hatte Reinhard in der kalten Jahreszeit das Feuer im Kamin geschürt, Tee gekockt, die Kissen und Decken unter dem Schlafsofa ordentlich verstaut und jedes Mal saß Reinhard frisch gewaschen und gekämmt auf dem Sofa, wenn Herr Wöller die Türe zum Rektorzimmer öffnete. Wenn dieser sich dann an seinen Schreibtisch setzte und zu arbeiten begann, wartete Reinhard.
Eines Tages hatte Herr Wöller eine Überraschung für ihn: Einen eigenen Schreibtisch. Diesen stellten sie etwas abseits, neben dem großen Schreibtisch, vor die Wand, an der ein großes Bücherregal stand. Dort lernte Reinhard nicht nur, er hatte noch nie einen eigenen Schreibtisch gehabt und jedes Mal, wenn Herr Wöller Arbeiten korrigierte, durfte Reinhard ihm dabei helfen. So lernte er schnell das Lesen, Schreiben und Rechnen. Sein Lieblingsfach war Natur- und Heimatkunde. Er durfte sich jedes Buch ausleihen und er liebte es, wenn er und Herr Wöller sich darüber unterhielten. Herr Wöller bekam viel Post von anderen Schulrektoren, aber auch von Archäologen und Wissenschaftlern, mit denen er regen Austausch pflegte. Reinhard durfte die Post öffnen und vorlesen. Ein Herr Wamser schrieb ihm von einem Fund, den er als etwas Unglaubliches bezeichnete. Es waren Bruchstücke aus Knochen, die einen Löwenmenschen darstellten. Ein Fabelwesen, halb Mensch, halb Tier. Herr Wamser datierte diesen Fund in die Eiszeit. Leider könne er der Sache nicht weiter nachgehen. Die Fragmente sollten einem Museum zur Verfügung gestellt werden. Er hoffe aber sehr, dass jemand diese richtig beurteilen könne. Er fragte Herrn Wöller, ob er sich diese einmal anschauen könnte und zusätzlich habe er Zeichnungen davon an ihn geschickt. Herr Wöller wäre zu gerne auf die Schwäbische Alb gefahren, um die Originale zu sehen, denn schon die Zeichnungen der Knochenfragmente rührten etwas in ihm. Es war, als ob er diesen Löwenmenschen schon einmal gesehen hätte. Doch er tat es als Hirngespinst ab. Und dennoch hielt er sich die Möglichkeit offen, den Löwenmenschen eines Tages wieder zu sehen.
2Hitlerjugend
Im Januar 1936, Reinhard war vierzehn Jahre alt, bekam Herr Wöller Post. Darunter war ein Paket das ein eingerahmtes Bild des Führers enthielt. Dazu lagen Tischwimpel, Fahnenmastflaggen und Anstecknadeln mit Hakenkreuzemblem. Eine kurze Notiz informierte den Empfänger über die neue Bildverordnung, die besagte, dass alle öffentlichen Gebäude, einschließlich Schulen, mindestens ein Bild des Führers aufzuhängen hätten. Das Bild müsse an einem gut einsehbaren Ort angebracht werden. Die Hakenkreuzanstecknadeln sollten nach und nach als Belohnung an die Schüler verteilt werden. »Was weißt du über dieses Symbol?«, fragte Herr Wöller Reinhard, der an seinem Schreibtisch saß und neugierig in das Paket starrte. »Es ist das Parteizeichen der Nationalsozialisten.«
»Und? Sie haben es nicht erfunden. Sondern?«
Herr Wöller erklärte ihm, dass dieses Zeichen seit jeher von Menschen benutzt wurde. Es galt als Symbol der Sonne und stand für Fruchtbarkeit, Frieden, Glück. »Aber weißt du auch, was es für uns bedeutet? Für dich und mich? Was bedeutet es, wenn uns jemand ein Paket schnürt, mit all diesen Dingen darin?« Reinhard zuckte mit den Schultern. »Es ist umsonst, es ist ein Geschenk der Regierung.«
»Die Regierung verschenkt nichts, ohne Gegenleistung von irgendjemanden zu erwarten, Reinhard. Es ist das Zeichen staatlicher Autorität und Kontrolle. Ein Symbol der Macht und vor allem, ein Zeichen der Präsenz. Ich werde das Bild nicht aufhängen und die kleinen Anstecknadeln und Wimpel«, er überlegte, »ich stelle den Karton in die Eingangshalle, mit einem Zettel daran: Zu verschenken. Dann ist es nichts mehr Besonderes. Ich bin meiner Verpflichtung nachgekommen und habe es unter die Leute gebracht, aber als etwas Unscheinbares, das man in einer Kiste auf den Boden stellt, zum Verschenken.«
»Und das Bild des Führers?«
»Das stelle ich auf den Boden, an die Wand gelehnt, mit dem Gesicht nach unten. Wenn jemand kontrollieren kommt, sage ich, der Nagel ist aus der Wand gefallen.«
»Warum hängen sie es nicht einfach auf? Es schadet doch keinem. Es ist nur ein Bild. Ein Bild des obersten Befehlshabers unseres Landes. Ich finde es eine nette Geste, solche Bilder an Schulen zu schicken.«
Herr Wöller sah Reinhard direkt in die Augen. Mit väterlicher Stimme sagte er: »Nein, Reinhard. Das ist es nicht. Es ist Kontrolle. Eine Abfrage des Gehorsams.« Er strich mit den Fingern über den Bilderrahmen. »Für dich, mit deinen vierzehn Jahren mag es nur ein Bild sein. Eine Momentaufnahme. Vielleicht sogar ein Kunstwerk. Aber es ist ein Werkzeug.«
»Wie kann ein Bild ein Werkzeug sein?«, fragte Reinhard nachdenklich. »Diese Bilder werden nicht verschickt, um zu dokumentieren, oder um jeden zu zeigen, wie er aussieht. Es wurde gemacht, um zu steuern. Gefühle. Gedanken. Entscheidungen.«
Herr Wöller drehte den Bilderrahmen in seinen Händen, öffnete ihn, nahm die Fotografie heraus, drehte sie ins Licht, als könne er darin etwas erkennen, das andere übersahen. »Sie wissen genau was sie tun. Die Pose, der Blick, das ist nicht dem Zufall überlassen. Das ist kein Bild, auch kein Werkzeug. Das ist eine Waffe. Und wird es immer sein.«
Reinhard zögerte. Er betrachtete zusammen mit Herrn Wöller das Bild, den Bilderrahmen. Worte kreisten ihm durch den Kopf, aber er ließ sie unausgesprochen. Er sah, wie Ernst es Herrn Wöller war und obwohl Reinhard anderer Meinung war, geradezu überzeugt, dass ein Bild einfach nur ein Bild sein könne, eine nette Geste, schwieg er. Stattdessen lächelte er Herrn Wöller an. Dieses Lächeln bedeutete mehr Anerkennung für seinen väterlichen Freund, als Zustimmung. Herr Wöller öffnete einen weiteren Brief. Der Umschlag war dick, von jener steifen, leicht grauen Papierqualität, die Amtliches enthielt. Der Stempel des Reichsministeriums für Volksaufklärung prangte blutrot, in aller Deutlichkeit, in der linken oberen Ecke. Der Brief war mit Schreibmaschine geschrieben. Nach einer einleitenden Floskel über die Verantwortung der Schulen für das Wohlergehen der Jugend, folgte eine Liste mit den Büchern, die fortan aus dem Schulalltag verbannt werden mussten, weil sie als unrein, entartet oder zersetzend galten. Zeile um Zeile, mit Titel, Autoren und Erscheinungsjahr. Auf der Rückseite war eine zweite Liste, noch länger. Sie beschrieben Bücher, die ab sofort zum festen Bestandteil der Bildung zu gehören hatten. Es waren Bücher, die keine Fragen stellten, sondern Antworten diktierten. Herr Wöller atmete schwer durch, mit einem Seufzer sagte er: »Jetzt verbieten sie uns Bücher. So fängt es an, Reinhard. So fing es schon oft an, in der Geschichte der Menschheit!« Die letzten Worte sagte er etwas zu laut, als er eigentlich wollte. »Was fängt an?«, fragte Reinhard vorsichtig.
»Tyrannei! Eure Hitlerjugend, mit den Ausflügen, dem friedlichen Kräftemessen beim Sport, damit werdet ihr lediglich unterhalten. Positiv auf die Regierung gestimmt. Bei Laune gehalten. Dann reduzieren sie eure Bildung«, er deutete auf die Liste, die vor ihm auf dem Schreibtisch lag. Unscheinbar. Aber doch mit solcher Auswirkung, dass sie Herr Wöller verärgern konnte. »Sie kontrollieren das Wissen, eure Denkweise. Sie werden Nachrichten zensieren. Danach jede Form individueller Ausdrucksweise. Deswegen geben sie euch Uniformen.« Herr Wöller sah Reinhard lange an, sein Blick war weich, aber besorgt. Dann lehnte er sich vor, als wolle er ihm ein Geheimnis anvertrauen: »Es gibt Dinge im Leben, die du nicht kontrollieren kannst. Aber das, was du denkst, deine Gedanken, das ist dein alleiniger Besitz. Lass dir von niemandem vorschreiben, wie du die Welt siehst oder was die Wahrheit ist. Glaube nicht, dass du klein bist, nur weil du jung bist. Du bist ein kluger Junge. Nutze deine Gedanken, sie sind mächtig. Sei klug. Bilde dir deine eigene Meinung. Sei dir deiner Intelligenz bewusst. Nutze sie.«
Reinhard nickte und antwortete mit nur einem Wort: »Danke.« Es war mehr als Dankbarkeit. Es war ein Versprechen.
An diesem Tag kam Reinhards Mutter in das Dorf. Einmal die Woche ging sie in den Gemischtwarenladen der Familie Doser. Dort verkaufte sie Eier. Doch an diesem Tag begrüßte sie Frau Doser nicht freundlich, wie sonst, sondern rief sogleich ihren Mann herbei. Der betrachtete Reinhards Mutter mit einer Arroganz, dass sie nicht wusste, ob sie lachen oder weinen sollte. »Was wünschen sie?«, fragte er mit sonderbarer Stimme. »Was stellen sie mir für Fragen? Eier verkaufen! Wie immer.«
»Nun, da gibt es ein Problem.«
Stille.
»Ja was denn?«
»Das wissen sie genau!«
»Sie sprechen in Rätseln.«
Die Frau des Gemischtwarenhändlers sprach es direkt aus: »Wir kaufen keine Eier mehr von ihnen. Sie sind keine von uns. Sie gehören nicht dazu.«
Stille.
»Soll ich jetzt fragen warum oder erzählen sie mir es, ohne dass ich direkt nachfrage?«
»Wir wollen keine Geschäfte mit ihnen machen, da ihr Sohn sich nicht aktiv in der Hitlerjugend beteiligt!«
»Was habe ich mit der Gesinnung meines Sohnes zu tun? Wie sie wissen, wohnt er seit fast zehn Jahren nicht mehr bei uns. Er hat sich vor seinem Vater gerettet, er hat einen Granatenschock. Er war im großen Krieg. Er hat sein Vaterland verteidigt, kam zurück und war innerlich zerschossen. Reinhard war schon lange nicht mehr zu Hause. Was kann ich dafür, wenn er nicht aktiv werden will? Wenn sie jemanden dafür bestrafen wollen, dann gehen sie zu Herrn Wöller, er hat Einfluss auf den Jungen.«
»Herr Wöller ist zu wichtig für dieses Dorf, als dass man ihn zum Feind haben möchte.«
»Ach, und bei mir ist es wohl in Ordnung, wenn-.«
Sie wurde harsch unterbrochen: »Schleichen sie sich aus meinem Laden! Sie gehören nicht mehr zu uns! Nehmen sie ihre Eier mit! Wir kaufen sie nicht mehr!«
Reinhards Mutter ließ den Blick sinken, drehte sich um und verließ den Laden. Auf der Straße blieb sie stehen. Ihr war zum Heulen, aber sie wusste, dass dies ihr nicht helfen würde. ‚Später kann ich immer noch weinen, jetzt muss ich handeln. Irgendetwas tun. Nur was?‘, dachte sie. Da kam ein bekanntes Gesicht vorbei. Die Frau grüßte Reinhards Mutter freundlich: »Guten Tag, bringen sie dem Halsabschneider frische Eier? Wie viel gibt er ihnen eigentlich dafür? Der alte Gauner hat letzte Woche pro halbes Dutzend 90 Pfennige verlangt.« Da kam Reinhards Mutter die Idee: »Ich gebe ihnen ein halbes Dutzend für 72 Pfennige.«
»Da nehme ich doch gleich ein Ganzes.«
Eine weitere Frau hörte davon und kaufte drei Eier für 45 Pfennige. Das bekam Herr Doser mit und schalt Reinhards Mutter, dass sie keine Genehmigung hätte, Eier zu verkaufen. Doch die Frau neben ihr wusste es besser: »Natürlich hat sie die! Sie ist Bäuerin, sie kann ihre Produkte natürlich verkaufen!«
»Für wie viel verkauft sie das Stück?«
»15 Pfennige.«
»Dann verkaufe ich das Ei für 10 Pfennige!«
Er stellte ein Schild vor den Laden, auf dem stand:
Eier, halbes Dutzend 60 Pfennige.
»Tja, das nennt man wohl freie Marktwirtschaft«, sagte die Frau, zuckte mit den Schultern und ging ihres Weges. Reinhards Mutter setzte sich auf den Bordstein und wartete erst einmal ab. »Zehn Pfennige«, murmelte sie, »dass so ein Gauner einfach bestimmen darf, was ein Ei kostet. Gibt es da keine staatliche Vorgabe? Aber auch wenn, dann ist diese bestimmt nicht mir wohlgesonnen.« Da kam ihr eine weitere Idee. Ein alter Schulkamerad Reinhards kam des Weges. Sie hielt ihn an: »Tu mir bitte einen Gefallen. Sieh nach, wie viele Eier der Herr Doser noch übrig hat. Er verkauft diese zurzeit für 10 Pfennige. Hier gebe ich dir Geld. Davon kaufe so viele Eier wie möglich.« Der Junge tat ihr gerne den Gefallen und kam mit einem ganzen und einem halben Dutzend Eiern wieder. »Jetzt hat er keine mehr. Er war recht freundlich zu mir, dachte ich brauche die vielen Eier für ein Fest der Hitlerjugend. Hat mir einen guten Preis gemacht.« Reinhards Mutter nahm die Eier dankend entgegen und blieb vor dem Laden stehen. Sie legte die Eier in ihren Korb und rief laut: »Eier! Kauft Eier.« Die Leute hörten es und traten an sie heran. »Vierzehn Pfennige das Stück. Vierundachtzig Pfennige das halbe Dutzend.«
Die Leute kauften von ihr. Herr Doser kam wutentbrannt aus seinem Laden, als er begriff, dass der Eieraufkauf von ihr ausgegangen war. Er beschimpfte sie und versuchte die Leute davon abzubringen, bei ihr zu kaufen, doch die schüttelten nur die Köpfe und fragten, ob er noch bei Sinnen wäre. Wenn er keine Eier mehr hätte, seien sie froh, wenn sie überhaupt noch welche bekämen. Reinhards Mutter ging nicht weiter auf Herrn Doser ein, sie sagte nur: »Freie Marktwirtschaft! Vielleicht kaufen sie mir nächste Woche die Eier wieder selber ab, das erspart uns Arbeit!«
Die Hitlerjugend wurde in dem kleinen Dorf Gorsleben als eine paramilitärische Organisation geführt. Egal ob Junge oder Mädchen, jeder im Alter von zehn bis achtzehn Jahren war automatisch Mitglied. Spielerisch und doch hoch diszipliniert marschierten die Jungen in Uniform durch das Dorf. Sie übten sich in sportlichen Disziplinen, es gab Auszeichnungen, Ehrungen. Man sang Lieder zusammen, hörte sich Reden an, die lediglich darauf aus waren, Gehorsam einzutrichtern. Herr Wöller sprach mit Reinhard darüber: »Ich kenne das aus meiner Jugend. Es scheint für dich eine tolle Gemeinschaft Gleichgesinnter zu sein. Man vermittelt euch das Gefühl von Stolz und Dazugehörigkeit. Man unternimmt gemeinsame Dinge, fährt zusammen nach Weimar, geht ins Museum, hilft sich gegenseitig beim Holzmachen für den Winter oder beim Aussäen und der Ernte. Man suggeriert euch, dass ihr zusammen stark seid. Eine Gemeinschaft, die jeden Einzelnen schätzt und unterstützt.«
»Das sind wir ja auch«, pflichtete Reinhard bei. Herr Wöller lächelte ihn liebevoll an. »Ja Reinhard, das seid ihr untereinander. Aber nicht als Hitlerjugend. Ihr seid eine Gemeinschaft als Dorfjugend, als Menschen, als Brüder. Aber die Hitlerjugend hat einen bösen Sinn. Die wahre Intention ist, deren Ideologie zu verbreiten und junge Männer gehorsam zu machen. Ihr lernt, Befehle entgegenzunehmen. Ihr lernt, nicht zu hinterfragen. Ich gebe dir einen väterlichen Rat«, er räusperte sich, »hinterfrage! Hinterfrage alles. Sieh dir die Dinge aus verschiedenen Blickrichtungen an. Und frage dich immer, was ist die wahre Intention dahinter? Wer hat welche Interessen und wer hat die Macht, dir seine Interessen für die deinigen zu verkaufen.«
»Sind sie mir böse, dass ich mich seit Neuem aktiv in der Hitlerjugend engagiere?«
»Was genau machst du da?«
»Ich bin für den Teil der sportlichen Ertüchtigung verantwortlich gemacht worden. Das heißt, ich und zwei andere organisieren Märsche, Übungen und auch Wettkämpfe. Wir bekommen für die Gewinner tolle Abzeichen. Sogar Pokale. Jeder, der mitgemacht hat, bekommt eine Urkunde. Der Frank hat beim Speerwurf schon drei Mal gewonnen. Er bekam ein Ehrenschreiben und wurde sogar zu anderen Wettbewerben eingeladen, nach Weimar und sogar nach Berlin. Wir gehen regelmäßig zelten, auch das muss organisiert werden. Vor allem die Verpflegung für das Zeltlager. Ich habe ein Buch geschenkt bekommen, weil ich so gut organisieren kann. Aber das Buch gefiel mir nicht, deswegen habe ich es weiterverschenkt.«
»Reinhard, ich möchte, dass du weißt, dass ich besorgt bin, was diese Hitlerjugend angeht. Es geht dem Führer nicht darum, euch für euer Selbst stark zu machen. Ich verstehe dich sehr gut. Es ist das Dazugehörigkeitsgefühl, was euch antreibt. Übrigens eine der stärksten Eigenschaften bei Menschen. Das wissen die auch. Ich möchte an deine Vorsicht appellieren. Sei vorsichtig, wem du deine Loyalität schenkst. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Ihr seid noch so jung und der Einfluss von diesen Leuten ist so stark. Der wahre Wert eines Menschen wird nicht durch Auszeichnungen oder seinen Stand in der Gesellschaft bestimmt, sondern durch seine Menschlichkeit und seinen Mut, auch mal gegen den Strom zu schwimmen. Geh deinen Weg, mein Junge und behalte dir deinen scharfen Verstand und vor allem, behalte dir dein Mitgefühl. Das ist, was uns Menschen ausmacht. Ich habe den großen Krieg mitgemacht, von Anfang an, bis zum Ende. Wir wurden von Ideologien beeinflusst, die nicht der ganzen Wahrheit entsprachen. Du siehst deine Mitgliedschaft in der Hitlerjugend als unkritische Zugehörigkeit, mit Spiel, Spaß und jugendlichem Leichtsinn. Es ist aber eine Bewegung, die viele zerstörerische Kräfte in sich trägt.«
Reinhard sah ihn ernst an: »Mir ist ihre Meinung sehr wichtig und sie haben mir in den letzten Jahren so viel gegeben. Mehr, als ich je erhofft habe. Ich meine damit nicht nur ein Dach über den Kopf, zu essen, Schulbildung, sondern«, er räusperte sich, »sie waren auch immer ein Vorbild. Ich werde ihre Worte berücksichtigen.«
»Welche Worte hast du dir gemerkt?«
»Verschiedene Blickwinkel einnehmen, Menschlichkeit, Mitgefühl behalten. Sich überlegen, wer Vorteile ziehen könnte und die Macht hat, Dinge und einen selbst zu beeinflussen. Aber ich muss auch zugeben, dass die Fackelzüge etwas in uns junge Männer entzündet. Das Licht, die rhythmischen Marschschritte der Stiefel, die immer gleichen, gesungenen Lieder, all das hat eine fast magische Wirkung auf uns. Es gefällt uns. Wir sind Teil einer großen Sache, die sich, so wie sie uns vor Augen geführt wird, großartig anfühlt.«
Herr Wöller nickte leicht: »Sie leisten gute Arbeit. Gute Arbeit, in Sachen Verblendung. Mich bedrücken nicht die Lieder oder die Fackelzüge. Sondern die dunkle Vorahnung, ausgehend von der Abtötung des menschlichen Geistes durch Unterdrückung. Es gibt für diese Leute nur zwei Sorten von Menschen: Die, die dazugehören und die, die nicht dazugehören. Menschen, die niemanden an ihrer Seite dulden, außer denjenigen die bereit sind zu folgen, zu unterstützen oder schmierige Lakaien zu sein. Wer sich ihnen nähert, ohne die Bereitschaft, Unterwerfung zu zeigen, ist nicht willkommen. Im Weltbild der Hitlerjugend gibt es nur eine einzige richtige Haltung: Die der Gefolgschaft. Alles andere wird als Bedrohung oder Ungehorsam angesehen. Und das ist es, was die dunkle Ahnung nährt. Sei vorsichtig, Reinhard.«
3Das kleine Mädchen namens Thorra
Ein großer Lastwagen fuhr die Straße entlang. Es dämmerte schon. Die Sonne verabschiedete sich für diesen Tag mit einem fantastischen Farbenspiel am Himmel, aus lila und goldglänzenden Wolken. Der Fahrer des Lastwagens sah sich immer wieder nach diesem Sonnenuntergang um. In seinen Augen lag tiefe Abneigung für das, was sie auszuführen hatten. Doch er lenkte den Lastwagen die Landstraße entlang, hin zum kleinen Ort Gorsleben. Neben ihm saß ein etwa zwanzig Jahre alter junger Mann. In seinen Händen hielt er ein zusammengerolltes Blatt Papier. Immer wieder entrollte er es, vergewisserte sich noch einmal, nickte sich selbst zu und sah den Fahrer an. »Fünf von denen«, sagte er in einem Ton, der vorwurfsvoll klang. Abweisend, mit Hass erfüllt. Der Fahrer nickte nur. Er dachte daran, was diese Menschen jetzt wohl gerade in diesem Augenblick taten, nicht wissend, dass vier Uniformierte heute Abend kommen würden, um sie zu holen. Um sie zu holen, um sie zum Bahnhof zu fahren, zu übergeben. Das war ihr Befehl. An wen übergeben? An die anderen Soldaten auf dem Bahnsteig. Und dann? Der Fahrer beantwortete sich in seinen Gedanken die Frage selbst: Dann fahren sie mit dem Zug fünf Kilometer weit. Steigen aus, werden auf Wertsachen untersucht und danach erschossen. Vorher müssen sie noch ihre eigene Grube ausheben. Er habe gehört, dass sie nicht mal mehr einzelne Gräber ausheben ließen, sondern große Gruben. Massengräber. Die nächsten hätten sich nur an den Rand zu stellen und tot hineinzufallen. Das wäre nicht so zeitaufwändig und man würde Platz sparen. Der Fahrer biss sich auf die Lippe, bis er Blut schmeckte. Seine Gedanken wurden unterbrochen, als der junge Mann neben ihm sagte: »Eine Familie, Mann, Frau und zwei Kinder. Dazu ein altes Ehepaar.« Was sie wohl gerade in diesem Augenblick taten?
Das kleine Mädchen der Familie hieß Thorra. Sie war acht Jahre alt und ging in die Grundschule, an der Herr Wöller Rektor war. Thorra war sehr schlau, höflich, trug immer ein Lächeln im Gesicht und kümmerte sich um ihren fünf Jahre alten Bruder. In diesem Augenblick, als der Lastwagen die Landstraße hinauffuhr, saß Thorra mit ihren Eltern und dem Bruder am Esstisch und gemeinsam sprachen sie ein Gebet. Sie dankten für das gute Essen und wünschten sich und ihren Liebsten Gesundheit und Möglichkeiten. Thorra hatte die letzten Monate sehr intensiv erlebt. Sie wusste, dass ihre Eltern planten in die Vereinigten Staaten von Amerika auszuwandern. Unter den Dielen des Holzbodens, in einem Versteck, hatten sie Geld und Schmuck gesammelt, um die Überfahrt zu bezahlen. »Bremen oder Hamburg«, sagte ihr Vater zu ihrer Mutter, »ich weiß nur nicht, wie wir unbemerkt herausfinden können, wie wir am schnellsten dort hinkommen.«
»Vielleicht hat Herr Wöller ein Buch über die Landstraßen. Verbindungswege, zwischen den Städten«, erwiderte Thorras Mutter. »Eine Karte, meinst du, ja vielleicht. Er ist sehr bodenständig, dieser Herr Wöller. Und jeder weiß, wie er dem damals kleinen Reinhard geholfen hatte. Ich werde ihn morgen fragen. Heimlich. Er soll nicht mitkriegen, dass wir auswandern wollen. Ich werde ihm sagen, wir besuchen Verwandte. Wenn wir erstmal am Hafen sind, wo die großen Schiffe nach Amerika ablegen, dann haben wir es geschafft.«
»Ich atme erst durch, wenn wir deutschen Boden hinter uns lassen. Erst dann. Ich fürchte, es wird uns nicht gelingen.«
»Jetzt lass uns essen. Es ist reichlich für alle da. Dafür wollen wir dankbar sein. Thorra, erzähle uns: Wie war es heute in der Schule?«
Noch bevor Thorra antworten konnte, flog die Tür auf. Jemand hatte von außen mit einem Hammer dagegen geschlagen und die schwere Holztüre sprang aus den Angeln. Erschrocken und kreidebleich warfen sich die Eltern vor ihre Kinder. Die Mutter nahm den Sohn in ihre Arme, während der Vater sich schützend vor Thorra stellte. Ein paar Sekunden vergingen. Sekunden, die für die Erschrockenen unendlich lange vorkamen. Dann kam er herein. Der junge Mann, der eben noch auf dem Beifahrersitz des Lastwagens gesessen hatte, mit der Papierrolle in der Hand. Jetzt trat er ein, zog sich dabei Handschuhe über die Finger und sah sich um. Hinter ihm folgten zwei weitere Uniformierte. Der junge Mann grinste überheblich, als er in die erschrockenen Gesichter sah. Thorras Vater fand seine Stimme wieder. Er versuchte sie nicht zitternd klingen zu lassen: »Wie unhöflich!«, platzte es aus ihm lauter heraus, als er es eigentlich wollte, »was fällt ihnen ein meine Haustüre kaputt zu schlagen? Was wollen sie?«
Der junge Mann hatte inzwischen seine Handschuhe fertig angezogen und verschränkte die Hände auf dem Rücken. Seinen Blick ließ er über den gedeckten Tisch wandern. Die dampfenden Schüsseln, das fein säuberlich aufgedeckte Porzellan. Ein Bild voller Frieden. Wollte er nichts sagen? Konnte er nichts sagen? War es für ihn doch schwieriger den arroganten Beamten zu spielen, als er es zu geben wollte? »Da kommen wir doch genau richtig«, kam es ihm über die Lippen. Erst etwas hohl, dann räusperte er sich und sprach lauter: »Ihr Juden habt hier nichts mehr verloren. Ihr werdet enteignet. Vollständig enteignet.«