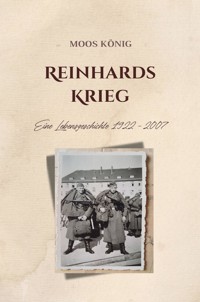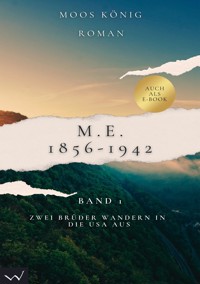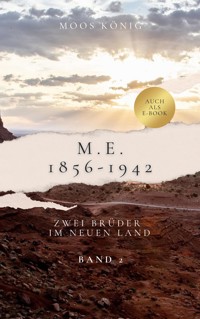
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Band 2
- Sprache: Deutsch
Die Vereinigten Staaten von Amerika, Mitte des 19. Jahrhunderts: Während sich Martin schnell in der puslierenden Stadt New York City zurechtfindet, kämpft Reinhard mit der Frage, was er in dieser neuen Welt anfangen soll. Doch das Schicksal nimmt unerwartete Wendungen. Der drohende Bürgerkrieg verändert das Leben der beiden Brüder. Sie machen sich auf in die damals noch unberührte Landschaft des Wilden Westens. Der Roman entführt die Leser in die ungezähmte Wildnis der jungen USA und beschreibt in eindrucksvollen Bildern die Landschaften und das Leben der Pioniere. Eine Geschichte von Aufbruch und Abenteuer, von Freiheit und Sehnsucht und von der Frage, was es bedeutet, seinen Platz in der Welt zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Moos König
M.E. 1856 - 1942
Band 2 Zwei Brüder im Neuen Land
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel Rückblick
Anfang Band 2
Im Einwanderungsbüro
Jim fordert ihren Weggang
Hinaus ins Weite Land
Der nächste Morgen
Ein Indianer
Regen, Regen, nichts als Regen
Vorschau M.E. 1856 – 1942: Band 3
Impressum neobooks
Kapitel Rückblick
Amerika im 19. Jahrhundert: Die zwei Brüder, Martin und Reinhard Engel, hatten sich ihren Traum der Auswanderung nach Amerika erfüllt. Im Jahre 1856 brachen sie von Deutschland auf, nach dem sie lange für die Kosten der Überfahrt gearbeitet hatten, und fuhren mit einem der ersten Dampfschiffe in die Neue Welt, nach New York City.
An einem sonnigen Tag kamen sie in der neuen Stadt an. Von Anfang an nannten sie dieses Land ihr Zuhause. Sie fühlten sich wohl im umtriebigen New York City. Die Stadt bot aber nicht nur Möglichkeiten, sondern auch Gefahren. Doch sie hatten einen Schutzengel, Jim Bayer, ein Landsmann, der Martin Arbeit bei sich im Gemischtwarenladen gab und sie an seinen Erfahrungen teilhaben ließ.
Anfang Band 2
»Vielleicht ist es an der Zeit, den Wilden Westen zu erforschen«, sagte Reinhard. Er und sein Bruder Martin saßen vor Jim Bayers Gemischtwarenladen auf der steinernen Bank. Es war ein schöner Tag in New York City. Die Mittagssonne wärmte ihre Gesichter, während das Stimmengewirr der Straße und das Klappern von Pferdehufen um sie herum ihre typische New Yorker Musik spielte. Ein leichter Wind wehte und trug eine leise Sehnsucht auf seinen Schwingen, die Reinhard tief im Inneren erreichte. Er sah seinen großen Bruder an, dessen Blick nachdenklich geworden war. Reinhard redete weiter auf ihn ein: »Wir reiten hinaus und lassen uns treiben, dorthin, wo uns der Wind hinweht. Wo noch keiner war!« Martin nickte leicht. »Bei mir rennst du offene Türen ein. Aber eine Sache hält mich noch. Können wir Jim einfach so zurücklassen?«
»Warum nicht? Er war auch vor uns da.«
»Wäre es nicht undankbar? Als wir hier ankamen, hat er uns geholfen. Er gab mir Arbeit, vermittelte uns eine Bleibe bei Mrs. Murr. Er hat mir viel beigebracht, war immer für uns da.« Reinhard unterbrach ihn: »Ich will das Land kennenlernen. Die Stadt kennen wir inzwischen gut genug. Ich möchte hinausreiten, die Landschaften sehen, von denen alle schwärmen. Lass uns hinausreiten. Wenigstens für eine Weile.«
Die Sehnsucht nach der weiten, unberührten Natur der damals noch jungen Vereinigten Staaten von Amerika war wie ein stiller Ruf in ihren Herzen, ein Ruf nach Freiheit und Abenteuer. Die endlosen Prärien, die majestätischen Berge und die tiefen Wälder versprachen nicht nur neue Horizonte, sondern auch ein Leben jenseits der geschäftigen Straßen New Yorks. Es war die Verlockung, des Unbekannten, der Wunsch, die frische Luft zu atmen, zu sein, wo noch kein Europäer vor ihnen war. Diese Sehnsucht war wie ein inneres Feuer, das die Brüder antrieb.
Als Jim vom Vorhaben der beiden hörte, ermahnte er die Brüder im strengen Ton: »Ihr stellt euch das Leben auf dem Land in den noch jungen Staaten zu einfach vor. Es gibt politische Unsicherheiten, Korruption und Fremdenhass. Ihr seid zu jung für die Prärie. Ihr werdet dort wilden Tieren begegnen, wilden Menschen. Dort gilt immer noch das Recht des Stärkeren. Wenn man einen Toten in den Wäldern findet, gibt es weit und breit keinen Täter, noch einen Richter, der verurteilen könnte. Manchmal streift man tagelang umher, findet kein Trinkwasser, ist dem Verdurstungstod nahe, bis man mit verschwommenem Blick eine dreckige Pfütze sieht, aus der man trinkt, wohl wissend, es könnte das Letzte sein, was man tut. Zuweilen rutscht man vom Pferd, weil man von den langen Ritten erschöpft ist. Man steigt immer wieder auf, bis man entkräftet an der Stelle liegen bleibt, an der man aufschlägt. Diese Reisen sind nie und nimmer mit eurer Fahrt nach Hamburg zu vergleichen. Sie sind hart, kräfteraubend, gefährlich und hinter jedem Hügel könnte eine Todesgefahr lauern.« Er sah die beiden Brüder an. Sie saßen vor seinem Laden auf der steinernen Bank. Jung sahen sie aus. Voller Tatendrang, voller Vorfreude, auf das, was noch kommen mochte. Jim war alt. Seine Knochen spürten den kalten Winter und sein Platz war hier endgültig. Nichts würde ihn noch in die Prärie zurückbringen, obwohl er die Ruhe und die Geräusche der Natur sehr vermisste. Reinhard kaute an einem Stück Trockenfleisch. Seine Jugend stand ihm ins Gesicht geschrieben. Für Jim wirkte er wie ein unbeschriebenes Blatt. So leichtgläubig, voller Mut und doch beneidete Jim ihn. »Du strahlst dein gutes Gewissen und den Mangel an geistiger Belastung aus«, sagte er zu ihm, »bewahre dir dein gutes Gewissen.« Martin saß bequem neben Reinhard und blickte sich aufmerksam um. Er hatte schnell die Namen der Kundschaft gelernt und wenn jemand ihres Wege kam, grüßte er die Personen herzlich mit Namen. Das gefiel Jim. »Ach, macht doch was ihr wollt«, sagte er schließlich zu den beiden mit einem Lächeln, »ich beneide euch. Noch einmal so jung zu sein wie ihr, mit meinem Wissensstand. Vergesst nicht, mir zu schreiben, wie es euch ergeht.«
»Das ist es«, platzte es aus Martin heraus, »du kommst mit! Du kommst einfach mit! Von dir lernen wir, wie das Leben außerhalb der Stadt funktioniert. Welche Beeren man essen kann, welche besser nicht. Du kannst uns beibringen, wie man mit Revolvern umgeht. Wie man sie reinigt, hast du mir schon gezeigt.«
Jim verlor sich in seinen Gedanken und zündete seine Pfeife an. Der Rauch stieg empor, wand sich an der Hauswand entlang und verlor sich in der Weite des blauen Himmels.
»Daraus wird nichts, mein Junge. So gerne ich auch wollte«, sagte Jim fast schon flüsternd.
Im Einwanderungsbüro
Der Beamte war von den zwei Brüdern nicht sehr angetan. »Ihr habt keine Ausbildung und seid zu jung und unerfahren, um in die Wildnis aufzubrechen. Dazu braucht es Ortskundige. Erfahrene Leute, die sich nicht scheuen ihre Revolver zu ziehen. Was soll ich nur mit euch machen?«
Doch eines Tages hatte er für Reinhard eine positive Nachricht. Reinhard eilte damit zu Martin, der gerade dabei war, jemandem Kaffee und Zucker zu verkaufen. Martin ermahnte Reinhard gefälligst zu warten, bis er den Kunden bedient und dieser den Laden verlassen hatte. Martin stand hinter dem Tresen, als hätte er nie etwas anderes getan. Mit der einen Hand stützte er sich gelassen auf, die andere stemmte er in seine Hüfte. »Jetzt erzähl!«, sagte er erwartungsvoll zu Reinhard. Dieser berichtete: »Sie suchen in Nebraska junge Burschen, die auf einer Farm aushelfen. Die Gemeinde hat deutsche Wurzeln und sie haben die Anfrage gestellt, junge deutsche Arbeiter nach Nebraska zu schicken.«
»Farmarbeit?«, fragte Martin, »ist das denn was für dich?«
»Na hör mal, daheim habe ich auch auf dem Seybolthof ausgeholfen. Ich kenne mich mit Bauernhöfen wohl aus.«
Martin lachte und entschuldigte sich bei Reinhard dafür, ihn unterbrochen zu haben. Reinhard fuhr weiter fort: »Wir würden mit dem nächsten Treck dorthin reisen. Dazu brauchen wir 18 Dollar für den Treck Leader und die Vermittlungsgebühren. Und dann benötigen wir natürlich noch die entsprechende Ausrüstung für die Reise. Pferde werden uns gestellt, die müssen wir in Nebraska wieder abgeben. Der Beamte im Einwanderungsbüro hat gesagt, man könne leicht Kredit aufnehmen und-.«
Martin unterbrach ihn diesmal, ohne sich zu entschuldigen: »Nein, Reinhard. Ich nehme keinen Kredit auf. Wir erarbeiten uns das Geld. Wenn wir genug beisammenhaben, brechen wir auf.«
»Aber Martin, warum bist du nur so gegen einen Kredit?«
»Weil es anders auch geht und besser für uns ist. Es geht vielleicht nicht heute, aber wenn es dafür Zeit ist, ist es dafür Zeit.«
»Zeit kann recht lange sein.«
»Zeit ist das, was du daraus machst.«
Reinhard zuckte die Schultern: »Ich finde es recht reizvoll in New York City. Die Stadt übt eine seltsame Faszination auf mich aus. Es ist eine Art von Treiben, das nie stillsteht. Ich entdecke ständig etwas Neues, gehe gern durch die Straßen, lasse mich von den Menschen und ihren Geschichten treiben. Oft finde ich mich in Gesprächen mit Fremden oder in unerwarteten Begegnungen mit Tieren wieder, die genauso frei und unberechenbar wirken, wie die Stadt selbst.«
»Während ich arbeite und das Geld verdiene«, brummte Martin. Reinhard ging nicht darauf ein. »Der Lohn in Nebraska soll fünf Dollar im Monat betragen!«, strahlte er, »das hat mir alles der Beamte vorgelesen.«
»Hast du den Schrieb?«
»Den bekommen wir, wenn wir uns auf den Weg machen.«
Am nächsten Tag überbrachte Reinhard seinem Bruder eine weitere gute Nachricht. Martin saß gerade mit Jim auf der steinernen Bank und sie blätterten in einem großen Katalog, aus denen sie Waren aus der alten Welt bestellten. Jim hatte eine Seite mit pompösen Kleidern für Damen aufgeschlagen. »Mit der Eitelkeit der Menschen kann man viel Geld verdienen«, sagte Jim gerade als Reinhard die Straße entlangkam, »in der alten Heimat musste man von Stand sein, um ein grandioses Kleid zu tragen. Hier nicht. Hier kann sich jede Dame in eine königliche Garderobe kleiden, solange ihr Mann das nötige Kleingeld dafür hat«, zwinkerte er, »schau dir diese Damengarderobe an. So etwas trägt man in Deutschland bei Hofe. Hier verkaufe ich es an Lieschen Müller und das nur, weil ihr Mann viel Geld mit seinen Pferden verdient. Sie benehmen sich wie Aristokraten und kommen ursprünglich von einer Schaffarm in England. Wenn Queen Victoria wüsste, dass hier manch Bauer luxuriöser lebt, als die Königin von England.« Er schüttelte den Kopf und kicherte in sich hinein. »Was meinst du damit?«, fragte Martin interessiert. »Sie haben Bedienstete. Nicht nur einen, für alles Mögliche. Sie lassen sich bedienen, wie die alten Römer. Das Gebäude, in dem sie wohnen, ist mit hohen Säulen ausgestattet, golden verziert, viel Geschnörkel, und es hat viel zu viele Zimmer. Wenn Lieschen Müller das Geld ihres Mannes ausgeben möchte, wird sie von ihrer Zofe begleitet, einem Träger und selbstverständlich von einem, der ihr den Weg freiräumt. Lächerlich.«
»Ich habe Arbeit!«, unterbrach sie Reinhard.
»Wo? Bei wem?«, rief Martin freudig. »Ich arbeite in einem Vermessungsbüro, dem Office for Land Registry von Mr. Wittman. Ich zeichne Karten nach, die von Vermessern aus ganz Amerika eingeschickt werden. Die Originale sind meistens schmutzig, eingerissen und teilweise durchgestrichen. Meine Aufgabe ist es, sie ordentlich und sauber zu übertragen. Danach werden sie für den Druck freigegeben. Martin, stell dir vor: Ich sitze in einem der schönen, hohen Häuser, direkt am Fenster, weil ich Tageslicht brauche und ich darf im gleichen Büro sitzen wie Mr. Sanders. Er ist Vermessungsingenieur. Herr Sanders ist sehr gut betucht. Ihm gehört eine der Villen weiter oben, wo es grüner ist. Er wird morgens mit der Kutsche gebracht und abends wieder abgeholt.«
»Und wie klingt seine Stimme?«, wollte Jim wissen. »Seine Stimme?«, fragte Reinhard verwundert. Jim richtete sich auf: »Man sollte die Menschen nicht nach ihren Äußerlichkeiten messen. Eine Villa im Grünen«, spottete er, »du weißt nicht, wie er zu dieser Villa im Grünen gekommen ist, vielleicht hat er jemanden auf dem Gewissen.« Reinhard riss erschrocken die Augen auf. »Das glaube ich nicht«, verteidigte er seine Ansicht, »er ist-.«
»Du weißt es nicht«, unterbrach ihn Jim, »deswegen miss die Menschen niemals an ihrem äußerlichen Besitz. Miss sie an ihrem Handeln. Daran, wie sie mit anderen umgehen. Wie ihre Stimme klingt, wenn sie sprechen. An dem, was sie tun. Prüfe, ob sie gottesfürchtig sind. Dann können sie von mir aus in Palästen wohnen und sich bedienen lassen.« Reinhard verstand den Sinn von Jims Worten nicht. Noch nicht. Im Laufe seines Lebens sollte er dahinterkommen, was Jim an diesem Tag in New York City gemeint hatte.
Es war ein Tag im September 1857. Ein junger Bursche rannte aufgeregt die Straße hinauf und schrie: »Sie ist gesunken! Mit mehreren Tonnen Gold! Die Central America. Sie ist gesunken.« Er rannte an den beiden Brüdern vorbei, die ihm verdutzt hinterherschauten. Jim trat aus seinem Laden und fragte nach, was der Junge gerufen hatte.
»Etwas von einem gesunkenen Schiff, mit mehreren Tonnen Gold an Bord.«
»Oha«, sagte Jim mit ernster Miene, »das ist nicht gut. Das wird sich auf uns alle auswirken.«
Reinhard arbeitete gerne und mit besonderem Fleiß im Vermessungsbüro bei Mr. Sanders. Er war dort bald hoch angesehen, da er schnell, eifrig und präzise war. Mr. Sanders lud ihn und seinen Bruder öfters zum Abendessen in seine Villa ein. Reinhard gesellte sich gerne zu den Zylinderköpfen, wie Martin sie nannte. Die Gäste bei Mr. Sanders‘ Abendessen erschienen stets in feinster Garderobe. Zu diesem Anlass bekam Reinhard von Mrs. Sanders die alten Anzüge ihres Mannes. Martin passten sie leider nicht, da er größer und breitschultriger war. Er begnügte sich mit einem weißen Hemd und schwarzer Hose. Mr. Sanders hatte fünfzehn Bedienstete in seinem Haus. Allesamt Schwarze. Anfangs war es Reinhard und Martin in jeder Hinsicht unangenehm, bedient zu werden. Reinhard gewöhnte sich mit der Zeit daran, während Martin sich nach wie vor bei jeder Gelegenheit mit einem freundlichen Lächeln und einem ehrlichen »Danke« auszudrücken wusste. Sei es, wenn man ihm den Mantel abnahm oder Speisen und Getränke brachte. »Sie sind es nicht gewohnt. Du bringst sie nur mit deiner Nettigkeit in Verlegenheit«, rügte Reinhard seinen Bruder. Doch Martin erwiderte: »Dann sollten sie sich daran gewöhnen. Wenn jemand freundlich zu mir ist, bedanke ich mich eben.«
»Sie müssen freundlich sein. Das ist ihre Beschäftigung. Dafür sind sie nun mal da.«
»Der Unterschied ist, dass sie es nicht freiwillig sind. Sie sind Sklaven, wie im alten Rom.«
»Ach! Papperlapapp.«
»Papperlapapp ist kein Wort.«
»Hier schon. Martin, du musst dich langsam an das Neue gewöhnen. Hier ist nichts wie in der alten Heimat. Sieh dir Mr. Sanders an. Er lebt wie ein Kaiser. Ein riesiges Haus, Bedienstete, schau dir seinen Anzug an. Sieh dir die Kleider seiner Frau an. So etwas trägt man in der alten Heimat nur bei Hofe. Aber doch nicht bei einem Abendessen, an einem Mittwoch. Zu Hause wäre es unangemessen, wenn eine unserer Schwestern so aufgetakelt am Tisch säße: Schleifen im gelockten Haar, Stoff über Stoff an Kleidern, die ausladender nicht sein könnten. Schmuck am Hals, in den Ohren, an den Fingern und am Handgelenk. Und zu besonders feinen Anlässen tragen sie weiße, lange Handschuhe. Hier ist es vornehm. Es zeigt den Reichtum des Mannes. Und dieser Reichtum kann größer sein, als der des Kaisers. Kennst du jemanden in Deutschland, der mehr besitzt als der Kaiser? Wohl kaum.«
Martin war gelangweilt: »Na dann sag mal deinem Kaiser von Amerika, er kann das Essen bringen lassen. Die Beweihräucherung im Herrenzimmer ist mir zu anstrengend.«
»Wir können auch so sein wie Mr. Sanders«, flüsterte Reinhard, »alles ist möglich in diesem neuen Land. Es fragt dich keiner nach deiner Herkunft. Lediglich Fleiß und Geschicklichkeit bringen dir die Dollars in die Taschen.«
Martin deutete auf die Kleider der Damen. »Hast du dich eigentlich mal gefragt, was die Ladys unter ihren Röcken tragen, damit sie so voluminös auftragen? Wie können die sich überhaupt hinsetzen, in dieser Garderobe?« Reinhard kicherte: »Diese furchtbaren Kleider passen durch keine normale Türe.«
»Deswegen gibt es in diesem Haus Flügeltüren. Ist dir mal der Türgriff aufgefallen? Er ist rund und man muss ihn drehen. Anders als bei uns in Deutschland.«
»Damit man mit der Kleidung nicht dran hängen bleibt.«
Während es Reinhard genoss, im Kreise der Zigarren rauchenden Herrschaften zu stehen und sich die neuesten Nachrichten aus aller Welt anzuhören, war Martin gelangweilt und hatte Hunger. Er respektierte Mr. Sanders als einen großzügigen Mann, der allerdings seine Bediensteten weniger herzlich behandelte. Hin und wieder rutschte Mr. Sanders ein beleidigendes Wort über die Lippen und die Zurechtweisungen der Bediensteten gingen öfter mit einem Schlag auf den Hinterkopf einher. Wenn dies geschah, wunderte sich Martin über die Reaktion. Denn es gab keine. Der Geschlagene blickte starr zu Boden und entschuldigte sich dafür, dass er seinen Boss zu solch einem Handeln genötigt hatte. Die Augenlider waren gesenkt. Martin tat dies immer leid und er versuchte, durch freundliche Gesten und ein mitfühlendes Lächeln, die Situation zu entschärfen.
»Es ist nicht der Wohlstand eines Mannes, der ihm Respekt verschafft, sondern die Art, wie mit Menschen und Tieren umgeht. Alles andere ist nur Fassade und kann schnell ins Gegenteil umschlagen.«
An einem Tag im Oktober ergab sich ein Ereignis, das Martin so schnell nicht vergessen sollte. Sie waren wieder einmal zum Dinner eingeladen und Reinhard hatte von Mr. Sanders einen eleganten Anzug bekommen, mit weißer Fliege und zugeknöpft bis zum Hals. Martin hatte von Jim einen Anzug geliehen, der weniger elegant, aber dafür bequem war. Es wurde fürstlich gespeist und getrunken. Bedienstete brachten Schüsseln voller Rind- und Schweinefleisch herbei, dazu Servierplatten mit hauchdünn geschnittenem Schinken. Daneben stellten sie Saucieren. Eine Sauce nannten sie Gravy, eine Art Bratensauce. Reinhard aß gerne die Senfsauce. Austern stapelten sich auf Etagèren. Verschiedene gekochte Gemüsesorten, wie Kartoffeln, Erbsen, Karotten und Bohnen wurden herumgereicht. Zum Trinken wurde Limonade, Wasser und Wein in die verschiedenen Gläser geschenkt. Mr. Sanders hatte irischen Whiskey angepriesen und die Gesellschaft begab sich bald in das Herrenzimmer, wo geraucht und getrunken wurde. Martin und Reinhard machten sich nicht viel aus dem modrig schmeckenden Whiskey. Sie hatten einen mangelnden Bedarf an geistiger Belastung, um sich der Vernebelung des Alkohols zu unterwerfen. Das Stärkste, das sie tranken, war schwarzer Kaffee. Aber sie waren gesellige Burschen und anfangs dachten sie noch, es gehöre zum guten Ton, mit den anderen anzustoßen. Nach etwa zwei Stunden nahm Martin seinen Bruder beim Arm und sie schwankten beide durch die Hintertüre hinaus an die frische Luft. Reinhard ging es bald besser und so blieb Martin alleine auf den Stufen sitzen. Wegen der hohen Häuser sah Martin nur ein Stück des Himmels. Dieser war schwarz und nur ein einziger Stern war zu sehen. Martin verlor sich in seinen Gedanken. Eigentlich war er in das Neue Land gekommen, um es zu erforschen, Land und Leute kennenzulernen. Jetzt saß er auf den Stufen einer Villa, bei vornehmen Herren, die er nicht leiden konnte. Es war dunkel. Im Hinterhof vermutete man nur die Umrisse von ein paar Fässern, aber nichts weiter. Da tat sich eine Seitentüre auf und eine der Bediensteten huschte hinaus. In ihrer Schürze trug sie etwas. Sie ging zielgerichtet über den Hof und verschwand durch eine andere Türe. Als sie wieder über den Hof eilte, hörte man ein Kinderweinen. Sie drehte sich noch einmal um, flüsterte etwas und das Kinderweinen änderte sich in ein Schluchzen. Die Frau verschwand und alles war wieder wie vorher. Dunkel und still. Martin packte die Neugier. Langsam schritt er über den Hof und blieb dort stehen, wo die Frau etwas in die Nacht geflüstert hatte. Es war still um ihn herum. Die Dunkelheit hatte sich um ihn gelegt. Er blickte zurück zur Tür, aus der er gekommen war. Durch die Fenster trat der Schein der vielen Kerzen und hin und wieder huschte ein Bediensteter im raschen Schritt am Fenster vorbei. Martin beschlich ein eigenartiges Gefühl. Er wurde beobachtet. Die Neugier war stärker als jede Vorsicht und er öffnete langsam die Türe, hinter der er das Kinderweinen vermutete. Die Tür stand offen, Martin bewegte sich aber nicht, da er nichts sah, außer Dunkelheit. Leise flüsterte er auf Englisch: »Ist da jemand?«