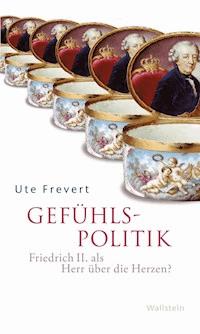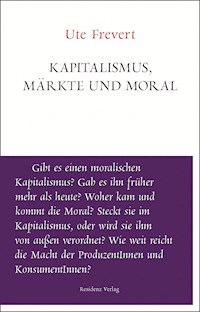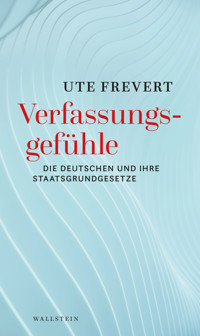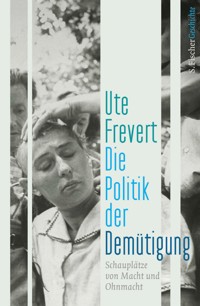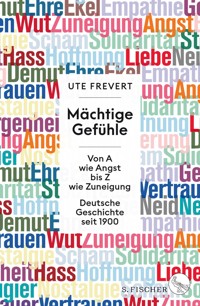
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Gefühlswelten der Deutschen: Die Historikerin Ute Frevert erzählt eine ganz andere Geschichte des 20. Jahrhunderts. Gefühle machen Geschichte. Sie prägen und steuern nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Gesellschaften. Politiker nutzen sie, können aber auch darüber stolpern. Ute Frevert erzählt von machtvollen Gefühlen und was sie bewirkten: im Kaiserreich, der Weimarer Republik, dem NS-Staat, der DDR und der alten und neuen Bundesrepublik. Sie stellt Liebe und Hass, Scham und Stolz, Empörung und Trauer in ihren wechselnden Ausprägungen und Bedeutungen vor. So war Hass ein Motor des Nationalsozialismus, doch in einer Demokratie ist er fehl am Platz. Mit der Liebe verbanden Menschen um 1900 andere Sehnsüchte als heute. Ute Frevert zeigt, warum sich Deutsche 1914 für den Krieg begeisterten und 2006 auf die Fußballnationalmannschaft stolz waren, und geht dem Neid ebenso nach wie dem Vertrauen. Das Buch schließt an die Ausstellung »Die Macht der Gefühle. Deutschland 19/19« an, die Ute Frevert mit ihrer Tochter Bettina Frevert konzipiert und mit Texten versehen hat. Sie wurde über 2500-mal in ganz Deutschland gezeigt. Ute Frevert gelingt ein ganz besonderer Blick auf die Geschichte der Deutschen, die in den sechs unterschiedlichen Staaten der letzten 120 Jahre äußerst wechselhafte Gefühle durchlebten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 647
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Ute Frevert
Mächtige Gefühle
Von A wie Angst bis Z wie Zuneigung – Deutsche Geschichte seit 1900
Über dieses Buch
Eine historische Reise durch die Gefühlswelten der Deutschen – von 1900 bis heute
Gefühle machen Geschichte. Sie bewegen nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Gesellschaften. Politiker nutzen sie, können aber auch darüber stolpern. Ute Frevert erzählt von machtvollen Gefühlen und was sie in der deutschen Geschichte anstellten, vom Kaiserreich bis zur Berliner Republik. Sie schildert, was Liebe und Hass, Scham und Stolz, Wut und Trauer jeweils bedeuteten und bewirkten. Und bietet damit eine ungewöhnliche und lebensnahe Geschichte des 20. Jahrhunderts.
»Ute Frevert erzählt elegant, pointiert und spannend.« Sandra Pfister, Deutschlandfunk
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Ute Frevert ist Direktorin des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin und leitet dort den Forschungsbereich »Geschichte der Gefühle«. 2018 entwickelte sie zusammen mit ihrer Tochter Bettina Frevert die an über 2500 Orten gezeigte Plakatausstellung »Die Macht der Gefühle«. Viele Besucher wünschten sich mehr Kontext – daraus entstand dieses Buch.
2020 wurde Ute Frevert mit dem Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa ausgezeichnet.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de
Impressum
Originalausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
Covergestaltung: KOSMOS - Büro für visuelle Kommunikation
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491313-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Die Macht der Gefühle und die deutsche Geschichte
Gefühle machen Geschichte
Gefühle haben eine Geschichte
Emotionale Signaturen des 20. Jahrhunderts
Ein neues Narrativ?
Gefühlsstile, Gefühlstechniken, Gefühlspolitik
Das Buch und sein Bauplan
Angst
German Angst und deutsches Trauma?
Angst als Lähmung
Männliches Heldentum und Angstverleugnung
Kollektive Ängste: Inflation versus Arbeitslosigkeit
Angstunternehmer
Kriegsängste hüben und drüben
Angst als Protestmotiv
Angst: Ein Politikum
Corona-Ängste und Angst-Konkurrenzen
Demut
Demut contra Narzissmus
Willy Brandts Kniefall
Dienst und Selbsterniedrigung
Von Demut zu Demütigung
Demütigungsketten
Politik der Demütigung im »Dritten Reich«
Sensibilisierung
Macht und Ohnmacht
Ehre
Ehre und Macht
Kultur der Ehre
Nach 1945: Ehre als Auslaufmodell
Ehre weiblich/männlich
Sexuelle Angriffe
Integration und Ausgrenzung
Von der Ehre zur Würde
»Ehrenmorde«
Ehre und Leistung
Ekel
Verachtung, Ekel und Moral
Ekelparolen seit den 1920er Jahren
Rassistische Ekelpropaganda im Nationalsozialismus
Politische Schädlinge und Zersetzung in der DDR
Bundesrepublikanische Schmutzrhetorik
»Ratten und Schmeißfliegen«
Nähe und Ferne
Empathie
Mitleid und Mitgefühl
Bedingungen und Voraussetzungen
Ist Empathie weiblich?
Moralischer Ekel und kulturelle Überlegenheit
Mitgefühl im Nationalsozialismus
Instrumentalisierung und Manipulation
Neue Sensibilität und Willkommenskultur
Freude
1989: Jubel und andere Gefühle
Das »strahlende Antlitz« der DDR-Jugend
Verordnete contra echte Begeisterung
Das Wunder von Bern
Glückserwartungen in der frühen Bundesrepublik
Weimarer Fortschritte: Jubel und Ablehnung
Nationalsozialistische Choreographien
Ernüchterung und rechtes Maß
Glück und Unglück in der Konsumgesellschaft
Freude und Enttäuschung
Geborgenheit
Familie, Heimat, Nation im Ersten Weltkrieg
Heimatgefühle links und rechts
Exil als Entborgenheit
Heimat-Vertriebene
Unbehaustheit
»Geborgenheit im gesicherten Fortschritt«
»Soziale Geborgenheit« in der DDR
Migration: Gastarbeiter, Vertragsarbeiter, Mitbürger
Ausländerfeindlichkeit und Bedrohungsgefühle
Zugehörigkeiten und die »neuen Deutschen«
Hass
Hass im Krieg: 1914
Klassenhass, Rassenhass
Hass im realexistierenden Sozialismus
Hass und Hetze im Westen
Weimar ist nicht Berlin
Hoffnung
Hoffnung und Zukunft
In der Krise: Weimarer Verhältnisse
Letzte Hoffnung Hitler
Wunder
Zukunftsversprechen und enttäuschte Hoffnungen im Osten
Hoffnungsträger
Von Ernst Bloch zu Fridays for Future
Liebe
Die bunte Liebeswelt und ihre Rahmungen
Regulierungen
Widerstände und Reformen im frühen 20. Jahrhundert
Liebe in nationalsozialistischen Zeiten
Liebe in der Bundesrepublik
Liebe und Ehe – für alle?
Liebe in der DDR
Die Liebe der Staatsbürgerin
Was wird aus der Königsliebe?
Führerliebe
Verfassungspatriotismus
Neid
Penisneid und Frauenhass
Antisemitismus: Der missgünstige Jude
Konkurrenzneid im Nationalsozialismus
Neidleugnung und Neidabwehr
Neidquellen in der klassenlosen Gesellschaft
Lob des Wettbewerbs
Leistungsgerechtigkeit und Neidgefühle
Neugier
Ist Neugier ein Gefühl?
Wissenschaftliche Neugier
Neugier fördern
Wissbegierige Jungen, neugierige Mädchen
Wissen ist Macht
Neugier für alle
Schule und Neugier – ein schwieriges Verhältnis
Kreatives Lernen
Neugier auf die Welt
Reiselust
Neugier schreibt Geschichte
Nostalgie
Die gute alte Zeit: Wo liegt sie?
Sehnsucht nach dem Kaiser
1933/1945: Alte oder neue Zeit
Gegenwartskritik
Heimweh/Zeitweh
Ostalgie
Scham
Schande und Scham
Kollektivscham nach 1945
Schamabwehr
Erinnerung an die Opfer
Verantwortung, Haftung, Fremdscham
Scham als Repression
Eine schamlose Gesellschaft?
Beschämungsakteure und ihre Motive
Solidarität
Vernunft und Herz, Solidarität und Brüderlichkeit
International, national, sozial
Auf Gegenseitigkeit
Solidarität im Weimarer Fürsorgestaat
Katholischer Solidarismus contra NS-Volksgemeinschaft
Volkssolidarität in der DDR
Solidarität in der Bundesrepublik
Sozialstaatliche versus bürgerschaftliche Solidarität
Stolz
Nationalstolz und nationalistischer Hochmut
Stolz, Hochmut, Eitelkeit
Adelsstolz und Mannesstolz
Heldenstolz 1914 bis 1945
DDR-Stolz
Stolz oder Nicht-Stolz in der Bundesrepublik
Stolz und Vorurteil
Ein Patriotismus leiser Töne?
Trauer
Trauer und Trost 1914
Käthe Kollwitz: Privater Verlust und öffentliches Gedenken
Von der Volkstrauer zum Heldenkult
Trauerarbeit privat
Offizielle Trauer
Staatstrauer
Deutsch-deutsche Trauer?
Trauerkulturen
Vertrauen
Vertrauen im multifunktionalen Einsatz
Vertrauensökonomien
Vertrauen und Misstrauen in der Weimarer Republik
Die Semantik der Treue
Der »Führer«: Treue, Glaube, Vertrauen
Die DDR: Wer verspielt wessen Vertrauen?
Lässt sich Vertrauen messen?
Politische Vertrauenswerbung in der Bundesrepublik
Vertrauen in der Krise
Vertrauen als Lernprozess
Wut
Wut und Zorn
Revolution 1918
Die Wut der Reaktion
Volkszorn im »Dritten Reich«
Ressentiment
Empörung
Demonstrationen und Protestbewegungen in der Bundesrepublik
Wutbürger
Produktive und destruktive Wut
Zuneigung
Abklingende Feindschaft und Europapläne nach 1918
Deutsch-italienische Waffenbrüderschaft
Europäische Freundschaften
Nachkriegsdistanzen
Die deutsch-sowjetische Freundschaft
Annäherungen im Westen
Deutsch-französische Freundschaft
Gelingende Partnerschaften
Dank
Literatur zum Weiterlesen
Abbildungsnachweis
Personenregister
Die Macht der Gefühle und die deutsche Geschichte
Jede und jeder weiß es aus eigener Erfahrung: Gefühle sind mächtig. Sie bewegen uns, färben unsere Beziehungen und Weltsichten, bestimmen darüber, was zählt und was unwichtig ist. Weniger offensichtlich ist das, was sie in der »großen«, über die Einzelnen hinausreichenden Geschichte anrichten und bewirken – und wie sie selber von dieser Geschichte geprägt werden. Darum geht es in diesem Buch.
Warum ist das interessant? Verstehen wir die Welt besser, wenn wir auf Gefühle achtgeben und das, was sie tun, unter die Lupe nehmen? Vermittelt die Perspektive neue Einsichten und Erkenntnisse, taucht sie Vergangenes und Gegenwärtiges in ein anderes Licht?
Die Antwort lautet: Ja. Schon der schnelle Blick auf aktuelle Entwicklungen und Erfahrungen zeigt, wie stark Gefühle dabei mitmischen. Das betrifft Ereignisse wie die Morde, die ein Rechtsextremist im Februar 2020 an neun Menschen mit Migrationsgeschichte in Hanau beging und die in weiten Teilen der Bevölkerung Trauer, Wut und Scham auslösten. Es betrifft, auch und vor allem, den Umgang mit dem seit Anfang 2020 grassierenden Corona-Virus, dessen Einhegung Staat und Gesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft vor nie dagewesene Herausforderungen stellt. Angst und die Sehnsucht nach Sicherheit gehen Hand in Hand mit Liebe, Solidarität und Fürsorge für diejenigen, die am stärksten und tödlichsten gefährdet sind. Wie eng die emotionale Bindung an Verwandte, Freunde, Kollegen, Nachbarn ist, wird in dem Moment deutlich, wenn man ihnen nicht mehr nah kommen darf. Vertrauen und Misstrauen haben für die Bewältigung der Pandemie eine immense Bedeutung: Vertrauen Bürgerinnen und Bürger dem Staat, der ihre Freiheitsrechte drastisch beschneidet, und leisten seinen Anweisungen Folge? Oder hegen sie Misstrauen und setzen sich darüber hinweg? Vertrauen sie ihren Mitmenschen? Wie dehnbar ist ihre Solidarität, wann bekommt sie Risse? Das Ressentiment, das mitten in der Krise zwischen Stadt- und Landbewohnern, Einheimischen und Fremden, Ost- und Westdeutschen aufflammt, weckt Zweifel am vielbeschworenen Zusammenhalt. Die Empathie mit den schwer gebeutelten Nachbarländern kennt Grenzen, könnte Grenzen aber auch versetzen und überschreiten.
Gefühle machen Geschichte
Solche Beobachtungen stützen das Argument, dass Gefühle Geschichte machen. Sie motivieren Menschen dazu, etwas zu tun oder zu lassen, das den Lauf der Dinge verändert. Das gilt für den Hanauer Täter ebenso wie für den Mann, der im Oktober 2019 einen Anschlag auf eine Synagoge in Halle verübte und dabei, wie er zu Protokoll gab, von Hass auf Juden und Frauen geleitet war. Es gilt für die Menschen, die sich darüber empören und Gegengefühle mobilisieren: Empathie, Solidarität, Scham, Zuneigung, Vertrauen. Es gilt auch für Politiker, die praktische Schlüsse daraus ziehen und muslimische oder jüdische Einrichtungen und Versammlungsorte besser schützen, gegen Hass im Netz vorgehen und Rechtsextremisten genauer observieren wollen. Auf allen Ebenen übersetzen sich Gefühle in konkretes Handeln und gewinnen damit eine Macht, die ganze Gesellschaften in Bewegung setzt.
Das war auch 2015 so, auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise. Sehr viele Deutsche reagierten erschrocken und entsetzt auf Fernsehbilder aus Lagern entlang der Balkanroute. Der harsche Kurs der ungarischen Regierung wurde weithin, so die Schlagzeile der Bild am Sonntag vom 6. September, als »Schande« empfunden. Als Kanzlerin Angela Merkel diese Schande beendete und die Flüchtlinge ins Land ließ, folgte sie einer plausiblen Annahme: Wenn die Menschen, die über die Türkei nach Europa drängten, ihren March of Hope fortsetzten, könnte man sie nur unter Anwendung massiver Gewalt stoppen. Solche Bilder waren der deutschen Öffentlichkeit jedoch nicht zuzumuten. Schon das Foto des dreijährigen syrischen Kindes, das bei der Flucht seiner Familie im Mittelmeer ertrunken war, hatte eine Welle des Mitgefühls ausgelöst. Vor diesem Hintergrund schien die Entscheidung der Kanzlerin, die Grenzen zu öffnen, ebenso logisch wie alternativlos.
Dass sich sofort zahllose Bürgerinnen und Bürger einfanden, die Ankömmlinge zu begrüßen und mit dem Nötigsten zu versorgen, bestätigte sie. Freiwillige Helfer organisierten Willkommensbasare und Büfetts, Kinder stifteten Kuscheltiere, Kirchengemeinden stellten Unterkünfte bereit. Die Empathie der Vielen war es, die den Beschluss zur Grenzöffnung vorbereitete. Das wiederholte sich fünf Jahre später, allerdings in stark verdünnter Dosis: Wieder wurde der Druck der Zivilgesellschaft so groß, dass die Regierung sich gezwungen sah, Kinder aus den heillos überfüllten griechischen Flüchtlingscamps aufzunehmen.
Nun sind Gefühle wie Empathie und Mitleid aber keine Naturgewalten. Sie brechen nicht wahl- und regellos über Menschen herein, rauben ihnen den Verstand und verführen sie zu Handlungen, die sie bei ruhiger Überlegung niemals begangen hätten. Eine solche Sicht der Gefühle kann sich zwar auf eine lange philosophische und medizinische Tradition berufen. Sie wird dadurch jedoch weder wahr noch überzeugend. Wie die anthropologische und kulturwissenschaftliche Forschung der letzten Jahre nachgewiesen hat, sind Gefühle in hohem Maße erfahrungsgesättigt und kulturell geformt. Sie greifen ebenso auf persönliche und kollektive Erfahrungen zurück, wie sie aus einem soziokulturellen Repertoire schöpfen, das ihnen Valenz und Bedeutung zuweist. Wie und was Menschen fühlen, ist immer abhängig von dem, was sie über Gefühle gelernt haben.
Diese Einsicht wird von neurowissenschaftlichen Studien bestätigt. Sie zeigen zum einen, dass sich die klassische Entgegensetzung von Verstand/Vernunft und Gefühl nicht aufrechterhalten lässt. Vielmehr stehen Gefühle in engem Kontakt mit kognitiven Operationen, die über das gesamte Gehirn hinweg zusammenarbeiten. Zum anderen sind diese Verbindungen das Ergebnis lebenslanger Lernprozesse, die zeitlich, räumlich und sozial variieren. Die amerikanische Psychologin Lisa Feldman Barrett spricht denn auch von »konstruierten Gefühlen« und betont, dass Gefühle von Menschen selber gestaltet, geschaffen und modelliert werden.[1]
Dabei spielen historische Erfahrungen eine große Rolle. In Deutschland weckten die Bilder verzweifelter Menschen, die aus ihrer von Bürgerkrieg und Gewalt zerstörten Heimat flohen, Erinnerungen an Flucht und Vertreibung, die Millionen Familien nach dem Zweiten Weltkrieg am eigenen Leib erlebt hatten. Desgleichen ließ sich der Anblick hoher Zäune, die die Flüchtlinge an der ungarischen Grenze auf Abstand halten sollten, nur schwer mit der unvergessenen und unvergesslichen Euphorie in Einklang bringen, die die ungarisch-österreichische Grenzöffnung im Sommer 1989 ausgelöst hatte.
1948: Eine Flüchtlingsfamilie unterwegs
Sommer 1989: DDR-Bürger überwinden den Grenzzaun zwischen Ungarn und Österreich
Neben persönlichen Erlebnissen und kollektiven Erinnerungen wirken Medien und Institutionen auf Gefühle ein. Ohne die Bilderflut, die das Fernsehen 2015 in die deutschen Wohnzimmer spülte, wären die Sensibilität und Hilfsbereitschaft der Bevölkerung nicht annähernd so groß gewesen. Auch Familie, Schule und Religion beeinflussen die Art und Weise, wie Menschen mit sich und ihrer Umwelt umgehen, ebenso wie Erfahrungen am Arbeitsplatz, im Fußballstadion und in Chören, Vereinen, Bürgerbewegungen oder politischen Parteien. Überall begegnen Menschen Regeln und Praktiken, die ihnen manche Gefühle nahelegen und andere tabuisieren. Geschlecht und Alter treffen dabei wichtige Unterscheidungen: Was für Männer gilt, gilt nicht für Frauen, und umgekehrt; von Jüngeren erwartet man ein anderes emotionales Verhalten als von Älteren. In früheren Jahrhunderten, als Religion und Kirchen das Tun und Lassen der Menschen bestimmten, konnte man Protestanten, Katholiken und Juden an ihren Gefühlen erkennen. Was Liebe bedeutete und Demut, Mitleid, Neid, Hoffnung oder Sehnsucht, unterschied sich nach religiöser und konfessioneller Zugehörigkeit.
Gefühle haben eine Geschichte
Gefühle machen also nicht nur Geschichte, sie werden auch von ihr gemacht. Sie unterliegen gesellschaftlichen Einflüssen, die sich in Raum und Zeit verändern. Damit sind Gefühle historisch, sie haben eine Geschichte, und das gleich mehrfach. Zum einen wandeln sich die Anlässe und Kontexte, die bestimmte Gefühle hervorrufen. Die Angst vor Krieg und Gewalt, nach zwei Weltkriegen überall spürbar, war vor 1914 weitgehend abwesend, zumal der letzte Krieg 1870/71 Deutschland nur wenige menschliche Verluste und riesige finanzielle Gewinne eingebracht hatte. Um 1900 ängstigte sich auch niemand vor Terroranschlägen und Klimawandel. Stattdessen fürchteten sich viele vor Epidemien wie Cholera und Typhus. In dem Maße, in dem Infektionskrankheiten gebannt schienen, verlor sich diese Angst. Als die Corona-Pandemie 2020 in Europa ankam, wussten viele nicht mehr, wie sich die Angst vor Ansteckung anfühlte. Noch Mitte März, die Infektionsrate war bereits steil angestiegen und Italiener und Franzosen durften ihre Wohnungen kaum noch verlassen, gab nur die Hälfte aller Befragten in Deutschland an, öffentliche Plätze und Nahverkehrsmittel zu meiden. Lediglich vier von zehn hatten ihre Sozialkontakte eingeschränkt, jeder Vierte fand die Angst »völlig übertrieben«.[1]
Zum anderen fühlten sich selbst Ängste, die wir heute noch haben, früher anders an. An Krebs erkrankten und starben Menschen schon Ende des 19. Jahrhunderts. Dennoch ging man mit der Krankheit anders um, versah sie mit anderen Deutungen, Geboten und Verboten. Das wirkte sich auf die Gefühle der Kranken aus. Selbst wenn sie den Tod vor Augen hatten, gaben sie der Angst nicht den Raum, den sie gegenwärtig besitzt und beansprucht.[2] Auch hier spielte Religiosität eine entscheidende Rolle: Wer fest an ein Leben nach dem Tod und an die Gemeinschaft der Lebenden und Toten glaubte, starb freier und heiterer als jemand, dem das Nichts vor Augen stand.
Gesellschaftlich gerahmt sind Gefühle auch insoweit, als sie Konjunkturen unterliegen. Anthropologen unterscheiden »heiße« und »kalte« Kulturen: Kalte lassen wenig Wandel zu, heiße feiern Innovation und Kreativität. Aber heiß und kalt kann auch ein Gradmesser für die Intensität sein, mit der Gefühle und Leidenschaften in einer Gesellschaft auftreten. Nicht zufällig appellierte man in der frühen Bundesrepublik immer wieder an Nüchternheit und Sachlichkeit als politischen Stil, der an die Stelle der unheilvoll exaltierten Emotionalität des »Dritten Reichs« treten sollte. Besonders der erste Bundespräsident Theodor Heuss mahnte seine Landsleute Jahr für Jahr, »nüchtern« und »illusionslos« zu bleiben und sich aus den »Fesseln von Schlagworten und Ideologien zu lösen«, die an die »arge Zeit erinnerten, da der Radau, die lärmende Musik den Austrag von Gründen und Gegengründen verdrängt hatten«.[3]
Solche Mahnungen sind Teil einer Gefühlspolitik, mit der prominente Persönlichkeiten und Institutionen die emotionale Ökonomie einer Gesellschaft zu regulieren suchen. Dazu gehört die Ansage, welche Gefühle gut und akzeptabel sind und welche nicht. Wie viel Nationalstolz will man sich leisten? Wie viel Solidarität und Empathie braucht es, um eine Gesellschaft nicht gefrieren und vereisen zu lassen? Wer verdient sie, wer nicht? Wie geht man mit Neid um? Wann und wem gilt Angst – vor wem oder was – als gerechtfertigt? Die Antworten auf diese Fragen fallen weder einsilbig noch einstimmig aus. Demokratien machen es sich damit nicht leicht, und sie können Gefühlspolitik auch nicht von oben verordnen. Die Bürgerinnen und Bürger hören zwar mehr oder weniger aufmerksam zu, was ihre Präsidenten, Kanzler, Staatsratsvorsitzenden ihnen zu Weihnachten, Silvester und im weiteren Verlauf des Jahres mitteilen. Aber sie verfolgen auch eine eigene Agenda, allein und in Gemeinschaft, abhängig von Wohnort und sozialem Status, Geschlecht, Alter, Konfession und Weltanschauung. Sie lassen sich ihre Gefühle nicht vorschreiben, reagieren trotzig, wenn sie Manipulationen wittern. Viele betonen, vor allem seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts, ihre Einzigartigkeit und emotionale Autonomie.
Doch greift auch diese Sicht zu kurz. Gewiss hat jede Person eigene Gefühle und kennt sie (meistens). Dennoch sind Gefühle nicht bloß subjektiv oder reine Privatsache. Wären sie es, könnte man nicht über und durch sie kommunizieren. Damit die Sprache der Gefühle, die aus Worten ebenso besteht wie aus Gesten und Mimik, verstanden werden kann, müssen Gefühle teilbar und mitteilbar sein. Das passiert im freundschaftlichen Gespräch, bei einer Konzert- oder Opernaufführung, in der Sportarena, beim Public Viewing oder auf politischen Demonstrationen. Hier bilden sich gefühlte und Gefühlsgemeinschaften von unterschiedlicher Dauer, manche wirken in der Erinnerung lebenslang nach.
Dass Gefühle eine Sprache haben und mitteilbar sind, heißt aber noch nicht, dass sie tatsächlich zur Sprache kommen und mitgeteilt werden. Nicht alle Menschen tragen ihr Herz auf der Zunge, führen Tagebuch oder pflegen Freundschaften, in denen sie ihr Inneres nach außen kehren. Nicht alle lesen empfindsame Romane und lernen dabei Gefühle kennen, die sie vielleicht noch nie empfunden haben. Wen erreichen die Achtsamkeits-Apps der Gegenwart, und wer macht sich die Erwartungen von hygge oder wokeness zu eigen? Solche Praktiken haben einen historischen und einen sozialen Ort, sie sind nicht in sämtlichen Kulturen, Zeiten und Milieus verbreitet.
Emotionale Signaturen des 20. Jahrhunderts
Das 20. Jahrhundert war, aus der Rückschau betrachtet, eine emotional bewegte und mitteilsame Zeit. Es begann mit Jubelfeiern und hochfliegenden Hoffnungen. Niemals, hieß es um 1900, sei es der Menschheit (in West- und Mitteleuropa) so gutgegangen. Die Leistungsbilanz der Vergangenheit falle großartig aus und lasse für die Zukunft noch Besseres erwarten. Man könne stolz sein auf das Erreichte. Die schwermütige Stimmung des Fin de Siècle schien überwunden, Spannungen und Konflikte waren, zumindest in den Leitartikeln und Festreden, vergessen.[1]
Vierzehn Jahre später brach der Weltkrieg aus, von dem man damals noch nicht wusste, dass er der erste war und alsbald ein zweiter folgen würde. Nicht wenige begrüßten ihn mit Begeisterung und hegten große Hoffnungen, die sich selten erfüllten. In ganz Europa wirbelte der Krieg die Verhältnisse durcheinander, zog neue Grenzen, ließ alte Reiche untergehen und schuf neue Staaten. Für Deutschland brachte sein Ende eine böse Überraschung. Die Niederlage traf die meisten Menschen unvorbereitet, denn bis zuletzt hatte sich die Oberste Heeresleitung siegesgewiss gegeben. Die Friedensbedingungen der Alliierten empfanden viele als unfair und demütigend. Andere betrachteten die Revolution 1918 als ehrlosen Verrat und »Dolchstoß« in den Rücken des tapfer kämpfenden Heeres. Sie schürten fanatischen Hass auf Sozialisten, denen sie die Verantwortung dafür zuschoben. Die politische Polarisierung, die unerbittliche Feindschaft zwischen Rechts und Links war die schwerste Hypothek, die der Weimarer Republik in die Wiege gelegt wurde.
Dennoch startete sie 1919 optimistisch und packte beherzt politische und soziale Reformen an. Frauen, bislang von Wahlen ausgeschlossen, bekamen das aktive und passive Stimmrecht und zogen ins Parlament ein, wo sie sich vor allem für sozialpolitische Themen und die Dämpfung destruktiver Leidenschaften engagierten. In der Bildungs- und Sozialpolitik gab es demokratische Aufbrüche, der Städtebau experimentierte mit luftigen Wohnsiedlungen, und die Kulturszene war in kreativem Aufruhr. Junge Frauen trennten sich von langen Röcken und Haaren, trieben Sport und suchten Rollenvorbilder bei den Stars der Leinwand. In Städten eröffneten Bars für Homosexuelle und Sexualberatungsstellen für die »moderne Ehe«. Berlin wurde zwischen Paris und Moskau zur Hauptstadt der Avantgarde, hier traf sich tout le monde.
Aber in Berlin saßen auch völkisch-rechtsextreme Politiker wie Joseph Goebbels, ab 1926 Gauleiter der NSDAP, ab 1928 Reichstagsabgeordneter und ab 1930 Reichspropagandaleiter der Partei. Im Parlament tat er sich durch Schmähreden hervor, doch die wichtigsten Kämpfe fanden auf der Straße statt, mit Kommunisten, Sozialdemokraten und der Polizei. Seit der Wirtschaftskrise 1929 stiegen die Zustimmungswerte, im Juli 1932 wurden die Nationalsozialisten mit 37 Prozent der Wahlstimmen stärkste Partei im Reichstag. Eine linke Gegenmacht war nicht in Sicht: Zwar kamen Sozialdemokraten und Kommunisten zusammen auf knapp 36 Prozent, waren einander aber spinnefeind und bekämpften sich bis aufs Messer.
Gleichzeitig zerlegte sich die bürgerliche Mitte. Sie stand der Weimarer Republik von Anfang an zwiespältig gegenüber. Mancher wandte sich der »Zukunft« zu und wurde »Vernunftrepublikaner«, blieb insgeheim jedoch »Herzensmonarchist«.[2] Andere drifteten ins rechtsnationalistische Lager ab. Als Außenminister Gustav Stresemann 1929 starb, waren die Risse unübersehbar. Einerseits verneigten sich Hunderttausende vor seinem Sarg. Der Berliner Trauerzug war, wie der liberale Publizist Harry Graf Kessler berichtete, »endlos«: »Reichsbanner [ein Verband republikanischer Kriegsteilnehmer] bildete links und rechts an der Trauerstraße vom Reichstag bis zur Wilhelmstraße Spalier. Vor dem A[uswärtigen] A[mt] hielt der Zug. Das Fenster von Stresemanns Arbeitszimmer war schwarz drapiert, und auf der Fensterbrüstung stand ein Korb mit weißen Lilien; das war eigentlich das erschütterndste, menschlichste Bild.« Andererseits entbrannten schon am Tag nach dem »Volksbegräbnis« erbitterte Kämpfe um Stresemanns politisches Erbe. Selbst seine Deutsche Volkspartei ließ nichts unversucht, das Bild des Politikers »ins Antirepublikanische, Chauvinistische umzufälschen, um das moralische Kapital, das er hinterlassen hat, für die Rechte zu retten«.[3] In dem Maße, wie die Nationalsozialisten erstarkten, schrumpften die liberal-konservativen Parteien. Hatten sie 1920 noch ein knappes Viertel der Wählerstimmen auf sich vereinigen können, blieben sie zwölf Jahre später unter drei Prozent.[4]
Seit 1933 gab nur noch eine Partei den Ton an, und dieser Ton war emotional hochgestimmt. Er versprach den politisch konformen und »rassisch« genehmen Volksgenossen wirtschaftlichen Aufschwung, internationale Geltung und eine geeinte, »Kraft durch Freude« tankende Volksgemeinschaft. Nationale Ehre und Treue rangierten auf der Gefühlsskala ganz oben; wer sie aus Sicht des Regimes verriet, landete im Konzentrationslager oder am Strang. Antisemitismus als hasserfüllte Ideologie wurde zur Staatsdoktrin und kulminierte in der kaltblütigen Ermordung von Millionen jüdischen Männern, Frauen und Kindern in ganz Europa. Den Vernichtungskrieg im Osten führten Wehrmacht und SS-Verbände mit beispielloser Brutalität, und auch im Westen und Süden gingen deutsche Besatzungstruppen nicht zimperlich vor. Obwohl die Zahl derer, die für »Führer, Volk und Vaterland« fielen, seit 1941 in die Höhe schnellte, glaubten viele Deutsche bis zum Schluss an den Endsieg und hielten es mit dem gefeierten Filmstar Zarah Leander: Ich weiß, es wird einmal ein Wunder gescheh’n.
Statt des wundersamen Endsiegs kam die bedingungslose Kapitulation. Die Grenzen wurden, vor allem im Osten, neu gezogen, das restliche Deutschland von den alliierten Siegermächten besetzt und in vier Zonen geteilt. Als daraus 1949 zwei Staaten entstanden, waren sie weder souverän, noch besaßen sie eigene Streitkräfte. Fest eingefügt in zwei bis an die Zähne bewaffnete feindliche Blöcke und am Bändel der jeweiligen Supermacht, entwickelten sie unterschiedliche gesellschaftliche Signaturen, institutionelle Prägungen und emotionale Stile. Als Bürgerinnen und Bürger der DDR 1989 in einer friedlichen Revolution – der ersten auf deutschem Boden – den Rücktritt der Regierung erzwangen und die Deutschen ein Jahr später ihre Wiedervereinigung feierten, fiel es nicht schwer, Ost- und Westdeutsche als separate Spezies zu identifizieren. Sie unterschieden sich nach Auftreten, Sprache und Kleidung, nach Beziehungsmustern, Konsumverhalten und Parteipräferenzen. Auch deshalb wuchs und wächst das, was nicht allein Willy Brandt als zusammengehörig empfand, nur langsam und stolpernd zusammen. Enttäuschungen und Ressentiments gibt es auf beiden Seiten.
Ein neues Narrativ?
Fakten und Zahlen der deutschen Geschichte im langen 20. Jahrhundert sind bekannt. Die Deutungen aber variieren, je nach Standpunkt und Perspektive. Wer auf Wirtschafts- und Sozialpolitik schaut, sieht andere Entwicklungen, Verflechtungen und Zäsuren als jemand, der sich für Politik- oder Kulturgeschichte interessiert. Was sieht man, wenn man auf Gefühle achtet? Welche neuen Erkenntnisse über die deutsche Geschichte der vergangenen 100 bis 130 Jahre lassen sich daraus gewinnen? Diese Frage hier und jetzt zu beantworten, würde vorwegnehmen, was in den folgenden zwanzig Kapiteln entfaltet wird. Aber ein paar Fäden zu dem, was ein historischer Blick auf Gefühle zutage fördern kann, seien gespannt:
Immer mal wieder begegnet man dem Ausdruck German Angst – und wundert sich, weshalb Angst als Lehnwort ins Englische übernommen wurde (ebenso wie Kindergarten, Blitzkrieg und Schadenfreude). Ist Angst tatsächlich etwas spezifisch Deutsches, sind Deutsche besonders anfällig für Ängste, und wenn ja, für welche? Man könnte an die sprichwörtliche deutsche Inflationsangst denken oder an die Angst vor saurem Regen und Waldsterben, die viele Menschen in den 1980er Jahren umtrieb. Und man wüsste gern, woher solche Ängste kamen und wohin sie führten – und wer das Wort von der deutschen Angst zu welchem Zweck in die Welt gesetzt hat.
Seit 2010 kennt der Duden den Begriff des Wutbürgers. Im gleichen Jahr veröffentlichte der 1917 in Berlin geborene Stéphane Hessel das Manifest Empört Euch! Millionen kauften und lasen es. Waren das alles Wutbürger? Das kommt darauf an, was man darunter versteht und wie man es bewertet. Manche Zeitgenossen beziehen den Begriff stolz auf sich selber, andere nutzen ihn zur abwertenden Fremdbezeichnung. Dabei ist Wut nichts, was einen wohltemperierten, auf besonnenes Urteilen bedachten Bürger üblicherweise auszeichnet. Seine Wut und seinen Ärger zu kontrollieren, gehörte schließlich seit dem 19. Jahrhundert zum gutbürgerlichen Bildungsprogramm. Aber wie stand es um den Zorn der Mächtigen und um den heimlichen Groll der Ohnmächtigen? Wann wurde er laut, vernehmbar und unheimlich?
Von Neid und Neiddebatten war in der letzten Zeit oft die Rede. Aber das ist nicht neu. Schon in den 1920er Jahren warfen Rechte Linken vor, diese seien neidisch auf die Stützen der Gesellschaft und gönnten ihnen den ererbten oder erworbenen Wohlstand nicht. 1994 setzte die CDU den »sozialistischen Neidparolen« ein »klares Ja zur Leistung« entgegen.[1] Neid taugte hier zur Diffamierung des politischen Gegners – und tut das heute noch. Wer neidisch ist, heißt es, sei nicht bereit, sich anzustrengen, und greife lieber anderen in die Tasche. Das blendet die grundsätzliche Frage aus, in welcher Beziehung Neid zum Wettbewerb steht, der doch ein Pfeiler unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ist. Ebenfalls auf den historischen Prüfstand gehört das Konzept der Leistung und woran man sie misst. Wie gehen Menschen mit Leistungsdifferenzen und Wettbewerbsnachteilen um, auf welche Vorbilder und Erfahrungen greifen sie zurück? Und wie verhält sich Neid zu Solidarität und der Erwartung, dass Stärkere für Schwächere einstehen sollen?
Neuerdings geben sich Politiker gern demütig. Sie nehmen Wahlergebnisse, erfreuliche wie niederschmetternde, demütig entgegen, stellen ihr Ego zurück und verneigen sich vor der Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger. Das verblüfft, denn Demut hat sich seit längerem aus dem aktiven Wortgebrauch verabschiedet. Wenn überhaupt, war sie nur Katholiken noch ein Begriff und eine meist auf den Kirchenraum beschränkte Praxis. Heute dagegen vermitteln digitale Karrierebibeln Ratschläge, wie man demütiger wird, damit Sympathien erwirbt und seine Ziele besser durchsetzen kann. Zugleich ist Demütigung in aller Munde. Ostdeutsche fühlen sich von Westdeutschen in die Demut gezwungen, Frauen von Männern, Schüler von Lehrern, Angestellte von ihren Chefs. Auch zwischen Staaten und Nationen spielt Demütigung eine große Rolle, sichtbar etwa in der Kette der beabsichtigten und gefühlten Herabsetzungen, die Deutsche und Franzosen zwischen 1871 und 1945 austauschten. Wie passen Demut als persönliche Gefühlshaltung und Demütigung als politische Strategie in die Geschichte eines Jahrhunderts, in dem Erfahrungen von Macht und Ohnmacht oft und rasch wechselten?
Zu den am hellsten und weitesten strahlenden Gefühlswörtern gehört zweifellos Liebe. Aber Liebe ist nicht nur ein Wort. Sie wird gelebt, erfahren, verhandelt. Sie stiftet die wichtigsten Beziehungen, die Menschen miteinander eingehen, und sie verändert sich in der Lebensspanne. Das passiert einerseits ganz individuell, bei jedem Paar, in jeder Eltern-Kind-Beziehung und in jeder Freundschaft auf eigene, besondere Weise. Andererseits werden diese persönlichen Gefühle von außen nicht nur beobachtet, kommentiert und bewertet, sondern auch geprägt und gerahmt. Im medial explodierenden 20. und frühen 21. Jahrhundert sehen sich Menschen von einer Fülle von Ratgebern, Filmen, Romanen und Produktwerbungen umgeben, die ihnen Angebote unterbreiten, wie sie ihre Liebeserwartungen und Beziehungen gestalten können. Zugleich gab und gibt das Recht dafür mehr oder minder strenge Regeln vor. Erst seit 2017 dürfen Homosexuelle in Deutschland ihre Liebe unter den Schutz des Staates stellen. Die katholische Kirche verwehrt ihnen bis heute den Segen, manche evangelische Landeskirchen erlauben kirchliche Trauungen. Noch in den 1950er Jahren hatten beide Kirchen Front gemacht gegen das, was sie als konfessionelle »Mischehen« ablehnten: Liebesbeziehungen zwischen evangelischen und katholischen Christen. Dass sie mit diesem Begriff die unrühmliche Diskriminierungstradition fortsetzten, die 1935 im gesetzlichen Eheverbot für jüdische und nichtjüdische Deutsche gegipfelt hatte, fiel offenbar niemandem auf. Im Übrigen wurde auch Liebe ohne Ehe von Staat und Kirchen argwöhnisch beäugt und negativ sanktioniert. Bis in die 1970er Jahre durften unverheiratete Paare vielerorts nicht gemeinsam im Hotel übernachten, denn sie lebten, wie es hieß, in »wilder Ehe« und trieben »Unzucht«. Lockerungen solcher Verbote und Kontrollen wurden von denen erkämpft, die gegen das enge moralische Korsett aufbegehrten. Unterstützung erhielten sie von einer sich liberalisierenden Öffentlichkeit, die Liebe und Sexualität unter Erwachsenen als Privatsache definierte, in die weder Staat noch Kirche eingreifen sollten. Veränderte Frauen- und Männerbilder trugen das Ihre dazu bei, die Liebeswelt in Unruhe zu versetzen und in Bewegung zu halten.
Selbst scheinbar private Gefühle sind also gesellschaftlich geformt und wandeln sich, im individuellen Lebensverlauf ebenso wie in der historischen Zeit. Umgekehrt sind öffentliche und offizielle Beziehungen abhängig von persönlichen Zuneigungen und Animositäten. Auf der Bühne internationaler Politik ist das alles andere als belanglos. Als der SPD-Politiker Egon Bahr 2015 im Alter von 93 Jahren starb, ließ es sich der ein Jahr jüngere ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger nicht nehmen, zur Gedenkfeier für seinen »lebenslangen Freund« nach Berlin zu reisen. Ihre Freundschaft hatte holprig begonnen, die politischen Ziele und Wege schienen weit auseinanderzudriften. Als Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten hatte es Kissinger irritiert, den Architekten der westdeutschen Ostpolitik »frei von allen gefühlsmäßigen Bindungen an die Vereinigten Staaten« zu erleben. Bahr schien ihm »kein überzeugter Anhänger der westlichen Gemeinschaft« und legte aus Sicht des Amerikaners zu viel Wert auf »freundschaftliche Beziehungen zum Osten«. Erst Jahre später verwandelte sich Misstrauen in Wertschätzung und persönliche Freundschaft. Das wiederum spiegelte sich, wie Kissinger in seiner Gedenkrede betonte, in der »Verbundenheit zwischen Deutschland und Amerika«. Wer es schaffte, »das Misstrauen zu zähmen und Ambivalenzen in der Freundschaft zu begraben«, leistete den beiden Staaten und ihren Nationen einen wichtigen Dienst.[2]
Gefühle, zeigen diese Schlaglichter, sind auf vielfache Weise in die Geschichte eingewoben. Sie gestalten menschliche Beziehungen, in der Familie ebenso wie in der Politik. Sie erlauben oder behindern Verständigung und Zusammenarbeit. Sie entscheiden über Bedeutung und Bedeutungslosigkeit. Wer starke Gefühle empfindet, handelt anders als jemand, der sie nicht verspürt. Aber Gefühle sind nicht einfach nur anwesend oder abwesend; sie leben in der Erinnerung fort und bereiten künftiges Verhalten vor. »Gefühlsmäßige Bindungen« an ein Land, wie sie Kissinger bei Bahr vermisste, beginnen meist mit einer persönlichen Erfahrung: Man verbringt Zeit im Ausland, lernt dort freundliche Menschen und eine andere Lebensart kennen. So entstehen Sympathie und Zuneigung, die spätere Handlungsweisen und Einstellungen grundieren.
Gefühlsstile, Gefühlstechniken, Gefühlspolitik
Zugleich sind Gefühle nicht singulär, subjektiv und individuell. Sie fügen sich zu sozialen Mustern, gehorchen impliziten und expliziten Regeln. Sie lassen sich synchronisieren. Jede Gemeinschaft, sei es eine langlebige Institution oder ein kurzfristiger Zusammenschluss, tut das unentwegt. Sie gibt vor, welche Gefühle in welcher Intensität akzeptabel sind, und übt sie kollektiv ein. Wer in der Bundesrepublik der 1950er Jahre Sympathie für die Sowjetunion äußerte, hatte ein ähnliches Problem wie jemand, der damals in der DDR seiner Begeisterung über den American way of life samt Rock’n Roll freien Lauf ließ. Neben dem Gegenstand der Zuneigung standen auch deren Ausdruck und Praxis unter gesellschaftlicher Aufsicht und Bewertung.
Vor allem bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen lässt sich beobachten, wie bestimmte emotionale Stile in der Gruppe ausprobiert und gängig wurden, bevor die nächste Generation – oder zumindest Teile davon – sie zur Seite schob und eigene Gefühlshaltungen entwickelte. Auf die feministisch vorgeprägte Betroffenheitskultur der 1980er Jahre, die auf einer Welle der Empathie und des persönlichen Berührtseins segelte, folgte der eher männliche Kult der Coolness (den man aber auch schon aus den 1920er und 1950er Jahren kannte).[1] Wer ihn praktizierte, gab vor, über den Dingen zu stehen, sich nicht anfechten zu lassen. Emotionaler Überschwang war verpönt, Distanz belohnt, Lässigkeit gefeiert. Je eifriger man solchen Gruppenprofilen nachlebte, desto stärker beeinflussten sie das eigene Fühlen und Handeln.
Dass emotionale Stile und die Gefühle ihrer Anhänger wechselseitig aufeinander einwirken, hatte Wilhelm Wundt, Begründer der experimentellen Psychologie, bereits 1877 festgestellt. Als Beispiel zog er die klassischen Klageweiber heran, bei denen »der Ausdruck selbst die Gemüthsbewegung herbeiführt«.[2] Ähnlich funktioniert Lachyoga. Ich erinnere mich an ein Experiment, an dem ich zunächst eher widerwillig teilnahm, in einer großen Gruppe von Menschen, die einander nicht oder nur oberflächlich kannten. Ein Coach leitete uns durch eine Reihe von Dehn- und Atemübungen, bis hin zur Lachpantomime. Der Effekt war umwerfend, nicht nur bei mir. Am Ende der Übung fühlte man sich tatsächlich fröhlicher, freudevoller, gelockert. Und ließ es die anderen spüren.
Der professionell begleitete Selbstversuch folgte der von Psychologen bereits um 1900 ausgegebenen Devise: »Wir lachen nicht, weil wir glücklich sind, sondern wir sind glücklich, weil wir lachen.« Mittlerweile gibt es weltweit Tausende von Lachclubs, deren Mitglieder sich zum grundlosen Lachen treffen. Auch Schulen, Kindergärten, Kliniken, Seniorenzentren, Unternehmen und Fitnesscenter führen es im Programm. Manche verweisen auf die heilende Wirkung des Lachens und wollen Harmonie und Freundlichkeit stärken, anderen geht es um die Steigerung individueller Anpassungs- und Leistungsbereitschaft.
Unabhängig von Motiven und Zielen illustriert das Beispiel Lachyoga, dass und wie sich Gefühle steuern und bewusst herstellen lassen. Es gibt Techniken des Körpers und der Seele, mit denen beide in Stimmung gebracht und mit anderen Körpern und Seelen zusammengestimmt werden. Das neue Medium des Films, ohne den das 20. Jahrhundert nicht zu denken ist, führt das meisterhaft vor. Auch die Produktwerbung setzt solche Techniken geschickt und erfolgreich ein, um Konsumentinnen und Konsumenten den Kauf bestimmter Waren nahezulegen. Last but not least bedient sich die Politik der Kunst, mit Hilfe von Architektur, Lichteffekten und Tonkulissen eine emotionale Atmosphäre zu schaffen und Menschen für gefühlsgetränkte Botschaften empfänglich zu machen.
Der Nationalsozialismus war dabei längst nicht das einzige politische System, das die Bevölkerung mit seinem gigantischen Überwältigungstheater emotional berühren und lenken wollte. Auch der »real existierende Sozialismus« der DDR zeigte sich daran interessiert, die Gefühle der Bürgerinnen und Bürger zu formen und zu kontrollieren. Selbst demokratische Gesellschaften betreiben organisierte Gefühlsarbeit, wenn auch weniger martialisch und bühnenreif. Ihre Institutionen, von der Familie über die Schule und das Militär bis zum Sozialstaat oder Sportverein sind bemüht, Hass, Neid und Ressentiment einzuhegen; zugleich produzieren und nutzen sie Gefühle wie Vertrauen, Empathie und Solidarität. Ob sie damit Erfolg haben, steht nicht von vornherein fest. Liberale Gesellschaften kennen keine mediale oder institutionelle Gleichschaltung und marschieren nicht im Gleichschritt. Selbst wenn sie Leitplanken setzen und Wegweiser aufstellen, bleibt ihren Mitgliedern die Freiheit, sich für oder gegen eine Richtung zu entscheiden.
Das Buch und sein Bauplan
Wie Gefühlspolitik seit der vorletzten Jahrhundertwende in Deutschland aussah, welche Gefühle sie für welche Ziele und Zwecke propagierte und mobilisierte, erkundet dieses Buch. Gefühlspolitik gehört dabei nicht nur in die Sphäre der Staatskunst, der Medien oder des Kommerzes. Sie findet auch dort statt, wo Menschen ohne explizite Einladung oder offizielle Aufforderung von ihren Gefühlen sprechen, ihnen folgen und sich bewegen lassen, auf der Straße oder im stillen Kämmerlein.
Diese Bewegung hat Spuren hinterlassen. Die Historikerin begegnet ihnen auf Schritt und Tritt: in persönlichen Briefen und Tagebüchern, in Gerichtsprotokollen und höchstrichterlichen Entscheidungen, in (Kriegs-)Gedichten und Liedertexten, in Graffiti, auf Wandzeitungen und Werbeplakaten. Politische Ansprachen staatlicher Würdenträger, seit 1949 meist zu Weihnachten und Silvester, adressierten ein weites Spektrum von Gefühlen und Gefühlspraktiken, die man bei den Bürgerinnen und Bürgern zu erkennen meinte, und versahen sie mit wertenden Kommentaren und Appellen.
Umgekehrt erhielten Präsidenten und Minister, Kanzler und Könige emotionale Post aus der Bevölkerung. In den Archiven lagern zahllose Briefe von Menschen aus allen sozialen Schichten, Frauen wie Männern, Alten und Jungen. Sie verspürten offenbar das Bedürfnis, ihre Ängste, Hoffnungen und Sehnsüchte, aber auch Wut und Empörung »an den Mann« zu bringen und ihr Herz auszuschütten. Ende 1949 gingen beim Bundespräsidenten täglich einige hundert Briefe ein, 1954 sprach Theodor Heuss von »Hunderten, wenn nicht Tausenden von Briefen«, die er »wenigstens flüchtig« durchsehe und, wenn sie »einen persönlichen Charakter haben«, auch persönlich beantworte.[1] Längst nicht alle wurden dauerhaft aufbewahrt. So neigte die Kanzlei des »Führers« nach 1933 dazu, vornehmlich »nette« Briefe abzulegen.[2]
Trotz dieser Filter sind die überlieferten Schriftstücke eine ergiebige Quelle. Sie verleihen auch denen eine bis heute hörbare Stimme, die im offiziellen Gedächtnis der Nation meist stumm bleiben. Gleiches gilt für Texte, die sich in privatem Besitz befinden und eher zufällig in meine Hände gelangten. Dazu gehören die handschriftlichen Erinnerungen einer Mutter an ihren im Ersten Weltkrieg gefallenen Sohn oder die Rundbriefe ehemaliger Klassenkameraden, die 1941 an die Front beordert wurden.[3] Sie geben Auskunft über die Valenz und Bindungskraft von Trauer, Begeisterung, Ehre, Liebe, Hass.
In all diesen und anderen Quellen ist nie nur von einem einzigen Gefühl die Rede. Wie im gelebten Alltag tauchen Gefühle gemischt auf. Häufig werden Wut, Hass und Angst verkoppelt, Sehnsucht (nach der Vergangenheit) und Hoffnung (auf die Zukunft), Liebe und Empathie, Stolz und Begeisterung. Dennoch präsentiert dieses Buch Gefühle einzeln und nicht als Wimmelbild. Die alphabetische Ordnung unterstreicht den Duktus eines Lexikons, von A wie Angst bis Z wie Zuneigung. Dort, wo Gefühle aufeinander verweisen, ist das im Text mit ▷ vermerkt, so dass die Leserin, der Leser vor- oder zurückblättern kann.
Warum aber habe ich mich für ein Lexikon der Gefühle entschieden statt für eine chronologisch geordnete deutsche Gefühlsgeschichte, die auf den Wechsel emotionaler Stile und Konjunkturen abhebt? Denkbar wäre auch eine Problemgeschichte gewesen, die einzelne Ereignisse oder Entwicklungen darauf untersucht, welche Gefühle ineinandergreifen, sich wechselseitig bestärken, behindern oder neutralisieren. So könnte man eine Gefühlsgeschichte der Kriege und Revolutionen, der Wirtschaftskrisen und Aufschwünge, der Staatsgründungen und Untergänge schreiben, abgebildet in einem Barometer, das den Auf- und Abstieg spezifischer Stimmungslagen markiert.
Allerdings geriete so die Historizität von Gefühlen, ihre Veränderlichkeit in Zeit und Raum aus dem Blick. Es fiele schwerer zu erkennen, dass Liebe um 1900 nicht dasselbe war wie Liebe im Jahr 2020. Die Metamorphosen des Hasses und des Ekels blieben ebenso unterbelichtet wie die sehr verschiedenen Formen und Funktionen von Angst und Ehre, Demut oder Stolz im langen 20. Jahrhundert. Eine allgemeine, von Anfang bis Ende durchkomponierte Gefühlsgeschichte wiederum wäre voreilig, unausgegoren und naseweis. Zum einen fehlt es dafür an Vorarbeiten und akribischer Detailforschung. Zum anderen ist mir nicht an einer neuen Meistererzählung (davon gibt es schon genug) aus einem Guss und mit einer stringenten Prozessanalyse gelegen. Deshalb habe ich ein lexikalisches Gerüst gewählt. Damit lässt sich beobachten, wie und wo Gefühle ihre geschichtsbildende Arbeit tun, und zugleich begreifen, wie sehr sie dabei von ihrer Zeit und deren Umständen geformt werden.
Außerdem erlaubt es dieser Zugang, das Buch nach Lust und Laune zu lesen. Man muss das nicht von der ersten bis zur letzten Seite tun, sondern kann sich von der persönlichen Neugier leiten lassen. Jedes Kapitel ist aus sich selber heraus verständlich.
Apropos Neugier: Vielleicht verwundert es, dass mein Gefühlslexikon auch Neugier aufführt. Manche mögen bezweifeln, ob Neugier oder Ehre oder Demut Gefühle sind. In aktuellen psychologischen Lehrbüchern tauchen sie nicht als solche auf. Dort geht es meist nur um sogenannte Grundgefühle, sechs oder sieben an der Zahl, zu denen Freude und Überraschung, Angst und Trauer, Zorn und Ekel beziehungsweise Verachtung zählen. Historisch jedoch ist die Gefühlspalette sehr viel bunter und vielfältiger. Empathie und Hoffnung, Hass und Geborgenheit, Vertrauen und Liebe, Scham und Stolz, aber eben auch Neugier, Ehre oder Demut sind kultur- und wissensgeschichtlich als »Gemütsbewegungen«, wie man Emotionen noch im späten 20. Jahrhundert übersetzte, klassifiziert und dokumentiert.
Gemütsbewegungen unterscheiden sich von Wahrnehmungen, Gedanken, Meinungen durch ihre hohe Erregungsqualität, die sich im Körper abbildet. Wer liebt oder hasst, neugierig oder demütig ist, empfindet das mit Haut und Haaren und bringt es körpersprachlich zum Ausdruck. Selbst Vertrauen, ein eher mildes, unaufgeregtes Gefühl, geht mit leiblichen Veränderungen einher, zeigt sich in einer bestimmten Haltung, Gestik, Mimik und Stimmführung. Zuneigung, wie man sie im freundschaftlichen Umgang bezeugt, trägt die Körperbewegung bereits im Namen: Man neigt sich jemandem zu, den man sympathisch findet, man sucht Nähe, geht auf Tuchfühlung – ein in Corona-Zeiten verpöntes, sonst aber weit verbreitetes emotionales Verhalten, das den ganzen Körper einbezieht.
Die Art und Weise, wie das geschieht, ist historisch und kulturell verschieden. Wer wem wie nah kommen darf, unterliegt gesellschaftlichen Konventionen. Dass Frauen und Männer – Politiker eingeschlossen – einander zur Begrüßung küssen oder umarmen, ist relativ neuen Datums und nicht in allen Weltgegenden üblich. Die Zahl der Küsse und die Enge der Umarmung variieren von Land zu Land, von Region zu Region. Wie der Körper zum Einsatz kommt, hängt davon ab, was Menschen ihrem Körper abverlangen. Manche betrachten ihn als Hochleistungsmaschine, andere möchten ihn in Watte packen. Auch dafür gibt es kulturelle Muster. Gesellschaften und soziale Milieus konstruieren Körperbilder und bringen sie in Umlauf. Das hat unmittelbare Folgen für die Wahrnehmung und Äußerung von Gefühlen. Ob Körper als hart oder weich, durchlässig oder gepanzert, belastbar oder verletzlich empfunden werden, beeinflusst die Intensität, aber auch die Spannbreite dessen, was Menschen fühlen.
Das 20. Jahrhundert hat mehrere Körperregime hervorgebracht. Die Mechanisierung industrieller Arbeit bis hin zur Digitalisierung und die Zunahme von Dienstleistungsberufen waren dafür ebenso verantwortlich wie das veränderte Mobilitätsverhalten – Stichwort Motorisierung – oder die Erfindung des Leistungs- und Breitensports. Auch die flächendeckende Medikalisierung und die wachsende Indienstnahme therapeutischer Angebote spielen eine Rolle. Wie sich wechselnde Körperregime auf emotionale Praktiken auswirkten, ist erst im Einzelfall erforscht. Zugleich sind Gefühle aber nicht ausschließlich körperlich grundiert. Sie haben auch kognitive Anteile, nehmen Bewertungen vor und Erfahrungswissen auf. Sehr viel stärker als intellektuelle Vorgänge sind sie jedoch auf Praxis ausgerichtet: Sie motivieren menschliches Handeln, setzen Personen in Gang, stellen sie still oder verändern ihren Lauf. Gerade das macht sie geschichtsmächtig.
Dieses Buch stellt zwanzig solcher Gefühle vor und zeigt, wie sie die Geschichte des vergangenen Jahrhunderts geformt haben. Angst und Wut, aber auch Trauer und Empathie spielten für Protestbewegungen eine wichtige Rolle. Geborgenheit verband sich mit Heimatvorstellungen, die schon in den 1920er Jahren politisch umkämpft waren. Neugier spornte Bildung und Wissenschaft an, aber auch das Fernweh, das Deutsche bis 2012 zu Reiseweltmeistern machte. Solidarität, die brüderlichen und später auch schwesterlichen Gefühle von Gewerkschafts- und Genossenschaftsmitgliedern, stand Pate bei der Entwicklung des Sozialstaats. Ohne Zuneigung als Gefühl freundschaftlicher Annäherung ist schließlich die Geschichte der europäischen Einigung, wie sie sich auf verschiedenen Ebenen und mit wechselnden Akteuren vollzog und vollzieht, nicht denkbar.
Weshalb aber fiel die Wahl auf zwanzig Gefühle – und nicht auf achtzehn oder fünfundzwanzig? Tatsächlich könnte man sich mehr oder weniger vorstellen und wünschen. Jeder und jede wird etwas vermissen. Dennoch ist die Zahl 20 kein reines Zufallsprodukt. Sie passt zum 20. Jahrhundert, und sie passte zu einer Ausstellung, aus der die Idee zum Buch entstanden ist: Die Macht der Gefühle: Deutschland 19/19. Darin nahmen zwanzig Poster jeweils ein Gefühl in den Blick und illustrierten dessen Bedeutung von der Weimarer Republik bis zur Gegenwart. Die Ausstellung habe ich zusammen mit meiner Tochter Bettina entwickelt, sie war an 2500 Orten im In- und Ausland zu sehen: in Schulen, Volkshochschulen, Rathäusern, Stadtbibliotheken, Universitäten, Goethe-Instituten.[4] Sie hat große Aufmerksamkeit und Lob erfahren. Aber ihr Format ließ nur knappe Text- und Bilderläuterungen zu. Viele Besucherinnen und Besucher wünschten sich mehr Kontext, Einbettung und Differenzierung. Diesem Wunsch kommt das Buch entgegen.
Angst
Wovor haben die Deutschen Angst? Seit 1992 fragt ein Versicherungsunternehmen Jahr für Jahr etwa 2000 Personen, einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung, wie viel Angst bestimmte Themen bei ihnen auslösen. Die Liste reicht von Krankheit und Pflegebedürftigkeit über Arbeitslosigkeit, Ehekrise und Drogensucht der Kinder bis zu Gewaltkriminalität und Krieg. Je nach Bedarf wird das Spektrum um Aktuelles erweitert: 2003, nach der Jahrhundertflut, kam die Angst vor Naturkatastrophen hinzu, 2011, während der Euroschuldenkrise, die Angst vor deren Kosten. 2015 tauchte die Angst vor Überforderung durch die hohe Zahl von Geflüchteten auf, und 2018 sollte man notieren, ob die Politik des amtierenden amerikanischen Präsidenten die Welt gefährlicher machte. Prompt bekannten 69 Prozent der Befragten ihre große Angst vor Trumps Paukenschlägen.[1]
Weshalb die Versicherung das alles wissen will, ist unklar. Denn eine Police gegen Ehekrisen, Migranten oder Staatslenker, die außer Rand und Band geraten, hat sie nicht im Angebot. Allenfalls könnten Politiker die Umfragen zum Anlass nehmen, Bürgerinnen und Bürgern mehr Sicherheit zu versprechen und entsprechende Maßnahmen zu treffen. Aber auch sie kennen die Problematik »erwünschter« Antworten und deren hohe Manipulationsanfälligkeit. Wie Fragen formuliert und in welcher Reihenfolge sie gestellt werden, beeinflusst das Ergebnis. Ist Donald Trump wirklich der einzige Politiker, der ein gefährliches außenpolitisches Spiel treibt? Sicherlich nicht. Zudem liegen reale und gefühlte Gefahren oft weit auseinander. So ist das statistisch zu beziffernde Risiko, durch einen Terroranschlag zu Schaden zu kommen, sehr viel geringer als die Wahrscheinlichkeit, ermordet, bestohlen oder betrogen zu werden. Trotzdem gaben nur 28 Prozent der Befragten an, dass sie sich von Straftaten persönlich bedroht fühlten, während 59 Prozent große Angst vor Terrorismus hatten.
German Angst und deutsches Trauma?
Die Aussagekraft von Umfragen ist also begrenzt. Man darf ihnen ebenso misstrauen wie dem Gerede von der German Angst. Seit den 1980er Jahren ist es üblich geworden, den Deutschen eine besondere Ängstlichkeit zu attestieren. Sie fürchteten sich angeblich vor allem und jedem, vor Waldsterben und Verkehrstod ebenso wie vor einem Dritten Weltkrieg. 1982 identifizierte ein Spiegel-Journalist die »deutsche Angst« kurzerhand als »Bewußtseinslage der Nation« und vermerkte besorgt, dass sie »auch im Ausland das Bild der Bundesrepublik eingraut«. Ein westlicher Diplomat vertraute dem Bonner Korrespondenten des Boston Globe an, er habe »niemals ein Land gesehen, in dem das Wort Angst solche Freude auslöst. Die Deutschen lieben es, Angst zu empfinden.« Das Magazin Time titelte 1981 West Germany – Moment of Angst.[1] Während des ersten Irakkriegs reanimierten deutsche Medien und konservative Politiker den Slogan, um pazifistische Bewegungen zu diskreditieren. Und noch 2017 stellte die FDP ihren Wahlkampf unter das Motto German Mut statt German Angst.[2]
Dafür, dass Deutsche tatsächlich besonders furchtsam seien und sich stärker als andere Nationen von bestimmten oder unbestimmten Ängsten leiten ließen, gibt es keine Belege.[3] 2018 fragte die OECD 22000 Personen weltweit nach ihren persönlichen Ängsten und Sorgen. Deutsche reagierten nicht angstvoller als Niederländer, Kanadier oder Israelis. Weit über dem Durchschnitt lagen Griechen, Polen, Portugiesen und Mexikaner.[4]
Doch auch bei diesen Umfrageergebnissen ist Vorsicht geboten. Sie legen nahe, dass es in Ländern mit hohem Bruttosozialprodukt und ausgebautem Sozialstaat weniger Ängste gibt als dort, wo Volkswirtschaften nicht so erfolgreich und soziale Netze löchrig sind. Das vermuten auch sozialwissenschaftliche Studien. Menschen mit auskömmlichen materiellen Ressourcen und höherem Bildungsstand verspüren angeblich seltener Angst als jene, die von Arbeitslosigkeit, Bildungsarmut und Ressourcenknappheit betroffen sind.[5] Aber solche Indikatoren allein vermögen Angstneigungen weder zu erklären noch zu prognostizieren. Vielmehr gibt es, so argumentieren Psychoanalytiker, Ängste und Unsicherheiten, die tief in der nationalen Geschichte verwurzelt sind und von Generation zu Generation »vererbt« werden. Gewalt- und Mangelerfahrungen können Traumata erzeugen, die sich nicht nur bei der Person äußern, die sie unmittelbar erfahren hat, sondern auch bei ihren Kindern und Kindeskindern. Vor allem der Zweite Weltkrieg mit seiner unerreichten Zerstörungskraft wird oft als Auslöser tiefsitzender Ängste dingfest und für die sprichwörtliche German Angst verantwortlich gemacht.[6]
Nun hat der Krieg aber keineswegs nur Deutsche betroffen. Die Bewohner der vielen Länder, die seit 1938 von der Wehrmacht besetzt und mit Krieg und Terror überzogen wurden, hatten allen Grund, sich vor den Besatzern zu fürchten. Waren sie Juden, kam die Angst vor Denunziation, Verfolgung und Deportation hinzu. Polen und die Sowjetunion hatten insgesamt weit mehr Opfer zu beklagen als Deutschland, und Bomben fielen nicht nur auf Hamburg und Dresden, sondern auch auf Rotterdam und London.
Das spricht ebenso gegen eine spezifisch kriegsbezogene German Angst wie die Tatsache, dass Deutsche zwischen 1933 und 1945 sehr verschiedene Ängste und Ängste sehr verschieden erfuhren. Wer das »Dritte Reich« politisch ablehnte oder dessen rassistischen und eugenischen Prinzipien nicht entsprach, lebte in steter Angst davor, von den Schergen des Regimes zusammengeschlagen, verhaftet, in Konzentrationslager verbracht und ermordet zu werden. Die Mehrheit der »Volksgenossen« teilte diese Erfahrung nicht. Stattdessen bangten Frauen um ihre eingezogenen Söhne oder Ehemänner – wenn sie nicht wie jene »nationalstolze« Mannheimerin fühlten, die im September 1938 an Adolf Hitler schrieb:
»Ich bin nun knapp ein Jahr verheiratet und sollte es zu einem Krieg kommen, und ich müsste mich von meinem Manne trennen, dann werde ich nicht verzagen, und sogar stolz darauf sein, dass mein Mann unter einem solch herrlichen Führer und Feldherrn kämpfen darf.«[7]
Angst als Lähmung
Hatte diese Frau tatsächlich keine Angst? Oder verbarg sie sie nur hinter starken Gegengefühlen wie Stolz und Zuversicht? Dass man Angst durch mancherlei Techniken bannen konnte, wussten auch Soldaten und Militärpsychologen. Tod, Verwundung, Gefangenschaft waren Dinge, die man im kriegerischen Alltag besser ausblendete. Viele hatten gelernt, in der Angst ihren größten Feind zu sehen – einen Feind, der sie schachmatt setzte und ihre Angriffs- und Abwehrkräfte schwächte. Diese Sicht war weit verbreitet und konnte sich auf wissenschaftliche Expertise berufen. 1896 klassifizierte Wilhelm Wundt Angst als einen Affekt, der mit physischen Symptomen der Ermattung und Erschlaffung einhergehe.[1] Ein matter oder schlaffer Körper aber brachte keine weltbewegenden Taten zustande. Er übte sich in Vermeidungshandeln und duckte sich weg.
Tatsächlich hat sich Angst etymologisch aus dem indogermanischen Begriff des Beengtseins entwickelt und ist »urverwandt« mit dem lateinischen angustus, das ebenfalls mit Enge und Bedrängnis übersetzt wird. Der Brockhaus von 1892 ordnete ihr, ähnlich wie Wundt, folgende »beigemischte körperliche Empfindungen« zu: »Druck in der Herzgegend, Zusammenschnüren der Brust oder auch der Kehle, eigenartige Empfindungen im Unterleib, Gefühl allgemeiner Kraftlosigkeit, Verengung zahlreicher Pulsadern«. Die Ausgabe von 2006 nannte »Herzklopfen, Schweißausbrüche, Bewusstseins-, Denk- oder Wahrnehmungsstörungen, Anstieg von Puls- und Atemfrequenz«, aber auch Erschöpfungsgefühle, Gliederschwere und Muskelverspannungen. Alles in allem ein »depressiver«, mit Unlustgefühlen einhergehender »Erwartungsaffekt«, ein »meist quälender, stets beunruhigender und bedrückender Gefühlszustand«, der auf eine »vermeintliche oder tatsächliche Bedrohung« reagiere.[2] Nichts, was man herbeisehnte, zumal dann nicht, wenn die Gesellschaft und ihre Institutionen – Familie, Schule, Militär – Angst tabuisierten und als Vorform von Feigheit verachteten.
Männliches Heldentum und Angstverleugnung
Diese Verachtung traf, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein und teilweise noch darüber hinaus, vor allem Männer, die sich ihrer Angst überließen, anstatt sie zu bekämpfen. Das positive Gegenbild war der Held, der innere Ängste und äußere Widerstände überwand und den Mut aufbrachte, sich ohne Wenn und Aber in den Dienst einer Idee oder Mission zu stellen. Solche heldischen Figuren, fast sämtlich männlichen Geschlechts, bevölkerten bereits im 19. Jahrhundert die Geschichten und Erzählungen, mit denen Kinder und Jugendliche gefüttert wurden. Als Helden bewundert, verehrt und gefeiert wurden Männer, die große militärische oder staatspolitische Leistungen vollbracht hatten. Im Glanz des Heldentums konnten sich aber auch jene sonnen, die als Entdecker, Erfinder oder Wissenschaftler frei von Angst schienen und kein Risiko scheuten, ihr Ziel zu erreichen, ob es der Süd- oder Nordpol war oder das Herz Afrikas, der erste Flug über den Atlantik oder die Erforschung eines pathogenen Erregers.
Nicht allen war es gegeben, in die Fußstapfen solcher Helden zu treten. Gleichwohl sollte jeder deutsche Junge das Seine dazu beitragen, die Größe und den Ruhm der Nation zu mehren. Persönliche Ängste durften dem nicht im Wege stehen. Um sie einzuhegen, gab es verschiedene Möglichkeiten: Man unterzog sich Mutproben, wie sie in Jungengemeinschaften an der Tagesordnung waren; man schloss sich einer Verbindung an, die Schneidigkeit einübte und prämierte; man richtete sich an Vorbildern aus, wie sie in Schul- und Jugendbüchern, Spielfilmen und Wochenschauen präsentiert wurden. Ein Vorbild konnte aber auch der einfache HJ- oder Arbeitsdienstführer sein oder der Regimentskamerad, der in größter Gefahr die Ruhe bewahrte und damit den anderen die Angst nahm.
Bis in die 1960er Jahre hinein war die Jungenerziehung auf Mut, Härte und Angstüberwindung gepolt. »Ein Junge weint nicht«, hörten Kinder schon von ihren Eltern, er biss die Zähne zusammen, verkniff sich den Schmerz und stürzte sich erneut ins Kampfgetümmel. Angst war etwas für Mädchen, auf die man in einer Mischung von Geringschätzung und Großmut herabsah. Als Heulsuse beschimpft und verlacht zu werden, war für jeden Jungen eine furchtbare Kränkung. Umgekehrt konnte er sich gerade dadurch als »Mann« beweisen, dass er den ewig ängstlichen und vorsichtigen Mädchen seinen Schutz anbot. Ihre Angst ließ seine Angstfreiheit umso heller strahlen.
Solche Geschlechterbilder sind zwar noch immer nicht völlig verschwunden, im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts allerdings merklich verrutscht. Mädchen und Frauen lassen sich nicht mehr unbedingt auf die Rolle der Furchtsamen festlegen (obgleich sie angesichts des sehr realen Risikos männlicher Aggression allen Grund dazu hätten). Viele bewaffnen sich mit Pfeffersprays, belegen Selbstverteidigungskurse und üben eine selbstbewusst-starke Haltung ein, die Angreifer abschrecken soll. Männer wiederum fühlen sich dem Imperativ der Angstverleugnung weniger verpflichtet und probieren weichere Rollenmodelle aus. Das Militär, bis 1945 die maßgebliche »Schule der Männlichkeit«, hat seine verhaltensprägende Kraft verloren.
Kollektive Ängste: Inflation versus Arbeitslosigkeit
Angst ist aber nicht nur ein Gefühl, das den oder die Einzelne in bestimmten Momenten heimsucht und entweder zugelassen oder abgewehrt wird. Es gibt auch tiefsitzende kollektive Ängste, die in gesellschaftlichen und politischen Erfahrungen wurzeln. Sie werden im kulturellen Gedächtnis weitergetragen und verdichten sich zu Mustern, die weite Bevölkerungskreise teilen. Dazu gehört, nach 1945, die Angst vor Krieg und Zerstörung. Sehr viel älter ist die Angst vor Wölfen. Wer als Kind mit Grimms Märchen aufgewachsen ist, stellt sich Wölfe als grausame Raubtiere vor, die Großmütter und Geißlein fressen. Auch das erklärt die panikartige Aufregung, die die Wiederkehr der fast ausgerotteten Tiere in ostdeutschen Dörfern seit der Jahrtausendwende begleitet hat.
Rangieren Wölfe im deutschen Angstpanoptikum dennoch unter ferner liefen, nimmt die Inflation eine vordere Position ein. Seit 1922/23, als die Reichsbank Geldscheine im Akkord druckte und immer neue Markbillionen in Umlauf brachte, geht ihr Gespenst im Land um und hat sich in die Imagination seiner Bürgerinnen und Bürger eingegraben. Ein Wahlplakat von 1924 verlieh dem Gespenst ein Gesicht und versprach zugleich, es auszulöschen. Viele bürgerliche Familien verloren damals ihr Erspartes beziehungsweise das, was nach der Zeichnung von Kriegsanleihen zwischen 1914 und 1918 davon noch übrig geblieben war. Verarmte Briefeschreiber klagten in den 1920er und 1930er Jahren immer wieder, dass die Inflation sie um ihr »Geschäft und Vermögen gebracht« habe, dass sie »in Folge der Inflation in einfachen Verhältnissen« lebten oder dass sie während des Weltkriegs 25000 Goldmark eingebüßt und sich davon nie erholt hätten.[1] Nach dem Zweiten Weltkrieg und der galoppierenden Inflation, die ihm folgte, ging die Währungsreform 1948 erneut zu Lasten der Sparer aus dem mittleren und Kleinbürgertum. Sie bekamen für 100 Reichsmark lediglich 6,50 D-Mark ausgezahlt. Dagegen verbuchten die Besitzer von Sachwerten und Aktien weit geringere Verluste.
Inflationsangst und ihre Bekämpfung: Wahlwerbung der DDP 1924
Die Nachwehen dieser dramatischen Erlebnisse sind bis heute lebendig und spürbar. In vielen Familien werden die Geldscheine mit den astronomischen Ziffern von Generation zu Generation vererbt und von entsprechenden Katastrophenerzählungen begleitet. Diese Erinnerung prägt auch die Politik. Als die Finanz- und Eurokrisen die europäischen Regierungen seit 2008 in große Entscheidungsnöte brachten, wurde der deutsche Spar- und Inflationsbekämpfungskurs von ausländischen Experten scharf kritisiert. Der amerikanische Ökonom und Nobelpreisträger Paul Krugman warf den Deutschen »eine merkwürdig verzerrte Wahrnehmung der Geschichte« vor: »Jeder erinnert sich an 1923, an Weimar, an die Hyperinflation. Aber keiner denkt an 1932, an Reichskanzler Brüning, an die Depression und die Massenarbeitslosigkeit.« Der damalige Präsident der Europäischen Zentralbank Mario Draghi sprach gar von »perversen Ängsten« der Deutschen, die seiner Politik des billigen Geldes nicht zuletzt wegen der befürchteten Inflationseffekte wenig abgewinnen könnten.[2]
Ob pervers, übersteigert, fehlgeleitet oder nicht: Die Inflationsangst ist zu einem Treiber der deutschen Wirtschafts- und Finanzpolitik geworden. Allerdings hat sich, anders als Krugman behauptete, auch die Angst vor Arbeitslosigkeit keineswegs aus dem kollektiven Gedächtnis verabschiedet. Zwar nahm sie parallel zur sinkenden Arbeitslosenquote merklich ab. Als diese 2005 bei 11,7 Prozent lag, äußerten noch 65 Prozent aller Befragten große persönliche Angst vor Arbeitslosigkeit; 2018, nachdem sich die Quote mehr als halbiert hatte, waren es nur noch 25 Prozent. Doch jeder Hinweis auf eine drohende Konjunkturschwäche lässt den Angstpegel rasch nach oben schnellen. Die gleiche Wirkung erzielt die immer intensiver geführte gesellschaftliche Debatte über Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Viele Menschen betrachten solche technologischen Entwicklungen, wie vorher schon Computerisierung und Automatisierung, primär als Jobkiller und besetzen sie mit Angst – auch, aber nicht nur in Deutschland.
Angstunternehmer
Politiker stehen angesichts solcher Ängste vor einem Dilemma. Sollen sie, wie angelsächsische Ökonomen fordern, mehr Geld flüssig machen, den Konsum und die Wirtschaft ankurbeln und die Arbeitslosigkeit niedrig halten, auch auf die Gefahr einer Inflation hin? Welchen Ängsten räumen sie den Vorrang ein? Machen sie Anstalten, ihrerseits darauf einzuwirken?
Tatsächlich ist Angstmanagement zu einer zentralen Aufgabe der politischen Klasse geworden. Dafür liefern die Ansprachen hoher Staatsrepräsentanten wertvolles Anschauungsmaterial. Vor allem zu Weihnachten und Silvester wandten sich Kanzler und Präsidenten, Minister und DDR-Staatsratsvorsitzende direkt an die Bevölkerung, ab 1923 im Rundfunk, seit 1961 auch im Fernsehen. Was sie sagten, fand sich anschließend in der Zeitung gedruckt oder zitiert. Beide Termine waren prädestiniert für den innehaltenden Blick zurück und nach vorn, luden zu Introspektion und Besinnung ein. Die Reden boten entsprechende Stimmungsbilder der Nation und reflektierten, in den Worten des ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss, »die Empfindungen und Wünsche, die uns alle bewegen«.[1]
Unter jenen Empfindungen ragte Angst in den frühen Nachkriegsjahren deutlich hervor. »Der Katalog der deutschen Not und Nöte«, so Heuss an Silvester 1949, sei »unabsehbar« und ähnle einer »Kette grauen Elends«. Man sorgte sich um die Männer in Kriegsgefangenschaft, um den wirtschaftlichen Wiederaufbau, um das »Problem der Heimatvertriebenen« und um die vielen Erwerbslosen, die noch keine Arbeit gefunden hatten.[2]
Doch die Politiker brachten nicht nur das zur Sprache, was in zahllosen Briefen aus der Bevölkerung an sie herangetragen wurde. Sie betrieben auch von sich aus Gefühlspolitik, mahnten zu Geduld, suchten Ängste zu zerstreuen und weckten ▷ Hoffnung auf Besserung. Sie erklärten und begründeten Regierungsentscheidungen, warben dafür um Zustimmung und vermittelten den Eindruck, dass sie das Staatsschiff, trotz gelegentlichen Schlingerns, in stabiler Lage hielten.
Manchmal jedoch betätigten sie sich als Angstunternehmer. So nennt man die Hersteller von Waffen, Elektroschockern und Sicherheitstechnologie, deren Umsatz in den letzten Jahren rasant gestiegen ist. So nennt man aber auch Politiker, die Gefahren aufbauschen und im selben Atemzug versprechen, sie zu bändigen.[3] Beispiele dafür finden sich in der gesamten Geschichte des 20. Jahrhunderts. In Hitlers Wahlkämpfen Anfang der 1930er Jahre nahm die Angst vor Arbeitslosigkeit und Kommunismus großen Raum ein. Die CDU, 1946 gegründet, zündelte ebenfalls mit der Gefahr einer bolschewistischen Überwältigung und stellte die Sicherheit im transatlantischen Bündnis dagegen. Als Bundeskanzler Konrad Adenauer sich Weihnachten 1950 erstmals an die »Damen und Herren« des »deutschen Volkes« wandte, sprach er von seiner Sorge, »dass der Frieden einer sehr ernsten Bedrohung ausgesetzt ist«. Deren Ursprung verortete er in der »unchristlichen« Sowjetunion.[4]
Die Angst vor dem Kommunismus war in den frühen Jahren der Bundesrepublik allgegenwärtig. Auf einem Wahlplakat der Christlich-Demokratischen Union von 1949 sah man, ganz im Stil der NS-Propaganda, das rotgefärbte Gesicht eines Mannes mit asiatischen Zügen, dessen gierige Hand nach Deutschland griff. Leicht abgewandelt tauchte das Motiv bei der Bundestagswahl 1953 auf zwei weiteren CDU-Plakaten auf: Eins hetzte mit dem Slogan »Alle Wege des Marxismus führen nach Moskau« gegen die SPD