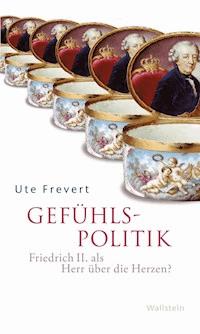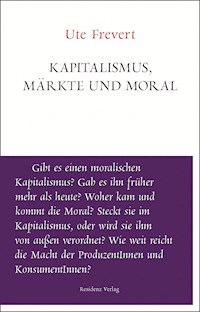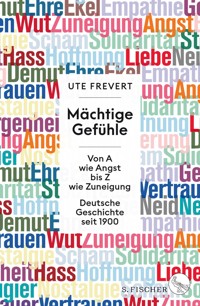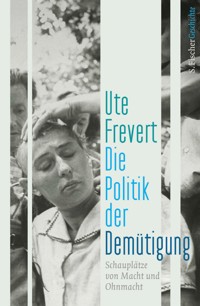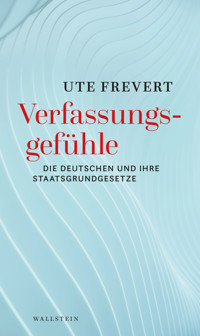
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
75 Jahre nach seiner Verabschiedung ist das Grundgesetz so beliebt wie nie zuvor. Wie aber entstehen diese Gefühle, und welche Bindungskraft entfalten sie? Ein Journalist, in Sachsen-Anhalt aufgewachsen, erinnert sich an den Trotz, mit dem er der DDR-Verfassung von 1968 begegnete. Im gleichen Jahr protestierten westlich der Elbe Zehntausende gegen die Einführung einer Notstandsverfassung, in der sie einen Angriff auf den guten Geist des Grundgesetzes erkannten. 1990 enttäuschte das wiedervereinigte Land viele seiner Bürgerinnen und Bürger, als nicht über eine gesamtdeutsche Verfassung beraten und abgestimmt wurde. Drei Jahrzehnte später stellen Prominente ebenso wie Schülerinnen und Schüler ihre »Liebeserklärungen« an das Grundgesetz ins Netz. Verfassungen lösen Gefühle aus, nicht erst seit 1949 und nicht nur in Deutschland. Welcher Art diese Gefühle sind, entscheidet über ihre Bindungskraft. Aber wie entstehen Verfassungsgefühle? Welche Hoffnungen und Erwartungen, welche Erfahrungen und Gefährdungen prägen sie? Wer hat sie, und wer vermisst sie? In diesem Buch beginnt Ute Frevert mit der revolutionären Reichsverfassung von 1848/49 und dem Herzblut, das Demokraten und Liberale in sie investierten. Sie prüft die Behauptung eines zeitgenössischen Staatsrechtlers, wonach die Verfassung von 1871 dem »Volksgefühl« lieb und teuer gewesen sei, und beschreibt die Bemühungen der Weimarer Republik, den Stolz der Bevölkerung auf die »freieste Verfassung der Welt« zu wecken. Und sie analysiert die wechselnden Verfassungsgefühle nach 1949: die Verwandlung von Desinteresse in Akzeptanz und Liebe im Westen, die Nachwirkungen plebiszitärer Zustimmung im Osten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ute Frevert
Verfassungsgefühle
Die Deutschen und ihre Staatsgrundgesetze
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Wallstein Verlag, Göttingen 2024
www.wallstein-verlag.de
Umschlaggestaltung: Wallstein Verlag
Lithografie: SchwabScantechnik, Göttingen
ISBN (Print) 978-3-8353-5768-6
ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-8757-7
ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-8758-4
Inhalt
I. Liebeserklärungen an die Verfassung – im Ernst?
II. Die Liebe zur Verfassung im Zeitalter der Konstitutionen
III. Verfassungsfragen als Machtfragen 1850–1918
IV. Verfassungskämpfe und Verfassungsfeste 1919–1932
V. Gesamtdeutsch oder gedoppelt? Mit oder ohne Volk? Verfassungskonkurrenzen 1946/49
VI. Gleichgültigkeit, Trotz, Anhänglichkeit: Deutsch-deutsche Verfassungsstimmungen 1949–1989
VII. Verfassungsgefühle in der wiedervereinigten Nation
VIII. Verfassungspatriotismus: Das höchste der Gefühle
Anhang: Vorsätze und Präambeln deutscher Staatsgrundgesetze
Dank
Abbildungsverzeichnis
Anmerkungen
Für Benjamin
I. Liebeserklärungen an die Verfassung – im Ernst?
2024 feierte man in Deutschland den 75. Geburtstag des Grundgesetzes; mit seiner Verkündung am 23. Mai 1949 begann die Geschichte der Bundesrepublik. Seine Präambel, obwohl schlicht formuliert, atmete feierliches Pathos:
Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, seine nationale und staatliche Einheit zu wahren und als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat das Deutsche Volk in den Ländern Baden, Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern, um dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben, kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beschlossen. Es hat auch für jene Deutschen gehandelt, denen mitzuwirken versagt war. Das gesamte Deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden.
Wenige Monate später, am 7. Oktober 1949, erhielten auch die Deutschen in der sowjetisch besetzten Zone einen eigenen Staat und eine eigene Verfassung. Deren Präambel kam mit weniger Worten aus und las sich nüchterner (und gottloser):
Von dem Willen erfüllt, die Freiheit und die Rechte des Menschen zu verbürgen, das Gemeinschafts- und Wirtschaftsleben in sozialer Gerechtigkeit zu gestalten, dem gesellschaftlichen Fortschritt zu dienen, die Freundschaft mit allen Völkern zu fördern und den Frieden zu sichern, hat sich das deutsche Volk diese Verfassung gegeben.
Der Anspruch aber war ein ähnlicher: Auch die DDR-Verfassung verstand sich als ein Dokument der Friedens- und Freiheitswahrung, schützte die Rechte ihrer Bürger und legte fest, dass »Deutschland« eine »unteilbare demokratische Republik« föderalen Zuschnitts sei. Zugleich sprach sie, ebenso wie das Grundgesetz, das »deutsche Volk in seiner Gesamtheit« an.
Anspruch und Wirklichkeit fielen jedoch schon 1949 weit auseinander, und die doppelte Staatsgründung markierte den Anfang einer vierzigjährigen Trennungsgeschichte. An ihrem Ende standen die Friedliche Revolution 1989 in der DDR und die Wiedervereinigung ein Jahr später. Am 3. Oktober 1990 trat die DDR durch ein Votum der Volkskammer dem Geltungsbereich des Grundgesetzes bei. Die neue Präambel trug dem Rechnung und befand, die Deutschen in Ost und West hätten nunmehr »in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte Deutsche Volk.«
Dieses Volk zollt ihm offensichtlich große Anerkennung. Nach ihrer Einstellung zum Grundgesetz befragt, bekundeten 2023 83 Prozent der Bürgerinnen und Bürger großes oder ziemlich großes Vertrauen.[1] Manche richteten »Liebeserklärungen« an die Verfassung, andere schrieben Gedichte oder malten Poster zu ihren Ehren. 2018 zeigten junge Leute auf einem Chemnitzer Konzert gegen Rechtsextremismus ein Transparent mit der Aufschrift »Grundgesetz ist geil«. Das inspirierte einen Journalisten und einen Grafiker zu einem peppigen Grundgesetz-Magazin, das sich blendend verkaufte. Auch die Geburtstage der Verfassung werden in großem Stil und mit entsprechendem Medienecho begangen. Zum 70. Jahrestag empfing der Bundespräsident 200 Bürgerinnen und Bürger zu einer Kaffeetafel im Garten seines Berliner Amtssitzes; in Bonn diskutierte er mit Studierenden sowie mit Schülerinnen und Schülern darüber, was das Grundgesetz mit ihrem Leben zu tun habe. In seiner Kinder- und Jugendsendung neuneinhalb ging der Westdeutsche Rundfunk auf Spurensuche und befragte seine Hörerinnen und Hörer, was ihnen im Grundgesetz noch fehle. 2024 gab es erneut ein eindrucksvolles politisches Festprogramm: Während die Stadt Bonn ein inklusives Fest der Demokratie veranstaltete, feierte man in Berlin drei Tage lang das Doppeljubiläum 75 Jahre Grundgesetz und 35 Jahre Friedliche Revolution. Alle waren eingeladen, und viele, viele kamen.
Die Verfassung steht also, könnte man daraus schließen, in der Bürgerschaft wie bei Amtsträgern in hohem Ansehen. Sie genießt Respekt und Vertrauen, ruft zuweilen sogar Liebe hervor. Das Bundesverfassungsgericht als Hüter der Verfassung erfreut sich ebenfalls größter Wertschätzung. Bei der Frage, welchen politischen Institutionen man vertraut, erreicht es seit Jahren regelmäßig Höchstwerte und lässt Parlament und Regierung weit hinter sich.
Doch es gibt, teils laut, teils leise, auch Zweifel an dieser Erfolgsstory: Ist die Akzeptanz des Grundgesetzes belastbar und krisenresistent? Kann sie mit dem Verfassungspatriotismus mithalten, wie er in skandinavischen Ländern und den USA verbreitet ist? Wie fest stehen Bürgerinnen und Bürger hinter ihrer Verfassung, wenn sie von extremen politischen Gruppierungen verhöhnt und bedrängt wird? Solche Angriffe sind keine blasse Theorie. Auf ihrem Potsdamer Geheimtreffen im November 2023 diskutierten mehr oder weniger prominente Rechtsradikale verschiedene Mittel, die parlamentarische Demokratie zu schwächen. Wahlergebnisse sollten, wie es Anhänger Donald Trumps in den USA vorgemacht hatten, angezweifelt und öffentlich-rechtliche Medien bekämpft werden. Besonders wichtig schien es, das Verfassungsgericht zu diskreditieren – also jene politische Institution, die den Deutschen am liebsten ist.[2] In ihrem Bemühen, die demokratische Ordnung zu destabilisieren, arbeiten Rechtsextreme und russische Trolle Hand in Hand. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Mahnung des Bundespräsidenten an Gewicht, die Verfassung verliere an dem Tag ihre Gültigkeit, »an dem sie uns gleichgültig wird«.[3]
Zwischen Gleichgültigkeit und Liebe liegt eine große Spannbreite; fügt man Misstrauen und blanke Verachtung hinzu, wie sie in Potsdam und anderswo bekundet wurden, dehnt sich diese noch weiter aus. Das Spektrum der Gefühle, die Verfassungen produzieren und auf sich ziehen, auszuleuchten und historisch einzuordnen, ist die Absicht dieses Buches. Sein Thema sind Verfassungsgefühle und wie sie funktionieren. Wer fühlt sich der Verfassung seines Landes nah und verbunden, wem ist sie egal, wer lehnt sie ab? Welche Interessen und Erfahrungen stehen jeweils dahinter?
Verfassungsgefühle sind mehr als luftige Erwartungen und spontane Meinungen. Sie äußern sich in einem Überschuss an positiven oder negativen Einstellungen, verbinden sich mit persönlichen Zu- und Abneigungen. Sie haben expressiv-symbolische und performative Seiten, die sich in Feiern, Gedenktagen und Festen manifestieren und teils individuell, teils kollektiv praktiziert werden. Sie sind Teil einer Verfassungskultur, die sich darin zeigt, wie stark die Verfassung öffentlich präsent ist und wie sich Bürgerinnen und Bürger, aber auch staatliche Institutionen und zivilgesellschaftliche Organisationen zu ihr positionieren.[4] Verfassungskulturen unterscheiden sich nicht zuletzt dadurch, welchen Raum sie dem Ausdruck von Gefühlen, Empfindungen, Leidenschaften geben und in welcher visuellen und klanglichen, aber auch gestisch-mimisch-verbalen Sprache sich dieser Ausdruck vollzieht. Welche Bilder über die Verfassung und ihre Verkündung zirkulieren, wie Konflikte um ihre Interpretation und Geltung ausgetragen werden, welche Erzählungen darüber im Umlauf sind – all das markiert den Platz und den Stellenwert einer Verfassung in ihrer jeweiligen Kultur und Gesellschaft.
Gefühle spielen in dieser Arena eine zentrale Rolle. Schriftlich niedergelegte Verfassungen, die die Machtteilung zwischen vormaligen Untertanen und Fürsten beurkunden und allgemeine Bürgerrechte absichern, werden seit dem späten 18. Jahrhundert Objekte des Begehrens, des leidenschaftlichen Wünschens und Wollens. Diejenigen, die für sie kämpfen, verbinden damit den Aufbruch zu individueller Freiheit und politischer Partizipation. Für ihre Gegner sind Konstitutionen Ausgeburten des Umsturzes und Verrats. Nachdem sie sich im 19. Jahrhundert als fester Bestandteil moderner Staatlichkeit etablieren können, schwindet ihre beinahe magische Attraktion und weicht einer nüchternen Sicht. Dies ändert sich in den revolutionären Umbruchsituationen, die viele mittel- und osteuropäische Länder nach dem Ende des Ersten Weltkriegs erleben. Erneut richten sich große Hoffnungen und helle Zukunftserwartungen auf die neue Verfassungsordnung. Aber sie zieht auch, weit rechts ebenso wie weit links und besonders in Deutschland, Verachtung, Hass und Ressentiment auf sich. Nach dem Zweiten Weltkrieg kühlen die Gefühle deutlich ab, die die Menschen im geteilten Land ihren Verfassungen entgegenbringen. Weder das Grundgesetz noch die Verfassung der DDR werden von den Bürgerinnen und Bürgern, für die sie Geltung beanspruchen, sonderlich wahrgenommen, geschweige denn mit starken positiven oder negativen Aspirationen belegt.
Ein Umschwung setzt erst, zumindest in der Bundesrepublik, mit den 1970er Jahren ein. Fortan versteht man das Grundgesetz nicht mehr bloß als Normen- und Organisationsplan des Staates, sondern verbindet es je länger, desto intensiver mit Wertorientierungen und Wertkonflikten der Gesellschaft.[5] Dies wiederum erhöht das emotionale Investment und die Gefühlstemperatur. Normen und Organisationsstatute kommen ohne Gefühle aus, Werte nicht. Wer etwas wertschätzt und ihm einen Wert beilegt, ist emotional beteiligt. Umgekehrt löst die Verletzung einer Norm allenfalls Befremden aus, während die Verletzung eines Wertes auf Empörung und Entrüstung stößt. Die Nobilitierung des Grundgesetzes als eines wertbasierten und wertgenerierenden Textes geht daher mit seiner Emotionalisierung einher.
Emotionalisierung heißt nicht nur, dass die Verfassung die Bevölkerung nicht kalt lässt. Gefühle zeigen Wirkung, indem sie Menschen dazu bewegen, das eine zu tun und das andere zu lassen.[6] Gerade Verfassungen, die auf »Verwirklichung« angelegt sind, brauchen emotionale Treiber.[7] Wer seine Verfassung achtet, vielleicht sogar liebt, verhält sich politisch und gesellschaftlich anders als jene, die das nicht tun, in Worten ebenso wie in Taten. Aus diesem Grund ist es alles andere als trivial, nach Verfassungsgefühlen Ausschau zu halten und ihre Valenz zu prüfen. Rechtshistoriker, Juristen und Politologen haben darauf bislang verzichtet, aber wichtige Werke über die Geschichte diverser Verfassungen und ihrer wechselnden Inhalte geschrieben, auf die hier dankbar zurückgegriffen wird. Im Zentrum dieses Buches stehen jedoch weder die konkreten Prozesse der Verfassunggebung noch die Analyse von Verfassungsbestimmungen oder die Frage nach deren jeweiliger Effizienz und Reichweite. Vielmehr geht es um die breitere gesellschaftliche Einbettung und Resonanz von Verfassungen und um die Gefühle, die sich darin artikulieren. Letztere sind keineswegs nur dekorative Beigabe oder volkstümliche Begleitmusik zu einem von Juristen und Politikern auf großer Bühne aufgeführten Stück. Sie geben der Aufführung erst Rahmung, Richtung und Breitenwirkung. Was der Publizist Dolf Sternberger bereits 1947 »lebende Verfassung« genannt hat, würde ohne Verfassungsgefühle jämmerlich dahinsiechen.[8]
Sternberger gilt als derjenige, der 1970 den Begriff »Verfassungspatriotismus« erfunden und in die öffentliche Diskussion eingeführt hat. Aber bereits in den 1950er Jahren machte der Rechts- und Politikwissenschaftler Karl Loewenstein auf die Existenz und Wirkmächtigkeit von Verfassungsgefühlen aufmerksam. 1960 hielt er, der 1933 als Jude aus dem Staatsdienst entlassen wurde und in die USA emigriert war, vor der Berliner Juristischen Gesellschaft einen Vortrag, in dem er das Verfassungsgefühl als »eine der sozialpsychologisch und soziologisch am schwersten zu erfassenden Erscheinungen« des politischen Lebens beschrieb. Geprägt hat er den Begriff mit Blick auf seine Exilheimat. Zwar betrachtete er die »Mythologisierung« der amerikanischen constitution mit einiger Skepsis, meinte aber doch, eine Verfassung müsse »für ihr Volk eine andere, eine höhere Geltung haben als die täglichen Produkte seiner Gesetzgebungsmühlen«. Eben diese höhere Geltung vermisste er in den europäischen Nachkriegsgesellschaften: »In unserer Zeit hat das Volk – und dies gilt von der breiten Masse ebenso wie von der Mehrheit der Intellektuellen – kein persönliches Verhältnis mehr zu seiner Verfassung.« Das fiel ihm auch und besonders in der Bundesrepublik auf, deren Bürger ihrem Staat und ihrer Verfassung mit einer aus seiner Sicht beängstigenden Gleichgültigkeit begegneten. Beängstigend fand Loewenstein sie deshalb, weil er sich schwer vorstellen konnte, wie aus dieser »Entfremdung« ein funktionierendes, stabiles und gut integriertes Gemeinwesen entstehen würde.[9]
Dass sich seine Befürchtungen nicht bewahrheiteten, heißt nicht, dass Ängste und Vorbehalte völlig verflogen sind. Über das rechte, bekömmliche Maß an positiven Verfassungsgefühlen wird auch heute wieder kontrovers debattiert, Steinmeiers Mahnung steht nicht allein. Aber wo liegt das rechte und bekömmliche Maß? In der Geschichte finden sich ganz unterschiedliche Temperaturanzeigen zwischen heiß und kalt, warm und lau. Die emotionale Ökonomie von Verfassungen und der Stellenwert, den sie für die Lebensführung und Wertvorstellungen der Menschen besaßen, sind historisch variabel. Je nachdem was auf dem Spiel steht und verfassungsrechtlich geregelt werden soll, färben sich die Erwartungen, Hoffnungen, Sehnsüchte und »Leidenschaften« der Nation anders ein.
Von »Leidenschaft« sprach man vor allem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts viel und gern. Wer im damaligen »Zeitalter der Constitutionen« vom »constitutionellen Geiste« ergriffen war – und das waren nicht wenige, Männer wie Frauen –, der oder die wussten, wofür sie kämpfen wollten: Freiheit und nationale Einheit hießen die Schlagworte, die in jeder liberalen oder demokratischen Rede, in jedem politischen Gespräch auftauchten. Damit verbanden sich »Enthusiasmus«, »tiefes Gefühl«, »heilige Empfindung« und »Liebe«. Verfassungen sollten die gewünschte Ordnung begründen und sichern. Dort, wo es sie bereits gab – in Bayern, Baden und Württemberg –, ging es darum, sie vor fürstlichen Übergriffen zu bewahren und freiheitlich zu verbessern. Als der König von Hannover 1837 das liberale Staatsgrundgesetz aufhob, stellten sich ihm sieben Professoren der Göttinger Universität mutig entgegen. Ihr Protest wurde in ganz Deutschland bejubelt. Einige von ihnen arbeiteten ein Jahrzehnt später an den Verfassungsentwürfen der Frankfurter Paulskirchenversammlung mit.
Auf diese 1849 verabschiedete »Reichsverfassung« projizierten Hunderttausende ihre Sehnsucht nach einem Nationalstaat, der Freiheit und Einheit zusammenführte. Auch nachdem sie gescheitert war, lebte sie in der Erinnerung fort. In den 1860er Jahren diente sie jenen als Referenzpunkt, die den Traum von der Reichseinheit noch nicht beerdigt hatten und landein, landaus dafür trommelten. Im Norddeutschen Bund 1867 und in der vier Jahre später erfolgten Reichsgründung schien sich dieser Traum zu erfüllen. Das prachtvolle Original der Verfassungsurkunde von 1849, von einem Frankfurter Anwalt trotz Repressionen sicher verwahrt und gerettet, ging 1870 in die Obhut des Reichstags über und wurde dort von Journalisten und Besuchern ehrfürchtig bestaunt.
Zugleich aber ebbte das öffentliche Interesse an Verfassungsfragen merklich ab. Die großen Kontroversen waren ausgefochten, die erbitterten Kämpfe um Bürgerrechte und politische Mitwirkung beendet, wenn auch nicht zur Zufriedenheit aller. Bismarcks Verfassung mobilisierte keine heiße Leidenschaft mehr, weder bei ihren Fürsprechern noch bei ihren Kritikern. Erst als das Kaiserreich mit dem Ende des Ersten Weltkrieges unterging, hatten Verfassungsgefühle wieder Konjunktur. Heftiger Streit entzündete sich an der Frage, in welcher politischen Ordnung die Deutschen fortan leben wollten. Die einen wünschten sich eine Republik, andere trauerten der Monar-chie nach. Manche plädierten für Räte nach russisch-revolutionärem Vorbild. Die meisten neigten dem parlamentarischen Modell zu, auch wenn sie damit unterschiedliche Vorstellungen verbanden. Um konzentriert und ungestört von politischen Aufständen in der aufgereizten Stimmung nach Kriegsende ihrer Arbeit nachgehen zu können, musste die verfassunggebende Nationalversammlung in Weimar tagen. Gleichwohl verschwand sie dort nicht aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. Die Presse informierte regelmäßig über den Fortgang der Beratungen und mischte sich laut und meinungsstark ein.
Der politische Streit endete nicht mit dem 11. August 1919, als Reichspräsident Friedrich Ebert die Verfassung unterzeichnete. Er begleitete die stürmischen Anfangsjahre der Weimarer Republik, köchelte auf kleinerer Flamme weiter und loderte seit 1930 erneut auf. Das lässt sich nicht zuletzt daran ablesen, wie der Verfassungstag begangen wurde. Anders als im Kaiserreich wollte die republikanische Regierung die Verfassung zum symbolischen Fluchtpunkt ihres Selbstverständnisses machen. Alljährlich sollte daher der 11. August gefeiert werden, in Schulen und Universitäten ebenso wie in der Stadt- oder Dorfgemeinde. Doch ließen sich längst nicht alle Bürgerinnen und Bürger davon beeindrucken, vielerorts kam es zu Gegenveranstaltungen oder Boykotten. In diesen Auseinandersetzungen prallten positive und negative Verfassungsgefühle hart aufeinander. Am Ende siegten die Verfassungsgegner. Für die NSDAP war der Verfassungstag ohnehin nur »Karneval« (Joseph Goebbels), den man entweder ignorierte oder störte. Im nationalsozialistischen Festkalender seit 1933 spielte er keine Rolle. Eine eigene, neue Verfassung gab sich das Dritte Reich nicht; formell blieb die Weimarer Verfassung in Kraft, was aber niemanden kümmerte.
Positive Gefühle vermochte diese Verfassung nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes nicht mehr zu wecken. Dafür standen ihre Schwächen und Mängel denen, die die Weimarer Agonie miterlebt hatten, nur allzu deutlich vor Augen. Andererseits war klar, dass es ohne ein Staatsgrundgesetz in Deutschland nicht weitergehen könnte und würde. Auf Anweisung der alliierten Besatzungsmächte begann die Verfassunggebung in den Ländern, die sich traditionell als Grundbestandteile einer föderativen Ordnung begriffen. Komplizierter gestaltete sich der Prozess auf zentraler Ebene. Die Geschichte des Parlamentarischen Rates, der 1948/49 in Bonn tagte und das Grundgesetz ausarbeitete, war reich an Dramatik, mit schweren Zerwürfnissen zwischen den großen Parteien und häufigen Interventionen der Westmächte, die keineswegs immer mit einer Stimme sprachen. Die Paralleldebatte in Ostberlin verlief dank der Durchgriffsmacht der SED stromlinienförmiger.
Auch die Öffentlichkeit war informiert und einbezogen, im Osten sogar stärker als im Westen. Allerdings gaben 1949 40 Prozent der Westdeutschen an, die Verfassung sei ihnen gleichgültig; ein weiteres Drittel zeigte sich »mäßig interessiert«. Sechs Jahre später gestanden 51 Prozent der Befragten, das neue »Staatsgrundgesetz« nicht zu kennen.[10] Da in der DDR keine Umfragen stattfanden, weiß man wenig darüber, was die Bürgerinnen und Bürger von ihrer Verfassung hielten. Leidenschaftliche Diskussionen löste sie jedenfalls nicht aus; die Menschen, und das gilt für die im Osten wie im Westen des geteilten Landes, hatten damals schlichtweg anderes zu tun, als sich mit der politischen Zukunft zu befassen.
Wie und warum aber kam es dazu, dass die auch von Loewenstein beobachtete indifferente Haltung einer breiten, zuweilen emphatischen Zustimmung wich? Was bedeutet es für die Stabilität der politischen Ordnung, wenn heute mehr als vier Fünftel der Bevölkerung eine gute oder ziemlich gute Meinung vom Grundgesetz haben? Hat man sich einfach nur gewöhnt und behaglich eingerichtet in den 147 Artikeln, von denen die meisten im Alltagsleben der Bevölkerung keine große Rolle spielen? Oder ist das Grundgesetz gerade deshalb so beliebt, weil es, analog zur Geschichte des frühen 19. Jahrhunderts, immer wieder herausgefordert wurde und heftig umkämpft war? Zwar blieb das Gros seiner Änderungen seit 1949 von der breiten Öffentlichkeit unbemerkt. Umso eindrücklicher und eindringlicher aber waren die politischen Streitfragen, in denen das Grundgesetz zum zentralen Bezugspunkt wurde und das Bundesverfassungsgericht entscheiden musste. Dazu gehörten, um nur einige zu nennen, die Wiederbewaffnung 1955, die Notstandsgesetze 1968, der Grundlagenvertrag 1972, die Fristenlösung beim Schwangerschaftsabbruch 1974, die Einschränkung des Asylrechts 1993 und, last but not least, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Klimaschutzpolitik 2021.
Längst nicht alle Karlsruher Urteilssprüche trafen auf ungeteilte Akzeptanz. Doch hat die häufige Berufung auf das Grundgesetz in politischen Kontroversen erheblich dazu beigetragen, dessen Stellenwert im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Liebeserklärungen an die Verfassung, so übertrieben sie manchen vorkommen mögen – in den 1840er Jahren hätte sich niemand darüber gewundert –, bezogen sich oft auf solche Konflikte und auf die Orientierungsleistung, die das Grundgesetz dafür anbot. Auch die aktuellen Auseinandersetzungen mit der und um die AfD bestätigen das: Bei der breit diskutierten Frage, ob eine Partei, die in manchen Bundesländern über ein Drittel der Wahlstimmen für sich verbucht, verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, steht das Grundgesetz als Referenz im Mittelpunkt. Die hohe gesellschaftliche Mobilisierung, die der Nachricht über das Potsdamer Geheimtreffen rechtsextremer Kreise im November 2023 folgte, tat ein Übriges: Sie suchte die Verfassung vor ihren Verächtern zu schützen und demonstrierte die Macht, die Verfassungsgefühle jenseits von Partei- und Milieugrenzen entfalten können.
Damit schloss sie, ohne es zu wissen, an Erfahrungen des frühen 19. Jahrhunderts an. Damals liebte man die Verfassung vor allem, wenn sie unter Druck stand und von reaktionären Kräften bekämpft wurde oder gegen deren massiven Widerstand erstritten werden musste. Die Liebe zum »Staatsgrundgesetz«, so viele Wünsche es auch offenließ, war ein Gefühl des Aufbruchs in eine bessere, demokratischere Zukunft. Wer sich zu dieser Liebe bekannte, erinnerte die Zustände ohne Verfassung und die harten Kämpfe um ihre Ausgestaltung. Aber er – damals waren politische Akteure überwiegend Männer – ruhte sich nicht selbstzufrieden auf dem Erreichten aus. Die Verfassung zu lieben verlangte zugleich, sie kraftvoll zu verteidigen, zu verbessern und den Bedürfnissen der Zeit anzupassen. Selbst wenn die Sprache, in der sich Gefühle und Bedürfnisse damals äußerten, zweihundert Jahre später pathetisch klingt, ist ihre Botschaft alles andere als veraltet.
II. Die Liebe zur Verfassung im Zeitalter der Konstitutionen
»Es ist heute«, schrieb der badische Hofrat Carl von Rotteck 1830, »ganz eigens das Zeitalter der Constitutionen. Alles ruft nach ihnen, oder bestreitet sie, preist oder verwirft sie.« Auf welcher Seite der liberale Professor und Politiker stand, war bekannt: selbstverständlich auf der der »Constitution«, worunter er die »rechtsgemäße und auf Grundsätzen beruhende Verfassung des Staates« verstand. Sie regelte nicht nur das Verhältnis der »Staatsgewalten« zueinander, sondern enthielt auch Bestimmungen über die Rechte und Pflichten der Bürger.[1]
Solche Konstitutionen, Verfassungen oder Staatsgrundgesetze – all diese Begriffe waren damals im Umlauf – gab es bereits, allerdings nicht überall. Die Vereinigten Staaten von Amerika hatten sich 1787 eine Verfassung gegeben. Als sie zwei Jahre später in Kraft trat, dauerte es nur noch wenige Monate, bis in Frankreich die Revolution ausbrach. Schon im August 1789 legte die Pariser Nationalversammlung mit der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte ein Verfassungsdokument vor, das diese Rechte garantierte sowie die Gewaltenteilung festschrieb. In der Präambel betonten die Volksvertreter, die Erklärung solle die Bürger »unablässig an ihre Rechte und Pflichten« erinnern,
damit die Handlungen der gesetzgebenden wie der ausübenden Gewalt in jedem Augenblick mit dem Endzweck jeder politischen Einrichtung verglichen werden können und dadurch mehr geachtet werden; damit die Ansprüche der Bürger, fortan auf einfache und unbestreitbare Grundsätze begründet, sich immer auf die Erhaltung der Verfassung und das Allgemeinwohl richten mögen.[2]
Welche Bedeutung dieser Erklärung zukam, zeigt sich an der Art ihrer Popularisierung. Wenn den Mitgliedern der französischen Nation ihre »natürlichen, unveräußerlichen und heiligen Rechte beständig vor Augen« sein sollten, musste man sie ihnen vor Augen führen. Eine eindrucksvolle Präsentation war das Ölgemälde, das der Maler Jean-Jacques-François Le Barbier wohl noch im gleichen Jahr anfertigte und das als Druckgrafik und Tapete große Verbreitung fand.[3] Es bildete die siebzehn Artikel auf zwei monumentalen Gesetzestafeln ab. Über ihnen ist eine jüngere Frau im einfachen roten Kleid platziert, kräftig und schmucklos. Sie hat ihre Ketten gesprengt und trägt nun die königliche Krone und den königlichen Mantel in blauer Farbe mit goldenen Lilien. Ihr Blick richtet sich auf einen Engel, der seinerseits den Betrachter anschaut. Mit der linken Hand deutet er auf die Gesetzestafeln, während die rechte ein Zepter hält und damit auf das über allem thronende Auge Gottes zeigt. Die Bildaussage war unmittelbar verständlich: Hier hatte sich die Nation aus ihren Fesseln befreit und ihre heiligen Rechte zurückerobert. Sie waren in Stein gemeißelt und gesetzlich fixiert (darauf verwies das römische Liktorenbündel zwischen den Tafeln). Dass hier eine direkte Verbindung zum Alten Testament gezogen wurde, als Gott Moses die zehn Gebote übergab, begriff jedes Kind.
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, Gemälde von Jean-Jacques-François Le Barbier, ca. 1789
Die solcherart sakralisierte Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte war allerdings noch keine Verfassung. Erst 1791 verabschiedete die Nationalversammlung eine vollgültige constitution und stellte ihr die déclaration von 1789 voran. Damit war Frankreich zur konstitutionellen Monarchie geworden, zwei Jahre später folgte die Republik. Großen Wert legte die Konstituante darauf, den Text und seinen Inhalt im Volk bekannt und beliebt zu machen. Dazu dienten nicht zuletzt nationale Feste, die die Bürger »an die Verfassung, das Vaterland und die Gesetze« binden sollten. Inspiration bezog man aus den amerikanischen Bundesstaaten, wo schon 1788 federal processions zu Ehren der Verfassung stattgefunden hatten. Manche Prozessionen führten eine Druckerpresse mit, die die Verfassung oder an sie gerichtete Oden vor Ort vervielfältigte; die Kopien wurden an die Zuschauenden verteilt.[4] Bei den französischen Festzügen stand das Verfassungsdokument ebenfalls im Mittelpunkt, und die Teilnehmenden legten gemeinsam und feierlich den Eid darauf ab. Religiöse Verweise gehörten, wie bei den Gesetzestafeln, zum Programm und woben einen Hauch von Heiligkeit in die neue säkulare Ordnung. Große Wirkung erzielte das 1793 in Paris veranstaltete Einheitsfest, das der Maler Jacques-Louis David als Mitglied des Nationalkonvents organisierte. Es endete mit dem kollektiv geleisteten Schwur, die neue republikanische Verfassung unter Einsatz des eigenen Lebens zu verteidigen. Die Verfassungstafeln sowie die Urkunde über die erfolgte Volksabstimmung wurden sodann in einer heiligen Lade verwahrt.[5]
Östlich des Rheins beobachtete man die Ereignisse in Frankreich sehr aufmerksam und mit gemischten Gefühlen. Selbst jene, denen vor den Gewaltexzessen der Revolution und der jakobinischen Terrorherrschaft schauderte, konnten dem Verfassungskultus einiges abgewinnen. In den 1790er Jahren wurden auch in deutschen Landen Forderungen nach »Constitutionen« lauter, und es kursierten diverse Entwürfe. Doch dauerte es noch bis zur Auflösung des altehrwürdigen Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation 1806, dass in den nunmehr unter napoleonischem Einfluss stehenden Rheinbund-Staaten eine Phase intensiver politischer Reformen einsetzte. In Bayern erließ der König bereits 1808 eine »Konstitution«, und auch in Baden bereitete man sich darauf vor.[6] Dass die Verfassungsbewegung sogar vor dem spätabsolutistischen Preußen nicht Halt machte, zeigte sich 1810, als Friedrich Wilhelm III. seinen Untertanen höhere Konsumtionssteuern abverlangte und ihnen im Gegenzug »eine zweckmäßig eingerichtete Repräsentation, sowohl in den Provinzen als für das Ganze« versprach.[7] Doch das Versprechen, 1815 erneuert, wurde nicht eingelöst. Selbst die Bestimmung der auf dem Wiener Kongress verhandelten Bundesakte, wonach in allen Mitgliedsstaaten des neugeschaffenen Deutschen Bundes »eine landständische Verfassung stattfinden« sollte, drang nicht bis ins Berliner Stadtschloss durch.[8]
Dafür fand sie in den besser präparierten süddeutschen Staaten umso mehr Gehör. In Baden stürzte sich Carl von Rotteck in die Verfassungsarbeit, und auch in Bayern und Württemberg begannen intensive Verhandlungen und Beratungen.[9] Trotzdem ging es manchen nicht schnell genug. 1817 trafen sich etwa 500 Studenten aus mehreren deutschen Universitäten auf der thüringischen Wartburg, um ein »Nationalfest« zu feiern und ihren Unmut über die aus ihrer Sicht stagnierende politische Entwicklung in Deutschland zu äußern. In ihren Reden und Liedern beschworen sie die auf den Schlachtfeldern der antinapoleonischen Kriege erlebte Einheit des Vaterlandes und forderten das Ende von Kleinstaaterei und fürstlicher Willkürherrschaft. Nur ein einziger Landesherr, der Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, habe bislang die Wiener Bestimmung befolgt und seinen Untertanen eine liberale Verfassung gegeben. Gemeinsam ließen ihn die Studenten hochleben und bedankten sich für die Gastfreundschaft:
Das dritte Hoch! wir rufen’s frei Dir Herzog! hier zu Lande,Der Du Dein Wort gelöset treu,Wie Du es gabst zum Pfande.Verfassung heißt das eine Wort,Des Volkes und des Thrones Hort![10]
Die Verfassung, die ihnen für ganz Deutschland vorschwebte, war die einer konstitutionellen Monarchie, deren Minister dem Parlament verantwortlich waren und die den Schutz bürgerlicher Grundrechte garantierte.
Damit waren sie ihrer Zeit weit voraus. Der Ruf nach einem nationalen Vaterland, für das die Studenten »heiligste Gefühle« und »Begeisterung« hegten, kam bei den Fürsten des Deutschen Bundes nicht gut an, und die Verbindung von Einheit und Freiheit weckte das Misstrauen konservativer Zeitgenossen. Auch Hans Christoph von Gagern, niederländischer Gesandter beim Frankfurter Bundestag, stand den burschenschaftlichen Aktivitäten seines Sohnes Heinrich ablehnend gegenüber. Heinrich wiederum, der schon als 15-Jähriger vor Waterloo gegen Napoleons Armee gekämpft hatte, schrieb dem Vater selbstbewusst aus Jena:
Wir wünschen uns eine Verfassung für das Volk nach dem Zeitgeiste und nach der Aufklärung desselben, nicht daß jeder Fürst seinem Volke gibt, was er Lust hat und wie es seinem Privatinteresse dienlich ist. Überhaupt wünschen wir, daß die Fürsten davon ausgehen und überzeugt sein möchten, daß sie des Landes wegen, nicht aber das Land ihretwegen existiere. Die bestehende Meinung ist auch, daß überhaupt die Verfassung nicht von den einzelnen Staaten ausgehen solle, sondern daß die eigentlichen Grundzüge der deutschen Verfassung gemeinschaftlich sein sollten.[11]
Während sich der junge Burschenschafter an vaterländischen Verfassungsentwürfen versuchte, arbeitete der Deutsche Bund mit Hochdruck daran, die nationalen und freiheitlichen Bewegungen zu stoppen. Schon 1817 sahen sich die Teilnehmer des Wartburgfests bei ihrer Rückkehr mit polizeilichen Repressionen konfrontiert. Mit den zwei Jahre später gefassten Karlsbader Beschlüssen wurden dann Meinungs- und Pressefreiheit suspendiert, Burschenschaften verboten und liberale Professoren ihrer Ämter enthoben. »Todähnliche Ruhe«, hieß es 1832 in einer Adresse vom Niederrhein, herrsche in vielen Teilen des Landes. »Ausgesogen von 34 Königen« und »beraubt durch verrätherische Aristokratenfamilien«, biete Deutschland ein Bild des »Jammers« und der Ohnmacht, sekundierte der liberale Journalist und Anwalt Johann Georg Wirth.[12]
Um etwas dagegen zu tun, organisierte Wirth im Mai 1832, zusammen mit seinem Kollegen Philipp Jakob Siebenpfeiffer, im bayerischen Rheinkreis erneut ein »Nationalfest«, an dem 30.000 Männer und Frauen aus ganz Deutschland teilnahmen. Die Metapher des Frühlings war allgegenwärtig. So wie im Wonnemonat Mai die Natur erwache, solle auch Deutschland seinen »Völker-Mai« erleben. Hoffnungen auf einen »politischen Umschwung« knüpften sich an die französische Juli-Revolution, die 1830 eine liberale Monarchie in den Sattel gehoben hatte, und an den polnischen Aufstand gegen die Zarenherrschaft im gleichen Jahr. Mehrere polnische Emigranten sprachen auf dem Hambacher Fest, andere schickten Freundschaftsadressen.
Ursprünglich hatte ein Neustädter Geschäftsmann ohne Nennung seines Namens die Bewohner der Rheinpfalz zu einem »Constitutionsfest« am 26. Mai 1832 auf dem Hambacher Schlossberg eingeladen. Traditionell wurde an diesem Tag dem Königshaus gehuldigt und für die 1818 aus »freyem Entschlusse« gegebene Verfassung gedankt. Obwohl ein monarchischer Oktroi, hatte sich die »Magna Charta Bavariae« dank zahlreicher Gedenkmünzen, Denkmäler und Bilder einen festen Platz im kollektiven Gedächtnis erobert. Seit 1828 schmückte ein Fresko die Arkaden des Münchner Hofgartens. Darauf war der Eid Max I. Josephs auf die Verfassung unter den Augen eines auf der Tribüne versammelten bürgerlichen Publikums zu sehen. Als Kupferstich wurde das Fresko vielfach reproduziert. Auch wenn es den historischen Abläufen nicht in jedem Detail entsprach, vermittelte es der Öffentlichkeit das Bild eines Monarchen, der sich an seine Verfassung gebunden fühlte und im Einklang mit den politischen Institutionen handelte.[13]
König Maximilian Joseph giebt seinem Volke die Verfassungs Urkunde 1818, Kupferstich von Carl Friedrich Heinzmann, ca. 1840
Dieses Bild verbreiteten auch zeitgenössische populäre Schriften, die sich an »Volk und Jugend in den deutschen konstitutionellen Staaten« wandten und ihnen die Vorzüge der Verfassung in Form eines »Katechismus« erläuterten. Der Begriff war bewusst gewählt, um die Adressaten auf die gleichsam religiöse Bedeutung des Mitgeteilten aufmerksam zu machen. Die Verfassungsurkunde, hieß es darin, sei eine »väterliche Verfügung«, die die Fürsten »euch, ihren Kindern, gegeben haben«. Sie dokumentiere die Liebe des Fürsten zu seinem Volk, das er »dauerhaft glücklich machen« wolle. Ihrerseits würden sich die Untertanen mit »Liebe« zum Fürstenhaus erkenntlich zeigen und sich als »Stütze des Throns« bewähren. Mehr noch: Eine gute Verfassung nähre zugleich das Gefühl der »Vaterlands-Liebe«, indem sie dem Volk »eine gesetzmäßige Freyheit gewährt, die Rechte des Menschen und Bürgers heilig hält, und durchaus auf die Vorschriften der Gerechtigkeit gegründet ist«.[14]
Trotz des von solchen Lehr- und Lernbüchern propagierten Wahlspruchs »Für Gott, Fürsten, und Verfassung!« schafften es die Anhänger des konstitutionellen Systems nicht, einen offiziellen Verfassungstag einzurichten; ein Antrag in Bayern scheiterte 1819 am Widerstand der konservativen Kammer der Reichsräte. Gleichwohl blieb die Verfassung im öffentlichen Raum präsent. Das von Christian Daniel Rauch 1825 begonnene und zehn Jahre später enthüllte Max-Joseph-Denkmal in München etwa stellte in den Sockelreliefs die Verleihung der Verfassung und die Wohltaten dar, die das Volk daraus bezog.[15] Von Leo von Klenze stammte der Entwurf zu einer 32 Meter hohen Konstitutionssäule, die ein unterfränkischer liberaler Standesherr zwischen 1821 und 1828 in ländlicher Umgebung errichten ließ. Zu ihrer Einweihung kamen der »innige Verfassungsfreund« König Ludwig I. ebenso wie gleichgesinnte Reichsräte, Abgeordnete und annähernd 30.000 Bürgerinnen und Bürger. Auch in den folgenden Jahren fanden dort Verfassungsfeiern statt. 1832 versammelten sich fünf- bis sechstausend Menschen, es gab Reden und ein Mittagessen im dekorativen »Konstitutionssaal« des gräflichen Schlosses. Am Ende unterzeichneten zweitausend Männer, auf Vorschlag des liberalen Würzburger Bürgermeisters Wilhelm Joseph Behr, eine Adresse an den König. Sie forderte eine »im Wege des Vertrags zwischen Fürst und Volk« vereinbarte Änderung der Verfassung, auf dass Letztere »ihrem Zwecke wirklich entspreche, ihre Aufgabe wirklich befriedigend löse«.[16]
Die in dieser Forderung anklingende Kritik an der oktroyierten Konstitution und ihrer Anwendung wurde auch an anderen Orten laut. So ließen liberale Bürger im rheinpfälzischen Neustadt deutlich erkennen, dass ihnen ein gewöhnliches »Constitutionsfest« auf dem Hambacher Schloss, zu dem der anonym bleibende Geschäftsmann aufgerufen hatte, nicht mehr ausreichte. Der Aufruf sei »ohne Auftrag ergangen«, man möge ihn deshalb als »nicht geschehen« betrachten. Stattdessen luden die Liberalen Männer und Jünglinge, Frauen und Jungfrauen für den 27. Mai 1832 zu einem »großen Bürgerverein« zwecks »friedlicher Besprechung, inniger Erkennung, entschlossener Verbrüderung für die großen Interessen, denen ihr eure Liebe, denen ihr eure Kraft geweiht«. Dabei ging es ihnen nicht nur um Pfälzer und Bayern, sondern um das »ganze deutsche Volk«, das in Hambach seine »Wiedergeburt« feiern sollte.
Entschieden setzten sie sich damit von den herkömmlichen Konstitutionsfesten ab. Zwar konzedierte Wirth, die bisherige Verfassung, »so armselig und krüppelhaft« sie auch sei, habe immerhin »durch öffentliche Verhandlungen von Wahlkammern einen Impuls zur Weckung des öffentlichen Lebens« gegeben. Gleichwohl sei dieses Leben rasch wieder drangsaliert und eingeschränkt worden. Als Herausgeber einer liberalen Zeitung wusste er, wovon er sprach, stand er doch stets mit einem Bein, zuweilen auch mit beiden, im Gefängnis. Trotz dieser harschen Kritik waren sich die meisten Hambacher Redner in »ächt constitutionellem Geiste« darüber einig, dass Veränderungen nur durch »gesetzliche Reform« zu bewirken seien. Deutschland bedürfe einer »Grundreform« mit einer »freien Verfassung« und einer »kraftvollen Garantie«. Am Ende des Festes, auf dem viel geredet, viel gesungen, viel gegessen, viel getrunken und viele schwarz-rot-goldene Fahnen geschwenkt wurden, appellierte Wirth an die »gefeierten Männer des Volkes« in den einzelstaatlichen Parlamenten: Sie sollten untereinander beraten, »welche Reform dem Vaterlande die heilsamste sei«, um sie dann beherzt in Angriff zu nehmen.[17]