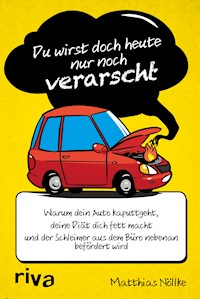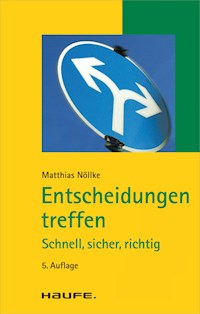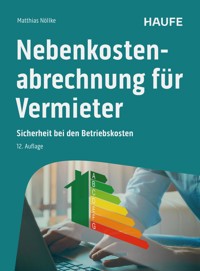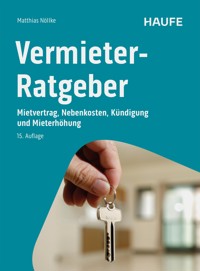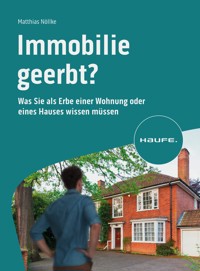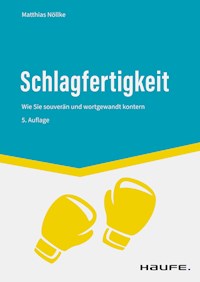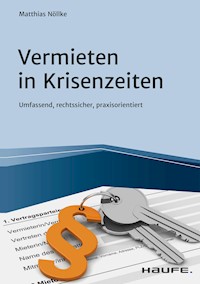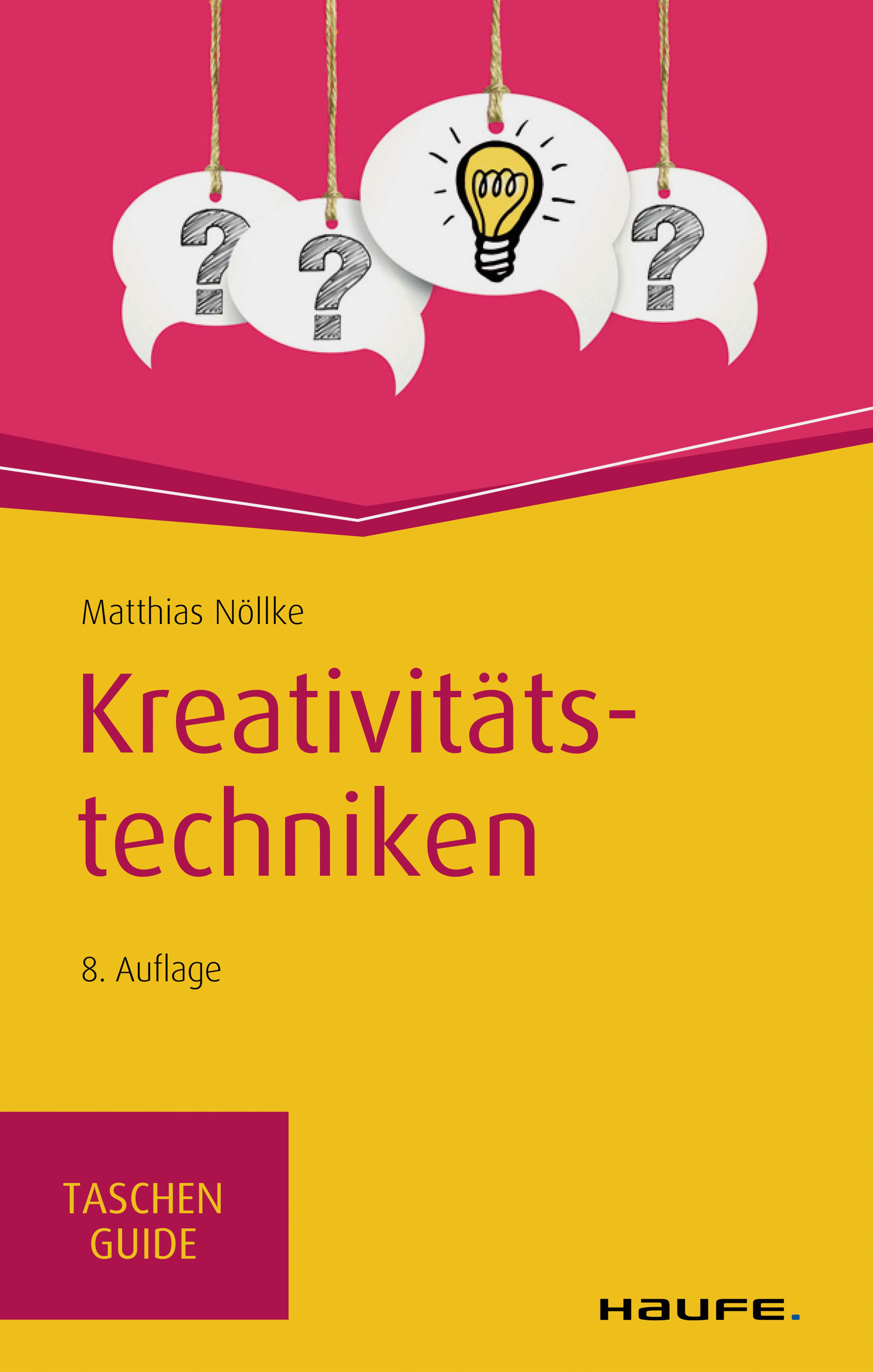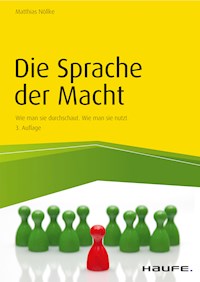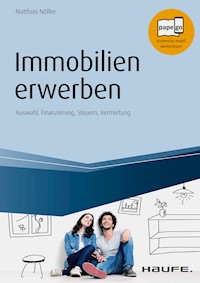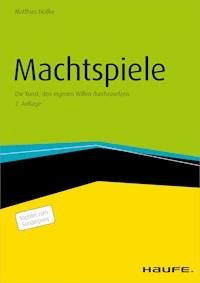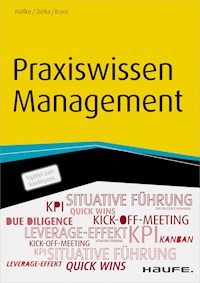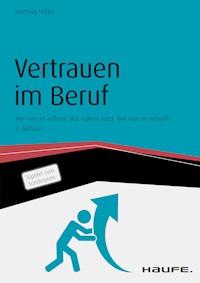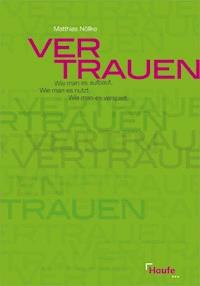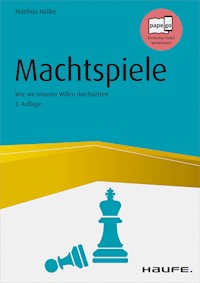
28,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Haufe Fachbuch
- Sprache: Deutsch
Wer die Macht hat, bestimmt, was passiert. In diesem Buch werden alle typischen Machtsituationen vorgestellt und ihr wahrer Sinn und Zweck entlarvt - vom alltäglichen Machtgeplänkel bis hin zur bösartigen Intrige. Es zeigt, welche Erscheinungsformen und Auswirkungen Macht hat und wie man sie für seine eigenen Zwecke einsetzt. Dieses Buch ist ein praktischer Leitfaden für den Umgang mit Macht im Verhältnis zu Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern. Und ein unverzichtbarer Begleiter für alle, die sich von der Macht nicht aufs Glatteis führen lassen wollen. Inhalte: - Wie Machtspiele ablaufen und Sie sie durchschauen - Wie Sie sich aus Krisensituationen befreien können - Was tun, wenn Mächtige Foul spielen? - Grundspiele, Mitarbeiterspiele, Boss-Spiele, Verhandlungsspiele u.v.m. - Jetzt mit noch mehr Machtspielen in der 3. Auflage
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum Urheberrecht
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Print: ISBN 978-3-648-09506-5 Bestell-Nr. 10088-0002ePub: ISBN 978-3-648-09507-2 Bestell-Nr. 10088-0101ePDF: ISBN 978-3-648-09512-6 Bestell-Nr. 10088-0151
Matthias Nöllke
Machtspiele
3. Auflage 2017© 2017 Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, [email protected]
Produktmanagement: Anne Rathgeber
Lektorat: Ulrich Leinz, Berlin
Satz: kühn & weyh Software GmbH, Satz und Medien, FreiburgUmschlag: RED GmbH, KraillingDruck: BELTZ Bad Langensalza GmbH, Bad Langensalza
Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten.
Vorwort
„Bei Schimpansen geschieht es nicht selten, dass ein verletzter Anführer doppelt so viel Energie in seine Drohgebärden steckt wie vorher und damit die Illusion erzeugt, in ausgezeichneter Verfassung zu sein.“
Frans de Waal: Der Affe in uns
Machtspiele sind alltäglich. Ob im Beruf, in der Partnerschaft, unter Freunden, bei der Kindererziehung, im Straßenverkehr oder auch in der Affenhorde, nahezu überall können wir die Erfahrung machen: Viele setzen ihren Willen nicht „einfach so” durch, weil sie die Stärkeren sind oder die amtliche Erlaubnis haben, sondern weil sie tricksen, weil sie drohen, weil sie bluffen, weil sie das eine sagen und das andere meinen. Weil sie so tun, als würden sie nachgeben, und in Wirklichkeit nehmen sie uns die Dinge aus der Hand. Weil sie es verstehen, uns zu beeindrucken. Weil sie unsere Gefühle für sich ausnutzen. Weil sie uns vor anderen anschwärzen. Weil sie uns vereinnahmen, weil sie uns einschüchtern und weil sie uns bei unserer Eitelkeit packen. Und wir? Wir halten es mit unseren Mitmenschen im Prinzip nicht viel anders. Denn auch wir wollen unseren Willen durchsetzen. Wir wollen nicht die Dummen sein, sondern die Schlauen. Und deshalb mischen wir mehr oder weniger geschickt mit – bei diesen Machtspielen.[2]
Genau darum soll es in diesem Buch gehen: Um die bunte Vielfalt alltäglicher Machtspiele. Sie erfahren, was es mit der „Kunst der Drohung” auf sich hat, wie Ihr Chef Sie „durch Lob verbrennen” kann, wie manche die Schuldgefühle ihrer Mitmenschen in eine sprudelnde Machtquelle verwandeln, warum das Prinzip „Eigenverantwortung” Sie in eine noch größere Abhängigkeit verstricken kann und vieles, vieles mehr. Dabei hat dieses Buch eine doppelte Zielrichtung: Zunächst einmal sollen Sie verstehen, wie solche Machtspiele ablaufen, wie die Spielregeln sind und wie Sie diese Spiele für sich nutzen können. Denn Machtspiele müssen keineswegs immer nur schlimm, unmoralisch und böse sein, sie können auch legitim, sportiv, ja geradezu charmant sein. Aber es gibt natürlich auch eine dunkle Seite, die keineswegs unterschlagen werden soll. Denn Machtspiele können Sie regelrecht zerstören, wenn Sie sich nicht zu helfen wissen. Und daher ist zweite Zielrichtung dieses Buchs aufzuzeigen, wie Sie auf die Machtspiele der anderen reagieren können: Sollen Sie, müssen Sie mitspielen, oder können Sie das Spiel durchkreuzen? Welche Möglichkeiten Ihnen offen stehen, hängt stark von Ihrer Position im Machtgefüge ab. Und diese Position können Sie wiederum verändern, nach oben oder unten – durch Machtspiele.[3]
Bevor wir uns aber mit diesen Spielen beschäftigen, müssen wir erst einmal klären, was wir unter Macht verstehen. Dieser Frage ist das erste Kapitel gewidmet. Darauf aufbauend wird uns beschäftigen, was Machtspiele auszeichnet und ob es auch einen Umgang mit Macht „ohne Spiel” geben kann. Die folgenden Kapitel stellen die verschiedenen Machtspiele vor: Von den „Grundspielen” bis zu den „Foulspielen”, von den „Boss-Spielen” bis zu den „Mitarbeiterspielen”, denn natürlich treiben auch die Mitarbeiter mit ihrem Vorgesetzten ihre Spiele.
Vor 17 Jahren habe ich mich erstmals mit dem Thema beschäftigt. Damals habe ich für den Bayerischen Rundfunk eine dreiteilige Hörfunkreihe über Machtspiele geschrieben. Seitdem hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Für dieses Buch habe ich mehr als vierzig Interviews und Hintergrundgespräche geführt mit Führungskräften, Wissenschaftlern und Mitarbeitern aus den verschiedensten Branchen und Hierarchieebenen. Ihre Berichte und Informationen waren das Rohmaterial, aus dem ich die hier versammelten Spiele extrahiert habe. Ich habe mich bemüht, eine möglichst große Spannbreite einzufangen, was natürlich nicht heißt, dass irgendeine Form von Vollständigkeit angestrebt war. Je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, umso vielfältiger ist es mir erschienen. In jedem neuen Interview habe ich Neues hinzugelernt. Daher bitte ich Sie: Wenn Sie mir Ihre eigenen Erfahrungen mit Machtspielen mitteilen möchten, schreiben Sie mir eine Mail an: [email protected][4].
Einige Leser haben das bereits getan. Denn die „Machtspiele” sind erstmals 2007 erschienen. Das Buch hat großen Anklang gefunden, es stand einige Wochen auf der Bestsellerliste der Financial Times Deutschland. Und es hat viele Leser bewegt, mir von ihren Erfahrungen mit verschiedenen Machtspielen zu berichten. Dafür möchte ich mich bedanken. Ebenso bei der Produktmanagerin Anne Rathgeber und dem Verlag, die es möglich gemacht haben, dass die „Machtspiele” in einer zweiten und nunmehr dritten Neuauflage erscheinen konnten. Dafür habe ich den Text komplett überarbeitet, aktualisiert und neue Spiele ergänzt wie „die Überrumpelung” oder das „Killerspiel: Ein hohes Tier anschießen”. Auch der Untertitel wurde auf meinen Wunsch geändert. Denn worum es auf den folgenden Seiten gehen soll, das sind die manchmal recht verschlungenen Wege – wie wir unseren Willen durchsetzen.[5]
Und damit wünsche ich viel Vergnügen beim Lesen.
Dr. Matthias Nöllke, München im März 2017
1 Was ist Macht?
„Wenn nötig, zögere nicht, deine eigene Mutter zu verkaufen, um die Macht zu ergreifen. Sobald du die Macht hast, wirst du merken, dass es mehrere Wege gibt, die Mutter wieder zurückzuholen.“
Sprichwort der Aschanti
Kaum etwas erscheint so erstrebenswert wie Macht. Wer Macht hat, bestimmt, was geschieht. Am Arbeitsplatz, in der Partnerschaft oder auf der Überholspur der Autobahn, sobald wir es mit anderen Menschen zu tun bekommen, ergeben sich Gelegenheiten, sie in unserem Sinne zu beeinflussen. Denn genau darum geht es bei der Macht: gegenüber anderen seinen eigenen Willen durchzusetzen. Und zwar, wie der Soziologe Max Weber in seiner viel zitierten Definition bemerkt, „auch gegen Widerstreben”. Das Wörtchen „auch” sollte nicht übersehen werden: Die anderen können „auch” unterwürfig Beifall klatschen, sich beleidigt zurückziehen oder die Sache widerstandslos hinnehmen, das spielt keine Rolle. Wer Macht über sie hat, setzt seinen Willen durch. Punktum.
Dabei handelt es sich um eine außerordentlich beglückende Erfahrung. Sie hebt unser Selbstwertgefühl, baut Stresshormone ab und stärkt uns für kommende Auseinandersetzungen. Jeder braucht die Erfahrung von Macht. Experimente mit vier Monate alten Säuglingen deuten darauf hin, dass wir schon sehr früh eine ausgeprägte Lust daran entwickeln, unsere Umwelt zu steuern. Den Babys wurden in einer etwas komplizierten Versuchsanordnung bunte Lichteffekte vorgeführt, die sie durch das dreimalige Drehen des Kopfes beeinflussen konnten. Die Forscher registrierten, dass ihre Studienobjekte in Strampelhosen rasch das Interesse verloren, wenn sie die Lichteffekte nicht steuern konnten. Was ihre Aufmerksamkeit fesselte, waren nicht die bunten Blitze, sondern die Tatsache, dass sie es waren, die die Kontrolle darüber ausübten.[6]
Menschen wollen etwas bewirken, vor allem auf andere Menschen wollen sie einwirken. Denn wir sind ausgesprochen soziale Wesen und verkümmern, wenn wir keinen Zugang zu den anderen finden. Für unsere seelische Gesundheit brauchen wir immer wieder die Gewissheit, dass wir es sind, die Einfluss auf sie nehmen und ein wenig in ihren Angelegenheiten mitmischen. Ob im Strampelanzug, im Blaumann oder im feinen Zwirn: Menschen genießen es, Macht über andere auszuüben. Auch wenn das Feld, auf dem sie sich durchsetzen, anderen völlig unbedeutend erscheint. Ja, manche üben ihre Macht so sehr im Verborgenen aus, dass es andere kaum bemerken. Und doch wäre es ein Fehler, diese unscheinbare Macht zu übersehen. Denn Menschen werden im Allgemeinen sehr ungemütlich, wenn man versucht, ihnen einen Teil ihrer Macht wieder zu entziehen.
Macht bereitet nicht nur Genuss, sie verschafft auch Anerkennung und Prestige. Der amerikanische Kultursoziologe Richard Sennett hat das einmal so ausgedrückt: Nicht derjenige, den wir besonders achten und dessen Qualitäten wir schätzen, gelangt auf eine Machtposition, sondern es ist oft andersherum – wer auf einer mächtigen Position sitzt, dem bringen wir Achtung und Respekt entgegen. Da wir uns ohnehin nach ihm richten müssen, nehmen wir sicherheitshalber an, dass er zu Recht da oben sitzt. Es wäre zu beschämend sich vorzustellen, dass wir einem Menschen mit zweifelhaften Fähigkeiten und Charakterzügen folgen. Also bekommt unser Chef einen Vorschuss an Anerkennung, den er mehren oder aufbrauchen kann. Das Gleiche gilt im Übrigen für Menschen, die Macht über andere haben. Auch die halten wir erst einmal für respektabel, ehe wir Anlass haben, das Gegenteil anzunehmen. Denn wie wären sie sonst auf ihre einflussreiche Position gekommen, wenn nicht durch ihre außerordentlichen Qualitäten?[7]
Die Unanständigkeit der Macht
Doch das ist nur die eine Seite. Macht gilt nicht nur als attraktiv, sondern auch als anrüchig. Nicht zufällig scheuen sich viele Führungskräfte, die doch nichts dringender benötigen als Macht, diesen Begriff in den Mund zu nehmen. Stattdessen sprechen sie lieber von
Einfluss (was fließt, ist weicher und geschmeidiger),
Autorität (etwas, das auf ganz natürliche Art und Weise wächst, und vor der sich die anderen freiwillig in den Staub werfen),
Verantwortung (die auf ihnen lastet, die sie aber gerne annehmen, weil sie gestalten wollen – drei Ungereimtheiten in einem Satz, wie Sie noch sehen werden),
oder kraftvoll-energiegeladen von Power und Leadership.
Wenn man schon von Macht sprechen muss, dann wenigstens nicht auf Deutsch. „Keine Macht für niemand” klingt nach Befreiung, „No power” klingt nach toter Hose, denn „Power” steht bekanntlich auch für Kraft und Energie. Und ein „Leader” ist nun geradezu das Gegenteil von einem kalten und berechnenden Machtmenschen. Er ist ein Vorbild, charakterlich integer und menschlich beeindruckend. Er wendet keine Macht an, sondern er „begeistert” und „inspiriert” die anderen, etwa im Sinne des Bismarckschen Bonmots, unter seiner Führung könne jeder tun, was er (nämlich Bismarck) wolle. Und das bitte noch im Glücksrausch.[8]
Das Streben nach Macht und die Anwendung von Macht hat hingegen immer etwas Unanständiges und Anmaßendes. Wer erkennen lässt, dass es ihm um die Macht geht, der erregt Argwohn und Abneigung. Wir halten ihn für egoistisch, brutal, gewissenlos, mit einem Wort: für machthungrig. Solchen Menschen trauen wir nicht über den Weg und wir versuchen, uns ihrem Einfluss zu entziehen. Wenn wir ihnen folgen, dann weil wir sie für stark halten und uns von ihrer Rücksichtslosigkeit Vorteile erhoffen oder weil wir im Machtkampf bereits kapituliert haben. Aber auf Sympathie und Vertrauen kann so ein Machtmensch nicht bauen. Vielmehr muss er mit Widerstand rechnen, mit Misstrauen, mit geheimen Gegenbündnissen. Und mit unverhohlener Schadenfreude, wenn er scheitert.
Wie passt das zusammen? Wie kommt es zu dieser gespaltenen Einschätzung? Was wir an der Macht bewundern, das ist ihre Stärke. Und was wir anerkennen, das ist die Macht, die sich bereits durchgesetzt hat und mit der wir uns arrangieren können (oder auch müssen), die arrivierte Macht. Was wir nicht in Frage stellen, das ist die Macht, die unseren Interessen dient und Ziele verfolgt, die wir teilen. Einen mächtigen Verbündeten wollen wir eher stärken als schwächen, auch wenn er in der Wahl seiner Mittel nicht zimperlich ist. Und unsere eigene Macht empfinden wir schon gar nicht als Bedrohung. Vielmehr schützt sie uns und gibt uns die Möglichkeit, etwas nach unseren Vorstellungen zu gestalten. Eigentlich hätten wir gern mehr davon und nicht weniger. Was uns so bedenklich, ja gefährlich erscheint, das ist die Macht, die sich gegen uns und unsere Interessen kehren könnte. Und genau das ist zu befürchten, wenn ein anderer nach Macht strebt. Oder schlimmer noch: Wenn ein anderer seine Macht uns gegenüber ausspielt.[9]
Freiheit und Abhängigkeit
Der Zuwachs an Macht auf der einen Seite bedeutet Einschränkung von Freiheit auf der anderen Seite. Im Klartext: Wer die Macht hat, hindert die anderen daran, das zu tun, was sie wollen. Sie müssen sich seinem Willen fügen. Das kann manchmal sehr quälend sein, etwa wenn von jemandem verlangt wird, gegen seine Überzeugung zu handeln, in aller Öffentlichkeit Unsinn zu reden oder Projekte zu verfolgen, die zum Scheitern verurteilt sind, die sein Chef aber für eine „interessante Idee” hält.
Andererseits ergeben sich durch ein Abhängigkeitsverhältnis neue Freiheiten. Wir können Dinge tun, für die wir nicht voll verantwortlich zu machen sind. „Obwohl beide Seiten handeln, wird das, was geschieht, dem Machthaber allein zugerechnet”, spitzt der Systemtheoretiker Niklas Luhmann diesen Sachverhalt zu. Das heißt nicht, dass der Vorgesetzte die Fehler seines Mitarbeiters ausbaden muss (obwohl das auch vorkommt, aber dann kann sich der Mitarbeiter keineswegs entspannt zurücklehnen, denn er trägt immer auch einen Teil der Verantwortung). Vielmehr verschafft ihm sein Abhängigkeitsverhältnis ungeahnte Möglichkeiten gegenüber Dritten (→ Verhandlungsspiele, Mein gnadenloser Boss, Kapitel 6.1[10] und Low Ball, Kapitel 6.8). Er kann sich immer darauf berufen, er selbst würde es ja gerne anders machen, aber der Chef, „dieser harte Hund”, würde ihn damit nicht durchkommen lassen.
Selbstachtung und Selbstbehauptung
Jede Ausübung von Macht stellt denjenigen, der sich dem Willen des anderen beugen soll, vor ein gewisses Problem: Wie behalte ich meine Selbstachtung, wenn ich nicht selbst darüber bestimme, was ich tue, sondern mich einem fremden Willen unterwerfe? Ich kann mich von der ganzen Sache distanzieren und sie nicht als meine Angelegenheit betrachten. Was der andere will, dafür bin nicht ich verantwortlich, auch wenn ich es in die Tat umsetze. Das ist eine weit verbreitete (und häufig auch die einzig angemessene) Haltung, vor allem in verfestigten und hierarchisierten Machtbeziehungen – und wenn es nicht gerade darum geht, ein Verbrechen zu begehen: Die Anweisungen meines Chefs kann ich befolgen, sogar wenn ich persönlich sie für Blödsinn halte. Sie sind nicht „mein Bier”. Um mich über meine eigene Machtlosigkeit hinwegzutrösten, kann ich mit Gleichgesinnten über den unfähigen Chef herziehen. Das verschafft mir dieses kleine Überlegenheitsgefühl, das ich brauche, um weiterhin zu tun, was er sagt.[11]
Allerdings lässt sich diese Einstellung auf Dauer kaum durchhalten. Ich kann mich nicht ständig zum willenlosen Werkzeug machen lassen, ohne an Selbstachtung zu verlieren. Wenn ich sie behalten möchte, muss ich immer wieder mal meinen Willen ins Spiel bringen – auf eine von vier möglichen Arten:
Freiwillig akzeptieren: Ich erkläre mich mit dem, was ich tun soll, ausdrücklich einverstanden. Ich mache gewissermaßen den fremden Willen zu meinem eigenen.
Fassaden aufbauen: Ich gelobe Folgsamkeit, weiche jedoch mehr oder minder von den Vorgaben ab, in der Annahme, dass der andere das nicht bemerkt. Oder dass er es bemerkt, aber nichts dagegen unternimmt. Dabei habe ich das beruhigende Gefühl, dass ich derjenige bin, der in dieser Angelegenheit eigentlich die Macht hat.
Rache üben: Ich füge mich zwar der Macht, weil die im Moment in einer besseren Position ist. Ich nehme mir aber vor, es dem anderen bei nächster Gelegenheit heimzuzahlen.
Widerstand leisten: Ich weigere mich, das zu tun, was ich tun soll. Ich tue gar nichts oder etwas ganz anderes.
Mit der letztgenannten Reaktion wird der Machtanspruch zurückgewiesen. Entweder steckt jetzt der andere zurück oder es kommt zum Machtkampf, der für eine Seite mit einer großen Demütigung enden wird. Der Punkt, um den es uns hier geht: Wird der Machtanspruch über einen bestimmten Grad hinaus ausgedehnt, weckt er fast zwangsläufig den Wunsch, ihm etwas entgegenzusetzen. Mit zunehmender Macht auf der einen Seite wächst die Bereitschaft zum Widerstand auf der anderen. Auf diese Weise pendeln sich die Machtverhältnisse nach und nach auf ein bestimmtes Verteilungsverhältnis ein. Zwar ist die Macht ungleich verteilt, aber immerhin ist sie verteilt, bemerkt der Soziologe Rainer Paris.[12]
Allerdings kann die Entwicklung auch in eine ganz andere Richtung ausschlagen: Macht weckt den Wunsch nach noch mehr Macht. Allein, um die vorhandene Macht abzusichern, die durch den drohenden Widerstand gefährdet scheint. Durch höhere Machtansprüche nimmt aber gerade die Bereitschaft zu, Widerstand zu leisten. Das verschärft wiederum die Anstrengungen des Mächtigen, die Kontrolle in der Hand zu behalten. Dadurch wird aber die Gegenseite erst recht dazu angehalten, sich nach Auswegen umzusehen, was schließlich den Mächtigen dazu veranlasst, die Auswege zu versperren. Die Macht schlägt um in Zwang.
Ein Verhältnis auf Gegenseitigkeit
In aller Regel sind Machtverhältnisse keine einseitige Angelegenheit. Auch wenn Sie sich dem Willen eines anderen beugen müssen, sind Sie keineswegs machtlos, allein schon dadurch, dass der Mächtige Sie braucht. Er will ja etwas von Ihnen. Ohne Sie hätte er keine Macht. Er müsste sich jemand anderen suchen, der nach seinem Willen handelt. Und es kommt noch etwas hinzu: Seine Macht ist nur dann etwas wert, wenn Sie über nennenswerte Fähigkeiten verfügen (→ Den Sklaven vorführen, Kapitel 4.1[13]). Sie nimmt noch zu in dem Maße, in dem Sie Fähigkeiten erwerben, die nicht so leicht ersetzbar sind. Macht über jemanden, der unfähig ist, mag zwar eine gewisse Genugtuung erzeugen, doch bleibt sie wirkungslos. Wenn sie nicht sogar Schaden anrichtet, weil die Unfähigen eben nicht in der Lage sind, den Willen des Mächtigen umzusetzen.
Nehmen wir an, Sie stellen sich ganz auf den anderen ein, eignen sich die Fertigkeiten an, die er braucht, und sind immer besser in der Lage, seine Vorstellungen in die Tat umzusetzen. Oberflächlich betrachtet hat der andere mehr und mehr Macht über Sie bekommen. Und seine Macht ist auch mehr wert, weil er mit Ihren besseren Fähigkeiten auch immer mehr von Ihnen fordern kann. Nun gibt es aber einen Punkt, an dem das Machtverhältnis umschlagen kann. Denn der andere kann immer weniger auf Sie verzichten. Seine Machtbasis würde zerbröckeln, wenn Sie ihm nicht mehr zu Verfügung stünden. Mit einem Mal sind Sie derjenige, der Forderungen stellen kann. Und genau das müssen Sie auch tun, um Macht zu gewinnen. Sonst bleiben Sie ein schlafender Riese, der sich einfach an die Leine legen lässt. Sie selbst müssen Ihre Interessen ins Spiel bringen und Druck aufbauen. Dabei stärkt es Ihre Position, wenn Sie Ihre Fähigkeiten auch einem anderen, womöglich einem Konkurrenten, zur Verfügung stellen könnten.[14]
Allerdings ist es ratsam, seine Macht eher behutsam ins Spiel zu bringen. Sonst fühlt sich der andere, der sich ja immer noch für den Tonangebenden hält, vor den Kopf gestoßen. Aus verletzter Eitelkeit könnte er Sie fallen lassen – auch wenn er sich damit letztlich selbst schadet. Meist liegt es auch in Ihrem Interesse, wenn dieser Fall nicht eintritt. Immerhin haben Sie sich auf den anderen eingestellt, sich ihm und seinen besonderen Forderungen angepasst. Sie sind sozusagen ein „eingespieltes Team”. Und genau das sollten beide Seiten anerkennen: Erfolgreiche und stabile Machtverhältnisse sind immer ein Verhältnis auf Gegenseitigkeit.
Das Streben nach Dominanz
Manchen Menschen scheint die Macht fast von alleine zuzufallen. Sie kommen in eine Gruppe und alle hören auf ihr Kommando. Sie müssen niemandem drohen, benötigen keine herausgehobene Position und auch kein Expertenwissen. Sie beanspruchen einfach die Macht für sich. Sie sagen ihren Mitmenschen, was sie zu tun haben – und wie durch Wunderhand bewegt folgen diese tatsächlich ihren Anweisungen.
Wie ist das möglich? Es liegt weniger am persönlichen Charisma als an einem Charakterzug, den man als Dominanzstreben bezeichnet. Ein wenig haben wir alle davon, doch Menschen mit einem ausgeprägten Dominanzstreben sind die, die immer und überall bestimmen wollen und denen es nichts ausmacht, wenn sie damit anecken. Früher oder später setzen sie sich durch – zumindest in Angelegenheiten, die ihrem Gegenüber nicht so wichtig sind – und solange sie nicht auf jemanden treffen, der ein ähnlich entwickeltes Dominanzstreben hat. Denn dann geraten die beiden unweigerlich aneinander und Unbeteiligte wundern sich, wie man über solch eine Lappalie überhaupt streiten kann.[15]
Wenn sich zwei Menschen begegnen, dann entscheidet sich in recht kurzer Zeit, wer wen dominiert, häufig ohne dass die beiden das bewusst bemerken. Aber es zeigt sich an ganz subtilen Signalen: Der eine bestimmt, der andere gibt nach. Andernfalls verläuft das Zusammentreffen wenig harmonisch. Dieser Effekt lässt sich sogar an unserer Stimme messen. Wenn man alle Frequenzen über 500 Hertz herausfiltert, so bleibt von ihrem Klang nur ein tiefes Summen übrig. Bei jeder Person klingt das anders, aber im Laufe eines Gesprächs schwingen sich beide Partner auf einen Ton ein. Es ist nicht überraschend, dass der Dominantere buchstäblich den Ton vorgibt, dem sich der andere anpasst.
Nun gibt es ohne Zweifel einen engen Zusammenhang zwischen Macht und dominantem Charakter. Dominante Menschen wollen bestimmen, sie sind auf Macht geradezu fixiert. Das treibt sie an. Und es ist nicht überraschend, dass auf hohe Führungspositionen vor allem Menschen mit ausgeprägtem Dominanzstreben gelangen. Dennoch sollten wir Macht und Dominanz auseinander halten. Und zwar aus drei Gründen:
Es gibt Konstellationen und Formen der Macht, bei denen sind die nicht-dominanten Charaktere im Vorteil (einige dieser Fälle werden Sie in diesem Buch als Machtspiel noch kennen lernen).[16]
Wer dominant auftritt, zieht die Aufmerksamkeit und auch die Abneigung seiner Konkurrenten auf sich. Nicht wenige dominante Charaktere landen daher nicht auf dem Chefsessel, sondern im Abseits.
Überbordende Dominanz unterhöhlt die eigene Machtposition, nicht nur weil sie Neider auf den Plan ruft, sondern weil es auf Dauer ruinös ist, sich überall durchsetzen zu müssen.
Zum letzten Punkt gibt es eine interessante Entsprechung bei unseren haarigen Verwandten, den Affen. Wie der Neurologe Robert Sapolsky beobachtet hat, richten sich überdominante Alphamännchen selbst zugrunde, weil sie nicht zwischen einer ernsthaften und einer harmlosen Herausforderung unterscheiden können. Sicherheitshalber bekommt jeder eins aufs Dach. Diese etwas paranoiden Superaffen räumen zwar schnell alle Konkurrenten aus dem Weg und gelangen schneller auf die Alphaposition als bedächtigere Charaktere. Doch dort können sie sich selten lange halten. Der Stress ruiniert ihre Gesundheit. Sie bekommen Magengeschwüre und Herzanfälle. Da sie sich auf dem Höhepunkt ihrer Macht meist sehr despotisch aufgeführt haben, sind die Sympathien in der Horde sehr gering. Der angeschlagene Tyrann wird gerne gestürzt.
Wie entsteht Macht?
Wenn Sie Macht über mich haben, dann folge ich nicht meinem, sondern Ihrem Willen. Doch warum sollte ich das überhaupt tun? Dafür gibt es zwei vernünftige Gründe: Entweder muss ich mit unangenehmen Folgen rechnen, wenn ich mich über Ihren Willen hinwegsetze. Sie beschweren sich über mich, weigern sich, mich zu bezahlen, möchten nicht mehr mit mir zusammenarbeiten oder Sie bekommen schlechte Laune und verderben mir den Abend. Ob diese möglichen Folgen wirklich eintreten würden oder nicht, spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass ich damit rechne und dass ich lieber Ihrem Willen folge, anstatt mir den befürchteten Ärger einzuhandeln. Zweiter Grund: Sie sind besser informiert als ich, Sie haben den Überblick, wissen mehr und können besser abschätzen, welche Folgen mein Verhalten nach sich zieht. Davon muss ich überzeugt sein und ich muss unterstellen, dass Sie mir keinen Schaden zufügen wollen. Ich vertraue Ihnen. Dann sollte es Ihnen ebenfalls gelingen, meinen Willen auf Ihr Gleis umzuleiten.[17]
Ihre Macht speist sich also aus zwei Quellen: Sie verfügen über Ressourcen, mit denen Sie mir Unannehmlichkeiten bereiten können, und/oder Sie verfügen über Wissen, das ich nicht habe. Zu den Unannehmlichkeiten gehört auch, dass Sie mir Belohnungen vorenthalten können. In diesem Sinne ist die Belohnungsmacht die freundliche Schwester der Bestrafungsmacht. Und was das Wissen betrifft, so geht es nicht so sehr darum, dass Sie sich am besten auskennen, sondern dass ich annehme, dass mir Ihr Wissen letztlich zugute kommt. Ich folge Ihrem Willen also nur, wenn er auf etwas abzielt, das ich im Grunde auch will. Mein Wille geht sozusagen einen Umweg über Ihren Willen.
Neben diesen zwei vernünftigen Gründen gibt es aber noch zwei weitere, die nicht ganz so glashart dem rationalen Abwägen von Vor- und Nachteilen entspringen:[18]
Ich folge Ihrem Willen, weil ich in der betreffenden Angelegenheit gar keinen eigenen Willen habe.
Ich folge Ihrem Willen, weil sich das zwischen uns so eingespielt hat.
Manche Menschen setzen sich einfach deshalb durch, weil sie etwas wollen und die anderen bei dieser Sache keine klare Vorstellung haben und keine eigenen Interessen verfolgen – vielleicht weil sie darüber noch gar nicht nachgedacht haben, weil sie sich mit anderen Dingen beschäftigen (müssen) oder weil es sich gar nicht um ihre Angelegenheit handelt. Auf solchen „unbestellten Feldern der Macht” müssen Sie mit dem geringsten Widerstand rechnen. Oft bekommen Sie Ihren Willen einfach so, aus reiner Gefälligkeit oder weil Ihre Mitmenschen erleichtert sind, wenn jemand in einer so lästigen Sache die Initiative ergreift. Es liegt auf der Hand, dass Sie nur bescheidene Ansprüche stellen können, denn sonst wären ja wieder die Interessen der anderen berührt. Aber immerhin, ein Anfang ist gemacht.
In Hinblick auf solche bescheidenen Anfänge sollten Sie auch deshalb aufmerksam sein, weil Machtbeziehungen die Tendenz haben, sich zu verfestigen. Wir haben es schon beim Abschnitt über Dominanz angesprochen: Wer seinen Willen bekommt, das hängt zu einem nicht unerheblichen Teil davon ab, wer zuvor seinen Willen durchgesetzt hat. Und zwar nicht im Sinne einer ausgleichenden Gerechtigkeit (heute bekommen Sie Ihren Willen, morgen ich meinen), sondern das Ungleichgewicht nimmt eher noch zu![19]
Natürlich gibt es auch den Fall, dass sich mal der eine, mal der andere durchsetzt. Oder dass der eine auf diesem Gebiet, der andere auf jenem den Ton angibt. Der entscheidende Punkt ist: Solche Muster bilden sich relativ schnell heraus und sie lassen sich später nur noch mühsam wieder ändern, wie Ihnen jeder Paartherapeut bestätigen wird. Zwar können sich Machtverhältnisse verschieben, sogar umkehren, aber eben auf der Grundlage dieser Muster. Es gibt auch den Fall, dass der gehorsame Part irgendwann rebelliert, weil die andere Seite den Bogen überspannt hat. Das geschieht sogar recht häufig – zur Verblüffung des dominanteren Parts, der gar nicht versteht, was los ist und warum der andere „nicht schon viel früher” etwas gesagt hat. All das gehört zur inneren Dynamik von Machtverhältnissen dazu. Dass es bei solchen Konstellationen erst zum Knall kommen muss, ehe sich etwas verändert, ist ja gerade ein Indiz für die Wirksamkeit solcher Muster, die sich fast zwangsläufig einschleifen. Wenn wir diese Dynamik durchschauen, wird uns auch klarer, warum jemand nach dem Willen eines anderen handelt, obwohl es dafür eigentlich gar keinen Grund zu geben scheint.
Die Klaviatur der Gefühle
Beim Thema Macht können wir die Rolle der Gefühle nicht übergehen. Dabei sind nicht nur die Machtgefühle mit im Spiel, sondern Gefühle aller Schattierungen: Stolz, Angst, Ärger, Freude, Zuneigung, Trauer und – bei unserem Thema doppelt und dreifach zu unterstreichen – Schuld und Scham. Nach Ansicht vieler Psychologen werden wir vor allem von unseren Gefühlen gesteuert, wir können kaum anders, als ihnen zu gehorchen. Wer Macht über andere gewinnen möchte, hat daher einen enormen Vorteil, wenn er es versteht, auf der Klaviatur ihrer Gefühle zu spielen.[20]
Um bei dem eben entwickelten Modell zu bleiben: Die Fähigkeit, meine Gefühle zu beeinflussen, gehört ohne Zweifel zur ersten Machtquelle, von denen eben die Rede war: Ressourcen, mit denen Sie mir Unannehmlichkeiten bereiten können, wenn ich nicht das tue, was Sie wollen. Ich werde traurig oder wütend, bekomme Angst, schäme mich oder fühle mich schuldig. Die positive Kehrseite davon lautet: Wenn ich Ihren Wünschen nachkomme, fühle ich mich gut. Ich empfinde Stolz, Erleichterung oder Freude.
Allerdings ist der menschliche Gefühlshaushalt kompliziert genug, dass es so einfach nun auch wieder nicht ist, hier steuernd einzugreifen. Es gibt widerstreitende Gefühle, gemischte Gefühle, Stimmungsschwankungen und immer wieder überraschende emotionale Reaktionen. Zudem ticken die Menschen sehr unterschiedlich. Was dem einen Angst einjagt, hält der andere für eine reizvolle Herausforderung. Während der eine von heftigen Schuldgefühlen geplagt wird, wenn er jemanden gekränkt hat, wird der andere in solchen Fällen von wohligen Glücksgefühlen durchflutet. Einigkeit besteht aber ganz gewiss in einem Punkt: Wenn wir entdecken, dass jemand unsere Gefühle manipulieren will, reagieren wir äußerst verstimmt. Das Gleiche gilt für den Fall, dass wir merken, wie jemand seine eigenen Gefühle nur taktisch einsetzt, sie also nur simuliert. So jemand ist nicht authentisch – und er ist nicht vertrauenswürdig.[21]
Nun spielen wir aber alle ein wenig mit den Gefühlen der anderen und auch mit unseren eigenen, wenn wir Einfluss nehmen wollen. Wir verbergen Emotionen, wir übertreiben sie oder täuschen sie auch mal vor. In bescheidenem Rahmen wird das durchaus toleriert, ja erwartet und mit ins Kalkül gezogen. Dass wir alle nicht immer authentisch und ehrlich sind, ist die erste Voraussetzung dafür, dass wir miteinander auskommen. Es wirkt als soziales Schmiermittel. Problematisch wird es da, wo große Gefühle ins Spiel kommen, wo die emotionale Betriebstemperatur steigt und die Distanz zwischen uns dahin schmilzt. Wer da noch an den Gefühlen herumschraubt, Zuneigung, Scham, Wut und Hass für seine Zwecke einspannt, geht ein hohes Risiko ein. Auf der anderen Seite beginnt es erst hier für manche Machtmenschen interessant zu werden. Denn wer diese Gefühle zu lenken versteht (seine eigenen und die der anderen), dem eröffnen sich ungeahnte Möglichkeiten, seine Mitmenschen wie Spielfiguren hin und her zu schieben, unter der Voraussetzung natürlich, dass die seine Manöver nicht durchschauen. Er kann sie gegen andere aufhetzen, ihnen Schuldgefühle einpflanzen oder sie dadurch unter Druck setzen, dass er von ihnen „zutiefst enttäuscht” ist, weil sie nicht getan haben, was er wollte (→ Das Enttäuschungsspiel, Kapitel 9.5[22]).
Glücklicherweise scheinen viele bei diesem doppelbödigen Spiel ihre Fähigkeiten zu überschätzen und führen sich am Ende mit ihren Allmachtsfantasien selbst an der Nase herum. Denn schließlich sollte eines nicht unter den Tisch fallen: Auch derjenige, der Macht über andere gewinnen will, wird von Gefühlen getrieben – nicht nur von Machtgefühlen. Auch er hat Ängste, Sehnsüchte, ist anfällig für Scham- und Schuldgefühle. Ja, das, was er will – seine Interessen –, die er anderen gegenüber durchsetzen möchte, werden ganz erheblich durch seine Gefühle beeinflusst, an denen wiederum andere drehen könnten. Sind keine Gefühle im Spiel, dann besteht allerhöchste Alarmstufe. Es gibt kaum etwas Schlimmeres, als einem Menschen in die Hände zu fallen, der seine eigenen Gefühle nur taktisch einsetzt und innerlich eiskalt ist (mehr dazu → Foulspiele, Kapitel 10).
Die Flüchtigkeit von Macht
Im beruflichen Zusammenhang gilt Macht häufig als eine Eigenschaft, die ein Mensch bekommen kann wie einen Dienstwagen. Mächtig ist beispielsweise jemand, der eine bestimmte Führungsposition innehat. Und mächtig bleibt er, bis er diese Position wieder aufgibt. Doch diese Vorstellung führt ein wenig in die Irre. Denn ob im Beruf, in der Partnerschaft oder in der Politik, Macht „hat” man nicht einfach so. Macht ist etwas, das sich schwer greifen lässt, das sich auf manchmal unvorhersehbare Weise verteilt und das an keinem anderen Ort existiert als in den Köpfen der Menschen.
Macht ist an menschliche Beziehungen geknüpft. Sie richtet sich immer auf andere Menschen und ihr Verhalten, das beeinflusst oder sogar gesteuert werden soll. Benehmen sich die anderen, wie sie sich auch ohne mich benehmen würden, dann kann ich ihr Vorgesetzter sein, der Geschäftsinhaber oder eine goldene Krone tragen, Macht habe ich in dieser konkreten Angelegenheit nicht über sie. Das muss für die Machtbeziehung kein Nachteil sein. Im Gegenteil, Macht ist vor allem dann von Dauer, wenn sie sich nicht dauernd einmischt. Kritisch wird es erst, wenn ich versuche, Einfluss zu nehmen, und mich nicht durchsetzen kann. Dann habe ich einen Machtverlust erlitten. Aber auch der muss keineswegs ernsthafte Folgen haben, sondern kann sich als bloße Episode erweisen. Wenn ich Sie bei nächster Gelegenheit wieder hinter mich bringe, kann ich sogar gestärkt aus solch einer Auseinandersetzung hervorgehen. Aber genau das muss mir erst einmal gelingen. Schaffe ich es nicht, dann habe ich durch ein einziges Ereignis dieser Art dramatisch an Einfluss verloren.[23]
Gefährlich wird es ebenfalls, wenn ich es mir auf meinem Vorgesetztensessel bequem mache, die Dinge laufen lasse und mich gar nicht mehr einmische, sondern mich vermeintlich höheren Aufgaben widme, von denen meine „Untergebenen” nicht viel mitbekommen. Dann werde ich eines Tages feststellen, dass sich hinter meinem Rücken neue Machtstrukturen herausgebildet haben, die ich kaum noch beeinflussen kann. Wenn die Dinge gut laufen, wird man mir die Erfolge von außen zwar immer noch anrechnen und mich für eine gute Führungskraft halten, aber meine Macht habe ich eingebüßt. Und diejenigen, die sie an sich gezogen haben, werden sich bitter darüber beklagen, dass ihre Verdienste nicht genügend anerkannt werden.[24]
Macht ist so gesehen immer gefährdet und muss sich immer wieder neu beweisen. Nicht zuletzt diesem Zweck dienen die Machtdemonstrationen, die nicht gerade in hohem Ansehen stehen, weil sie ja nichts ernsthaft bewirken wollen, sondern nur zeigen sollen, wer den Ton angibt. Und doch haben sie ihren Sinn – gerade wenn alles bestens läuft und es keine zwingende Notwendigkeit gibt einzugreifen. Dann bekommen häufig die Leute aus der zweiten Reihe Oberwasser und neigen dazu, ihre Selbstständigkeit weiter auszubauen. Höchste Zeit für eine machtbewusste Führungskraft, auf den Tisch zu hauen, um sich zurückzumelden. Allen Lästereien über solche eitlen Kraftmeiereien zum Trotz gehören Machtdemonstrationen zu den wichtigsten Machtspielen (→ Boss-Spiele, Kapitel 4).
Macht und Verantwortung
Sie sind untrennbar miteinander verbunden, heißt es: Macht und Verantwortung. Wer Macht hat, der soll auch die Verantwortung dafür übernehmen, was geschieht. Ja, dass er das tut, ist geradezu die Voraussetzung, die Geschäftsgrundlage dafür, dass andere seinem Willen folgen. Sie tun, was er will, dafür entlastet er sie davon, für die Folgen geradezustehen. „Ich übernehme die Verantwortung”, erklärt der Mächtige und bekommt dafür seinen Willen. Den Mitmenschen bleibt nur eine nachgeordnete, moralische Verantwortung für das, was sie persönlich anrichten. Diese grundlegende Verantwortung können sie als zurechnungsfähige menschliche Wesen auch gar nicht ablegen. Ansonsten bleibt es dabei: Der Mächtige gilt als „der Verantwortliche”. Und je mehr Macht er hat, desto mehr Verantwortung muss er schultern.[25]
Es gibt nur einen Haken: Macht und Verantwortung vertragen sich weit weniger gut, als immer wieder behauptet wird. Schon gar nicht ergänzen sie sich – etwa in dem Sinne, dass derjenige, dem mehr Verantwortung übertragen wird, dadurch auch mehr Macht bekommt. Das wird zwar gern so gesagt, aber diesem Schönwetterreden sollten Sie nicht auf den Leim gehen. Es geht entweder um Macht oder um Verantwortung. Entweder erhalten Sie tatsächlich mehr Macht, und das wird einer bewährten Konvention gemäß offiziell als „Zuwachs an Verantwortung” verkauft. Oder Sie müssen tatsächlich mehr Verantwortung übernehmen und büßen dadurch an Macht ein. Das kann Ihnen übrigens durchaus auch blühen, wenn Sie beruflich aufsteigen: Immer mehr Verantwortung und immer weniger Macht.
Darauf sind schon viele hereingefallen. Denn beim Thema Verantwortung befinden wir uns bereits tief in dem Terrain der Machtspiele. Verantwortung klebt zwar fast immer außen an der Macht: Zumindest wenn Sie formal die Macht innehaben, also Vorgesetzter sind, können Sie gar nicht anders, als sich „zu Ihrer Verantwortung zu bekennen”. Aber die Grenze ist schnell erreicht. Denn wenn es wirklich um etwas geht, muss die Verantwortung ausgedünnt, zurückgefahren, auf andere geschoben werden. Sonst kann sie die Macht regelrecht erdrücken. Wer Macht sucht, muss Verantwortung loswerden können. Das klingt etwas beunruhigend, ist aber gar nicht zu vermeiden.[26]
Verantwortung verträgt sich nur dann mit Macht, solange alles nach Plan läuft, Sie erfolgreich sind und Ihr Ziel erreichen. In diesem Fall wird sich niemand dagegen sträuben, Verantwortung zu übernehmen, und sich im Übrigen bei all denen bedanken, die „maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen haben”. Problematisch wird es jedoch, wenn das Ziel verfehlt wird oder höchst unerwünschte Folgen eintreten, Nebenwirkungen, mit denen niemand gerechnet hat, Konflikte, die plötzlich aufbrechen, Gegenreaktionen, die verheerende Schäden anrichten. Wer soll dafür die Verantwortung übernehmen?
Der Kabarettist Gerhard Polt hat die Figur des „Verantwortungsnehmers” erfunden. Ein Verantwortungsnehmer ist für solche Fälle zuständig. Er hat zwar keinen Einfluss, aber er übernimmt Verantwortung. Vom Sündenbock unterscheidet er sich dadurch, dass er damit einverstanden ist, die Verantwortung zu übernehmen, und dass er dafür mitunter sehr gut bezahlt wird. Er hat zwar einen etwas riskanten Job, weil er hin und wieder abgeschoben oder sogar entlassen werden muss. Aber er wird viel zu sehr gebraucht, als dass man auf einen verdienstvollen „Verantwortungsnehmer” verzichten könnte. Und so kommt er schnell wieder unter.
Macht bedeutet hingegen, etwas in Gang zu setzen, ohne ganz für die Folgen aufkommen zu müssen. Und das hat durchaus seinen Sinn: Denn je weiter Ihre Macht reicht, umso weniger sind die Folgen kalkulierbar. Es sind mehr und mehr Personen beteiligt, die ihre eigenen Ziele verfolgen, die Fehler machen oder vor allem auch gegen Sie arbeiten. Es gibt unvorhersehbare Wendungen, dumme Zufälle, Sabotage, verdeckte Spätfolgen. Wenn Sie sich all das zurechnen lassen müssten, dann wäre dies das Ende Ihrer Macht. Sie wären zum „Verantwortungsnehmer” geworden, auf den alle anderen ihren Anteil an Schuld abwälzen könnten. In Zukunft müssten Sie alles kontrollieren, auf Nummer sicher gehen, auf Bewährtes setzen, um solche bösen Überraschungen zu vermeiden. Mit Macht hätte das nicht viel zu tun. Es führt also kein Weg daran vorbei: Wer Macht sucht, muss Verantwortung loswerden können.[27]
Es geht allerdings auch anders. Eine eindrucksvolle Variante besteht darin, die Verantwortung zu übernehmen – ohne die Verantwortung zu übernehmen. Selbstbewusst erklären Sie: „Ich übernehme die volle Verantwortung.” Weitere Konsequenzen hat das keine. Niemand tritt zurück, keiner bekommt weniger Gehalt oder muss für einen wohltätigen Zweck spenden. Die Sache ist einfach erledigt, weil Sie Ihre Erklärung abgegeben haben. Und alle anderen schweigen – tief beeindruckt von so viel menschlicher Größe.
Die besten Absichten
Dass jemand die Verantwortung übernimmt, ist die eine Legitimation von Macht. Die zweite sind die guten Absichten, die er verfolgt, die Werte, an die er sein Handeln bindet. Wir haben es ja schon angesprochen: Wer im Verdacht steht, dass es ihm ausschließlich darum geht, sich durchzusetzen, stößt nicht gerade auf Sympathie und erweckt kaum Vertrauen. Wer Macht ausüben will, der braucht gute Gründe dafür. Was er vorhat, muss einem respektablen Zweck dienen. Sonst stößt er auf Widerstand und muss anstelle von Macht Zwang ausüben. Auf die Frage seines Gegenübers: „Warum soll ich das tun?” darf er nicht schweigen.[28]
In Organisationen lässt sich aber oft beobachten, dass die Angehörigen der unteren Hierarchie-Ebenen von den guten Absichten der oberen nicht restlos überzeugt sind. Manche zucken verächtlich die Schultern, andere machen sich über die angeblich so hehren Motive ihrer Vorgesetzten lustig. Das ist jedoch im Allgemeinen kein Grund zur Sorge. Ja, es hat sogar einen gewissen Nutzen, wenn die Mitarbeiter meinen, dass sie sich „keine Illusionen” darüber machen, was ihre Vorgesetzten „eigentlich” antreibt: Der pure Eigennutz, die reine Machtgier, wie auch immer die wenig schmeichelhaften Unterstellungen lauten. Die vermeintliche Entlarvung gibt ihnen das erhebende Gefühl, das Spiel zu durchschauen, bei dem sie trotzdem weiter mitmischen. Das ungünstige Urteil über „die da oben” wird im Übrigen deutlich milder, wenn man selbst aufsteigt.
Doch warum, könnte man nun fragen, brauchen „die da oben” überhaupt Gründe und Rechtfertigungen ihrer Macht, wenn „die da unten” ihnen ohnehin nicht recht glauben? Wäre es nicht ehrlicher, auf solche Spielchen zu verzichten? Keineswegs. Und zwar aus zwei Gründen: Es ist ja überhaupt nicht ausgemacht, dass die Mitarbeiter mit ihren Unterstellungen Recht haben. Vielmehr sind diese Unterstellungen selbst Teil des Spielchens. Mit ihnen werten sich die Mitarbeiter auf und schweißen sich als Gruppe gegen „die da oben” zusammen, denen sie sich ausgeliefert fühlen. Das Spiel wäre sofort zu Ende, wenn ihre Unterstellungen ernsthafte Konsequenzen hätten und sie ihre Vorgesetzten absetzen könnten. Und ebenso würde sich die Situation grundlegend ändern, wenn es die Führung wäre, die behaupten würde: Uns geht es um nichts anderes als um persönliche Machtentfaltung.[29]
Zweiter Grund: Die Rechtfertigung richtet sich keineswegs nur an diejenigen, die tätig werden sollen. Auch andere, die mit „denen da oben” zu tun haben, beobachten und bewerten deren Verhalten: Geschäftspartner, Konkurrenten, die Öffentlichkeit. Wer Zweifel daran aufkommen lässt, dass er respektable Absichten verfolgt, ruiniert seinen Ruf. Und das kann ihn sogar die Macht kosten, denn mit so jemandem möchte man nicht gerne zusammenarbeiten, man passt sehr genau auf, nicht übervorteilt zu werden, und sieht sich nach Alternativen um. Und schließlich brauchen wir die „guten Gründe” nicht zuletzt, um uns selbst zu überzeugen. Wenn wir unsicher sind, ob wir überhaupt „das Richtige” wollen, dann schwächt uns das gewaltig. Vielleicht lassen wir uns sogar noch umstimmen, knicken ein, werden weich. Daher haben manche Informationsveranstaltungen weniger den Sinn, die Mitarbeiter von der Richtigkeit einer bestimmten Maßnahme zu überzeugen, sondern sie stärken die Führungskräfte selbst, die diese Maßnahme ihren Mitarbeitern gegenüber erläutern. Wenn sie die Sache schlüssig finden, dann hat der Workshop sein Ziel vollkommen erreicht.[30]
Die Kontrollillusion
Zum Abschluss dieses Kapitels müssen wir noch eine unbequeme, vielleicht aber auch ganz tröstliche Einsicht loswerden: Wir Menschen neigen dazu, unsere Macht und unseren Einfluss hemmungslos zu überschätzen. Die amerikanische Psychologin Ellen Langer hat diesen Effekt vor über 30 Jahren in ihren Laborexperimenten nachgewiesen und „Kontrollillusion” genannt. Pure Zufallsereignisse erscheinen uns demnach so, als hätten wir sie ausgelöst. Voraussetzung für diese Täuschung ist, dass uns sogenannte „Skill cues” begegnen, das sind Anzeichen dafür, dass wir unsere Fertigkeiten ins Spiel bringen (müssen). Wenn Sie sich in einer Wettbewerbssituation befinden, wenn Sie irgendeine Auswahl treffen müssen (deren Ergebnis Sie gar nicht vorhersagen können), wenn Sie irgendeine Handlung selbst vollziehen müssen (zum Beispiel würfeln oder eine Taste drücken), dann sind das „Skill cues”, die uns annehmen lassen, wir würden die Dinge steuern. Das ist der entscheidende Unterschied zu der Situation, in der sich die Babys befanden, von denen zu Beginn des Kapitels die Rede war: Die wandten sich ab, als sie merkten, dass sie die Lichteffekte nicht beeinflussen konnten. Kein Wunder, denn da gab es ja auch keine „Skill cues”, die sie hätten annehmen lassen, dass sie die bunten Blitze doch steuern. Bei der Kontrollillusion lautet hingegen die Botschaft: Gib den Menschen ein paar Knöpfe, die sie drücken können, schaffe eine Wettbewerbssituation, und schon werden sie annehmen, sie hätten die Dinge in der Hand.[31]
An manchen Situationen sind wir zwar beteiligt, nehmen aber kaum Einfluss darauf. Häufig lässt sich das komplizierte Geflecht von Einflüssen auch gar nicht entwirren. Es gibt keinen Hauptverursacher, sondern nur ein Bündel von Reaktionen und Gegenreaktionen, das keiner ganz durchschaut. Doch auch hier schreiben wir uns oft einen maßgeblichen Einfluss zu – zumindest wenn das Ergebnis unseren Hoffnungen und Erwartungen entspricht oder wenn wir es uns schönreden können. Geht die Sache hingegen schief, dann kehrt sich der Effekt eher um: Wir halten unseren Einfluss für gering, wir konnten uns mit unseren Vorstellungen nicht durchsetzen oder wir haben durch unseren Einfluss gerade noch Schlimmeres verhindert. In unserem Inneren wiederholt sich das Spiel mit der Verantwortung, das ich gerade beschrieben habe. Auch vor uns selbst müssen wir immer wieder Verantwortung abgeben (können), um weiterhin Macht auszuüben, kurz, um handlungsfähig zu bleiben.
Darin liegt denn auch der eigentliche Nutzen der Kontrollillusion (und ihrer Umkehrung): Wir müssen diese komplizierte Welt zu unseren Gunsten vereinfachen und uns für einflussreicher halten, als wir es letztlich sind. Das versetzt uns überhaupt erst in die Lage, Pläne zu machen und Projekte anzuschieben, die wir für sinnvoll halten. Würden wir uns klarmachen, wer uns alles reinredet, unsere Absichten durchkreuzt und überhaupt eingreift, dann könnten wir schnell mutlos werden. Allerdings könnten wir noch mutloser werden, wenn wir uns auch für alles verantwortlich machen müssten, was schief läuft. Hier muss dann die „Entlastungsillusion” her. Und so bleibt am Ende dieses Kapitels die Einsicht, dass wir beim Spiel um die Macht nicht nur die anderen austricksen und täuschen – sondern vielleicht am meisten uns selbst.[32]
2 Was sind Machtspiele?
„Sie spielen ein Spiel. Sie spielen damit, kein Spiel zu spielen. Lasse ich erkennen, dass ich sie spielen sehe, dann breche ich die Regeln und sie werden mich bestrafen. Ich muss ihr Spiel spielen, nicht zu sehen, dass ich das Spiel sehe.“
Ronald D. Laing: Knoten
„Der will doch nur spielen.“
Unbekannter Hundebesitzer
Keiner mag sie, aber alle wollen wissen, wie es gemacht wird. So ist das mit den Machtspielen. Einerseits haben sie einen miserablen Ruf. Sie gelten als unfair und hinterhältig, gutgläubige Menschen werden damit hereingelegt, Vertrauen wird vernichtet, Idealismus zerstört, Zynismus breitet sich aus. Nur die abgebrühtesten Machtmenschen erklären mit einem breiten „Ich rauche gern!”-Grinsen, dass sie zu Machtspielen ein „entspanntes Verhältnis” haben, was nichts anderes heißen soll als: „Vorsicht, ich habe die moralischen Skrupel eines Pitbull-Terriers.” Über Führungskräfte, die als fair und integer gelten, wird hingegen gerne behauptet, dass sie „auf Machtspiele verzichten” oder diese ihnen „fremd sind”, was als Kompliment gemeint und – wie alle Komplimente – halb gelogen ist.[33]
Denn es macht sich kaum jemand Illusionen: Wo Macht ist, da sind auch die Machtspiele nicht fern. Und wer sie nicht zu spielen versteht, der wird sich bald verabschieden müssen – von der Macht. Immerhin hat man ja nicht nur mit den Machtspielen zu tun, die man selbst anzettelt, sondern wird vor allem in die der anderen verwickelt. Auf Dauer ist es einfach nicht möglich, sich herauszuhalten. Vielmehr ist man gezwungen, auf die eine oder andere Weise mitzuspielen, um die eigenen Interessen zu wahren. So ergibt sich die spannungsreiche Ausgangslage, dass zwar fast keiner Lust auf diese schmuddeligen Spiele hat, dass aber fast alle sie mitspielen.
Allerdings müssen wir sorgsam unterscheiden zwischen den kleinen, alltäglichen Machtspielen, um die man kaum herumkommt, wie wir noch sehen werden, und den großen, bösartigen Intrigen. Viele haben ja vor allem die vor Augen, wenn von Machtspielen die Rede ist. Sie denken an skrupellose Karrieristen und heimtückische Mobber, die ihre Mitmenschen seelisch kaputtmachen. Doch das sind, wie ich glaube, nicht „die” Machtspiele, sondern die Auswüchse davon. Man würde die meisten Machtspiele unter den Tisch fallen lassen, wenn man sich nur auf dieses Horrorkabinett menschlicher Niedertracht beschränken würde. Was nicht bedeutet, dass die anderen Machtspiele immer harmlos und akzeptabel wären. Und auch diejenigen, die unscheinbar beginnen, können eine Eigendynamik bekommen und plötzlich ins Zerstörerische abdriften – ohne dass einer der Beteiligten das beabsichtigt hat.[34]
Spiele der Erwachsenen
Wieso sprechen wir im Zusammenhang mit dem Thema Macht überhaupt von Spielen? Ist die Sache nicht viel zu ernst? Tatsächlich sind Machtspiele alles andere als ein unbekümmerter Zeitvertreib. Spiele sind sie auch in einem anderen Sinn. Sie folgen ihren eigenen Regeln. Sie schaffen Spieler und Gegenspieler, typische Spielzüge und Gegenzüge. Womöglich gibt es auch ein Publikum, das den Ablauf des Spiels verfolgt und kommentiert. Wie bei jedem anderen Spiel wird das Verhalten der Spieler erst verständlich, wenn man das Spiel und seine Regeln kennt.
Und es kommt noch etwas hinzu: Die Doppelbödigkeit. Für den amerikanischen Psychologen Eric Berne ist das überhaupt das wichtigste Merkmal der „Spiele der Erwachsenen” (so der Titel seines sehr einflussreichen Buchs): Der Handelnde gibt vor, „das eine zu tun, während er in Wirklichkeit etwas anderes tut”. Oder noch deutlicher: Irgendein „Schwindel” ist immer mit im Spiel, wie Berne sagt. Wenn Ihr Chef Sie anbrüllt, weil er ein Choleriker ist, dann ist das kein Machtspiel. Tut er das Gleiche jedoch, weil er der Ansicht ist, zur Festigung seiner eigenen Position müsste er mal wieder jemanden vor Publikum herunterputzen (→ Ein Huhn schlachten, Kapitel 4.5[35]), dann ist das ein lupenreines Machtspiel.
Wenn es um Macht geht, liegt die Doppelbödigkeit besonders nahe. Dafür gibt es zwei Gründe. Einmal möchte man all das verschleiern, was wir im ersten Kapitel die „Unanständigkeit der Macht” genannt haben: Dass ich jemandem meinen Willen aufnötige. Dass ich ihn daran hindere, das zu tun, was er will. Dass ich seine Abhängigkeit für meine Zwecke ausnutze. Wenn ich das dem anderen unter die Nase reibe, fordere ich nur seinen Widerwillen heraus und untergrabe damit meine eigene Macht. Aber auch für das Gegenüber kann eine solche Doppelbödigkeit vorteilhaft sein. Denn sie erspart ihm die Demütigung, nicht seinem eigenen Willen folgen zu können. Eine „unverhüllte” Machtausübung würde hingegen verhindern, dass er sein Gesicht wahren kann – wenn er sich beugt.
Der zweite Grund betrifft die Quellen der Macht selbst: In vielen Fällen erlaubt mir überhaupt erst die Doppelbödigkeit, Einfluss zu nehmen. Wenn ich bei Verhandlungen nicht bereit bin, „das Spiel” mitzuspielen (→ Verhandlungsspiele, Kapitel 6), dann habe ich gegen die anderen keine Chance. Ebenso gerate ich schnell ins Hintertreffen, wenn ich gegenüber meinen Konkurrenten allzu leicht auszurechnen bin. Und auch ein ungetrübtes Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern ist ohne ein gesundes Maß an „Schwindel” (im Sinne von Berne) kaum vorstellbar. Das gilt übrigens in beiden Richtungen: Die Mitarbeiter ziehen ihre Macht ebenso aus den Spielen, in die sie ihre Vorgesetzten verstricken (→ Mitarbeiterspiele, Kapitel 5[36]). Oder versuchen Sie einmal ganz ohne „Spiel”, zum Beispiel Ihren Urlaub um zwei Wochen vorzuziehen, sich unliebsame Aufgaben vom Hals zu halten, um die entnervende Zusammenarbeit mit unfähigen Kollegen herumzukommen oder den vereinbarten Abgabetermin um ein paar Tage zu überschreiten.
Machen die das mit Absicht?
Was die Doppelbödigkeit betrifft, so müssen wir uns die Sache noch ein wenig genauer anschauen. Es liegt ja nahe anzunehmen: Wenn jemand ein Machtspiel betreibt, so geschieht das ganz bewusst, mit voller Absicht und Vorsatz. So jemand verbirgt seine wahren Motive, über die er sich völlig im Klaren ist. Er ist es, der die anderen täuscht, die seine Spielzüge nicht durchschauen und sich austricksen lassen.
Doch häufig ist das gar nicht so. Wir haben es ja eben angesprochen: Es gibt durchaus Spiele, bei denen die anderen die Doppelbödigkeit durchschauen und sich bereitwillig auf sie einlassen. Man macht sich gegenseitig etwas vor, um sein Gesicht zu wahren. Allerdings ist ein anderer Fall weit häufiger: Dem Machtspieler ist selbst gar nicht so ganz bewusst, welches Spiel er da treibt. Er tut es dennoch. Womöglich nach allen Regeln der Kunst. Mit schlafwandlerischer Sicherheit. Das ist kein Zufall. Denn einige Machtspiele haben erst dann Erfolg, wenn sich derjenige, der sie betreibt, zumindest nicht vollständig über seine Spielzüge bewusst ist. Er muss sich selbst etwas vormachen, seinen „Schwindel” ernstnehmen, damit die Sache gelingt.[37]
Der Evolutionsbiologe Robert Trivers hat diesen Zusammenhang akribisch herausgearbeitet. „Betrug und Selbstbetrug” hat er seine Studie genannt. Beide Formen der Täuschung hängen enger miteinander zusammen, als uns bewusst ist. Wer seine Mitmenschen hereinlegt, der ist oft ehrlich davon überzeugt, alles gehe mit rechten Dingen zu. Manche neigen sogar zu der Ansicht, ihre Opfer sollten ihnen sogar noch dankbar sein.