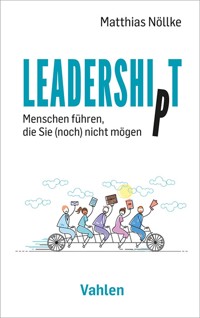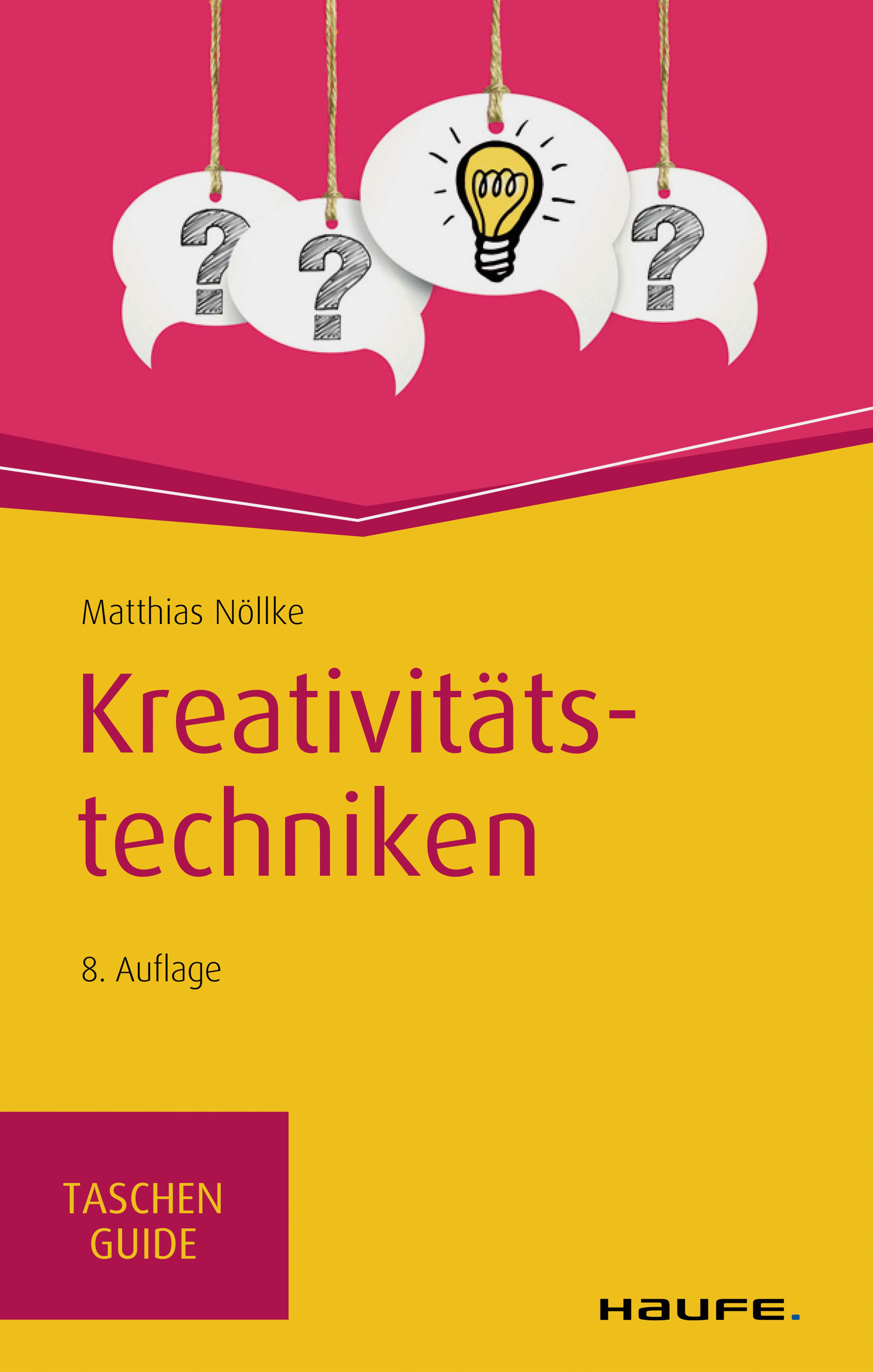28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haufe Lexware
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Haufe Fachbuch
- Sprache: Deutsch
Best of "Von Bienen und Leitwölfen" und "In den Gärten des Managements" - mit neuen Texten! Auf unterhaltsame und lehrreiche Weise erschließt Ihnen der Autor das Feld der Managementbionik. An Beispielen aus Flora und Fauna zeigt er, wie Führung funktioniert und wie Sie diese erfolgreich gestalten können. Lassen Sie Ihre Managementtechniken für Reden und Mitarbeitergespräche sowie für zahlreiche andere Bereiche hiervon inspirieren und verbessern. So können Sie als Führungskraft ihre Rolle aktiv gestalten und optimieren. Überarbeitete und erweiterte Neuausgabe der beiden Erfolgstitel "von Bienen und Leitwölfen" und "In den Gärten des Managements". Inhalte: - Von Bienen und Leitwölfen: Leittiere, Konkurrenz und Konflikte - Wir superkooperativen, eigennützigen Primaten - Drei Erfolgskonzepte der Natur: Das Handicap-Prinzip, virale Kommunikation, Schwarm-Intelligenz - In den Gärten des Managements: Gärten als Vorbilder für Managementprinzipien
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 436
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Matthias Nöllke
ManagementBIOnik
Wie Tiere und Pflanzen Führungskräfte inspirieren können
1. Auflage
Haufe GroupFreiburg · München · Stuttgart
Hinweis zum Urheberrecht
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der DeutschenNationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.dnb.de abrufbar.
Print:ISBN 978-3-648-12404-8Bestell-Nr. 16668-0001
ePub:ISBN 978-3-648-12405-5Bestell-Nr. 16668-0100
ePDF:ISBN 978-3-648-12406-2Bestell-Nr. 16668-0150
Dr. Matthias Nöllke
ManagementBIOnik
1. Auflage 2019
© 2019 Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg
www.haufe.de
Produktmanagement: Bernhard Landkammer
Lektorat: Helmut Haunreiter, Marktl am Inn
Satz: Konvertus BV, Haarlem
Umschlag: RED GmbH, Krailling
Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschließlich Mikrokopie) sowie der Auswertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen, vorbehalten.
Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum UrheberrechtDie wichtigen Worte vorwegWas ist Managementbionik?Das erfolgreichste Unternehmen aller ZeitenDrei Ansätze der ManagementbionikLebende Systeme: »It’s a livin’ thing«Wir superkooperativen eigennützigen PrimatenDer erste Teil: Von Bienen und LeitwölfenNeue Metaphern aus der NaturLeittiereDer König der Tiere ‒ der fette faule LöweDer Leitwolf und sein Beta-MännchenOrang-Utans ‒ der Ruf des sanften PaschasDer fürsorgliche GraudrosslingErfahrung führt ‒ Management in der ElefantenherdeInitiatoren und Entscheider ‒ wie Paviane einen Fluss überquerenErfolgreich im Verborgenen ‒ der flexible FuchsDer König der Lüfte ‒ der AdlerKonkurrenz und KonflikteDer Hirsch und sein GeweihStreitschlichter in der AffenhordeGesträubtes Fell und tiefe Laute ‒ so funktionieren DrohsignaleMachtkämpfe unter MeerschweinchenVerlierer sind gefährlich ‒ die »umgeleitete Aggression«Affentaktik ‒ warum nicht immer der Stärkste die Alphaposition erobertTupajas im DauerstressDie Faultier-Strategie ‒ der Triumph der TrägheitEvolutionDie natürliche AusleseEs lebe die Vielfalt ‒ die Erfindung der SexualitätDie Entstehung der ArtenWettlauf auf der Stelle ‒ die »Red-Queen-Hypothese«Wie die Vögel fliegen lerntenDrei Erfolgskonzepte der NaturDas Handicap-PrinzipVirale KommunikationDie Keystone-SpeciesSchwarm-IntelligenzKleine Schritte, klare Ziele ‒ der TermitenmanagerVerborgene Ordnung ‒ das Geheimnis der hundertsten AmeiseDie Schwarm-Intelligenz der HeringeDie Weisheit des BienenstocksDie Spur der Düfte ‒ wie Ameisen ihre Straßen anlegenZehn Thesen zum ersten TeilDer zweite Teil: In den Gärten des ManagementsGrundprinzip BiophilieIm Hausgarten: Ein neues Selbstverständnis von FührungZeige deinen GartenFühren wie die GärtnerDas GartenzaunprinzipVom Pflegen des GartensDer Umgang mit der ZeitDie innere HaltungIm Obstgarten: Mitarbeiter fördernVon der Ernte her denkenDer Dreiklang gärtnerischer FührungOrientierung geben: Die Kunst Bäume zu schneidenÜberreiche Ernte: Engagement honorierenEntscheidungstraining im ErdbeerbeetKonkurrenzlos erfolgreichIm Klostergarten: Innovationsräume schaffenDie vier Elemente des KlostergartensWie man Mitarbeiter anpflanztNachbarschaften: Inspiration oder FrustrationIm Senkgarten: Individualität schützenInnenwelt und AußenweltEin geschützter LebensraumDer richtige Umgang mit CharakterpflanzenIm botanischen Garten: Lernen von den klugen PflanzenDer Garten als LehrbuchPflanzen in BewegungEinen neuen Lebensraum besiedelnWie sich Pflanzen wehrenEvolution in Natur und WirtschaftIm Waldgarten: Nachhaltig führenDer Markt als ÖkosystemDas Unternehmen als ÖkosystemNachhaltigkeit im ManagementEine langfristige PerspektiveDas Mehrgenerationen-UnternehmenIm Guerilla-Garten: Engagement und IdealismusDie Stadt zu unserem Garten machenFührung und EigenverantwortungGemeinsinn macht starkDie NischenstrategieEinfach loslegenLiteraturDie wichtigen Worte vorweg
Die Natur als Inspirationsquelle für Führung und Management zu nutzen, darum geht es bei der Managementbionik. Seit gut 16 Jahren beschäftigt mich das Thema. Drei Bücher habe ich dazu verfasst ‒ mit unterschiedlichem Schwerpunkt: »So managt die Natur« (2003), »Von Bienen und Leitwölfen« (2008) und »In den Gärten des Managements« (2011). Die Resonanz war ausgesprochen positiv und das Interesse groß. Für zahlreiche Unternehmen und Organisationen habe ich Vorträge gehalten, auf Tagungen gesprochen, mich mit anderen ausgetauscht, von vielen Seiten neue Anregungen und Hinweise bekommen.
Nach meinem Eindruck hat das Thema keineswegs an Bedeutung verloren ‒ in Zeiten von Disruption und Digitalisierung. Denn Umbrüche, Kippeffekte, überbordende Komplexität, Verflüchtigung und Neuverteilung von Macht, all das begegnet uns auch in der Natur. Und es gibt Modelle, diese Vorgänge zu beschreiben und einzuordnen, was uns hilft, sie besser zu verstehen. Daher ist Haufe auf mich zugekommen und hat vorgeschlagen, ein eigenes Buch über Managementbionik herauszubringen. Eine Art Blütenlese aus den vorangegangenen Büchern »Von Bienen und Leitwölfen« und »In den Gärten des Managements«. Ergänzt durch den einen oder anderen neuen Text.
Dieses Buch halten Sie gerade in den Händen. Die wichtigsten Abschnitte aus beiden Publikationen habe ich neu zusammengestellt, aktualisiert, gestrafft und ich habe neue Themen hinzugefügt. Dabei gliedert sich das Ganze in zwei Teile: Im ersten lernen Sie die vielfältigen Ansätze der Managementbionik kennen. Hier stehen unterschiedliche Konzepte und einzelne »Leittiere« als Inspirationsquellen im Vordergrund. Der zweite Teil versteht sich als Plädoyer für eine bestimmte Art von Führung ‒ und die basiert im Wesentlichen auf Prinzipien der Managementbionik. Die Anregungen dazu kommen allerdings nicht aus dem Tier-, sondern aus dem Pflanzenreich.
Zuletzt noch zwei Hinweise: Weitere Materialien zu diesem Buch wie Interviews können Sie unter folgendem Link abrufen: www.haufe.com/managementbionik. Und wenn Sie Interesse an einem Vortrag zum Thema haben, besuchen Sie meine Website www.noellke.de und nehmen Sie Kontakt auf. Gerne können Sie mir auch zu diesem Buch schreiben. Und damit wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!
München, im November 2018
Matthias Nöllke
Was ist Managementbionik?
Während des Zweiten Weltkriegs stellten die Amerikaner Donald R. Griffin und Robert C. Galambos auf einem Zoologenkongress eine aufsehenerregende Entdeckung vor: Fledermäuse orientieren sich mit Echoortung. Für uns ist das nichts Neues. Doch 1940 stießen die beiden Forscher nur auf ungläubiges Staunen. Radar und Sonar galten als Spitzentechnologie des Militärs. Die Vorstellung, dass die unscheinbaren Flugsäuger darüber verfügen könnten, schien geradezu absurd. Den Zuhörern musste das in etwa so vorkommen, wie wenn uns heute jemand erzählen würde, die Dinosaurier hätten Internetanschluss gehabt.
Es ist schon merkwürdig: Je mehr wir über die Natur herausfinden, desto stärker sind wir von ihren Leistungen beeindruckt. Fast hat es den Anschein, als müssten wir erst selbst eine Erfindung machen, um dann zu entdecken, dass sie in der Natur schon lange vorhanden ist. Das gilt sogar für das klassische Gegenbeispiel, von dem man annahm, das hätte allein der Mensch erfunden: Das Rad als Fortbewegungsmittel. Erstaunlicherweise ist auch das in der Natur vorhanden. Und zwar dort, wo man es nicht unbedingt erwarten würde: bei einer handtellergroßen Spinne, die der Berliner Professor Ingo Rechenberg in der Sahara entdeckt hat. Im Normalfall bewegt sie sich krabbelnd auf ihren acht Beinen fort wie andere Spinnen auch. Doch hat sie es eilig, klappt sie ihre Beine zu einer Art körpereigenem Rhönrad zusammen und setzt sich rollend in Bewegung. Mit dieser Methode kann sie bis zu zwei Meter in der Sekunde zurücklegen ‒ was sehr viel schneller ist als das achtbeinige Krabbeln.
Ingo Rechenberg ist übrigens kein Spinnenforscher, er ist Bioniker. Die Bionik dreht gewissermaßen die Sache um: Anstatt zu erfinden, was womöglich in der Natur bereits vorhanden ist, richtet sie den Blick auf die Natur, um zu untersuchen: Welche Lösungen gibt es in der Natur? Und wie lassen sie sich auf Themen übertragen, mit denen wir es zu tun haben? Sehr pointiert formuliert: Die Lösung haben wir schon, wir müssen nur noch unser Problem finden.
Dieser Denkansatz hat eine lange Tradition. Als einer der ersten, der die Sache systematisch angegangen ist, gilt der Botaniker und Mikrobiologe Raoul Heinrich Francé. Vor hundert Jahren nahm er die Pflanzen genauer unter die Lupe, verfasste die Bücher »Die technischen Leistungen der Pflanzen« und »Die Pflanze als Erfinder« und prägte den Begriff »Biotechnik«, der später zu der nunmehr gebräuchlichen Bezeichnung »Bionik« zusammengezogen wurde. Francé war überzeugt, dass gleiche Anforderungen auch gleiche Lösungen nach sich ziehen. Und die Natur hält geradezu optimale Lösungen bereit. In einem Aufsatz aus dem Jahr 1928 schrieb er: »Für das Fliegen, Schwimmen, Laufen, für die Aufbewahrung von Stoffen, für Wasserleitung, für Baufestigkeit, für Zugleistung, für Waffen, Gifte, Elastizität, Durchlässigkeit und hundert andere technische Probleme stellt der lebende Körper eine Sammlung geradezu unübertrefflicher Lösungen dar.«
Francé war es auch, der als erster eine »Erfindung der Natur« zum Patent anmeldete: Einen Salzstreuer, den er nach dem Vorbild der Mohnpflanze entworfen hatte und der seinen Inhalt besser verteilen sollte als das konventionelle Modell, das wir heute noch benutzen. France's Salzstreuer hat sich zwar nicht durchsetzen können, doch ist er in der Geschichte der Bionik von großer Bedeutung. Denn um als Patent anerkannt zu werden, muss eine Erfindung ja neuartig sein. Wer eine Erfindung aus der Natur übernimmt, der ist ja streng genommen gar nicht selbst schöpferisch tätig, er »kopiert« ja nur die natürliche Lösung. Doch diese Sicht hat sich nicht durchsetzen können. Francé bekam das Patent auf seinen Salzstreuer. Natürlich auch, weil es sich um die Übertragung von einem Bereich (die Mohnpflanze verteilt ihre Samen in der Umgebung) in einen anderen (wir salzen unsere Speisen) handelt. Eben in dieser Übertragung besteht die schöpferische Leistung, für die Francé sein Patent zugesprochen bekam.
Seitdem sind zahlreiche Produkte nach dem Vorbild der Natur entwickelt worden: Der Klettverschluss, Abflussrohre, die nicht so schnell verstopfen, Tarnanzüge für das Militär, Autoreifen nach dem Prinzip der Katzenpfote, ein Motorradhelm, der wie die Schale der Pampelmuse Stöße abdämpft, und ‒ das Paradebeispiel für die Bionik ‒ die selbstreinigende Gebäudeoberfläche nach dem Modell der Lotuspflanze, genauer: ihrer Blätter, an denen das Regenwasser abperlt und den Schmutz wegwäscht. Das nennt man den »Lotus-Effekt«. Und dieser Name ist nicht zufällig gewählt. Denn in der buddhistischen Tradition steht die Lotuspflanze für Reinheit, auch geistige Reinheit. Daraus ergibt sich der willkommene Nebeneffekt, dass ein wenig fernöstliche Weisheit nun auch der Bionik anhaftet. Das ist gewiss nicht unverdient, wenngleich daran zu erinnern ist, dass sich der »Lotus-Effekt« auch bei anderen Pflanzen zeigt, bei der Kapuzinerkresse etwa oder beim Gemüsekohl.
In jüngster Zeit macht eine bionische Erfindung von sich reden, die noch weit über den Lotus-Effekt hinausgehen könnte. Vielleicht revolutioniert sie die Medizin: Winzige Nanomaschinen, die in Zukunft Operationen durchführen und Arzneimittel punktgenau an ihren Einsatzort bringen. Diese Mikroroboter sind 200mal dünner als ein menschliches Haar. Was sie aber so besonders macht: Sie sind »biogängig«, haben eine besondere Beschichtung, die es erlaubt, problemlos durch unsere Körper zu gleiten. Bei der Entwicklung dieser Beschichtung haben sich die Forscher an der Oberfläche von fleischfressenden Pflanzen orientiert. Genauer: an dem Kelch der Kannenpflanzen. Wenn Insekten dort hineingeraten, gibt es kein Halten mehr, rutschen zuverlässig in den klebrigen Magen der Pflanze. Seine Vorbilder kann man sich eben nicht immer aussuchen.
Das erfolgreichste Unternehmen aller Zeiten
Nun hält die Natur aber nicht nur für Produktentwickler eine Vielzahl von Anregungen bereit. Auch andere können vom Blick in die Natur profitieren: Führungskräfte, Unternehmer, Berater, Innovatoren, die neue Wege im Management suchen. Immerhin gibt es kein vom Menschen erfundenes System, das so erfolgreich und ökonomisch wirtschaftet wie die Natur. Der Kybernetiker Frederic Vester hat es einmal so ausgedrückt: »Die Natur ist ein Erfolgsunternehmen, das in Millionen Jahren nicht pleite gemacht hat.«
Die Natur als Unternehmen? Man mag diesen Vergleich für etwas überstrapaziert halten. Zumal Pleiten, Pech und Pannen in der Natur an der Tagesordnung sind. Die gehören allerdings dazu. Sie sind geradezu Voraussetzung für die ungeheure Vielfalt und ständige Erneuerung, die uns in der Natur begegnen. Pleiten und Erfolgsgeschichten gehören zusammen. Deshalb sprechen sie nicht dagegen, sondern entschieden dafür, sich die Vorgänge in der Natur genauer anzuschauen. Zumal wir zentrale Prinzipien, die in Unternehmen (und anderen Organisationen) eine Rolle spielen, auch in der Natur finden. Nehmen wir fünf Beispiele:
Wettbewerb: Auf keinem Markt herrschen so harte Bedingungen wie in der Natur. Es geht nicht nur um das Fressen und Gefressenwerden. Das Prinzip der Konkurrenz herrscht überall. Es wird um Futterplätze, Fortpflanzungspartner und Jagdreviere konkurriert, ja sogar um Ruheräume. Und alle Mittel sind erlaubt.
Kooperation: Kein Organismus überlebt für sich allein. Die Natur ist durchdrungen von Kooperationen aller Art. Nicht nur Artgenossen helfen einander, die unterschiedlichsten Lebewesen unterstützen sich gegenseitig, über alle Art- und Gattungsgrenzen hinweg, sogar Konkurrenten werden zeitweilig gefördert. Aus den vielfältigsten Kooperationen ziehen die Lebewesen entscheidende Überlebensvorteile.
Organisation: Ein zentrales Erfolgsprinzip in der Natur heißt Organisation. Wölfe tun es, Ameisen tun es, Piranhas und Delfine tun es auch: Sie schließen sich zusammen und vollbringen gemeinsam die erstaunlichsten Leistungen. Dabei finden wir in der Natur eine ungeheure Vielfalt von Organisationsformen: locker verbandelte, »multikulturelle« Vogelschwärme, variable Delfinteams, despotisch geführte Affenhorden, riesige, hochkomplexe Termitenstaaten und vieles, vieles mehr. Und jede dieser Organisationsformen hat ihren ganz besonderen Sinn.
Kundenansprache: Der biologische Erfolg eines Organismus hängt in hohem Maße davon ab, dass sich ein passabler Fortpflanzungspartner für ihn entscheidet. Tiere und Pflanzen müssen daher werben. Pflanzen werben um Insekten, die die Bestäubung für sie erledigen; bei einigen Tieren gibt es Balztänze und Lockrituale. Kurz gesagt, in der Natur finden wir einige interessante Strategien, wie man eine attraktive, höchst wählerische Zielgruppe anspricht und an sich bindet. Und auch hier sind alle Mittel erlaubt.
Ressourcenmanagement: Niemand muss so ökonomisch denken und handeln wie Tiere und Pflanzen. Jede Jagd, jede Futtersuche, jeder Nestbau, jede Balz, jeder Erwerb zusätzlicher Fähigkeiten, all das verbraucht Ressourcen und muss sich unter dem Strich »rechnen«. Verschwendung endet in der Natur meist tödlich.
Tödlich ‒ das ist ein weiterer wichtiger Aspekt: Die natürlichen Strategien haben den »reality check« bereits bestanden. Sie haben sich in den Jahrmillionen der Evolution nicht nur herausgebildet, sich optimiert, sondern im Kampf ums Dasein eben auch bewährt. Angepasst an die spezifischen Lebensumstände, die wir immer mitbedenken müssen. Lösungen, die nicht funktioniert haben, sind ausgestorben. Insoweit lohnt sich ein Blick auf die Leitwölfe und »Termitenmanager«, auf die Heringsschwärme, die Piranhas und die balzenden Auerhähne. In jedem Pantoffeltierchen steckt eine ganz eigene Erfolgsgeschichte. Und in diesem Sinne ist es eben doch sinnvoll, vom »Erfolgsunternehmen Natur« zu sprechen.
Drei Ansätze der Managementbionik
Allerdings ist Managementbionik alles andere als ein einheitliches Konzept. Das wird zwar immer wieder behauptet, doch handelt es sich meist um den Versuch, den eigenen Ansatz als »die« Managementbionik zu labeln. Immerhin geht es um nichts Geringeres als um die »Lehren aus der Natur«, was schon einen sehr weitreichenden Anspruch offenbart. Mitunter ist auch von den »Naturgesetzen der Führung« die Rede. Was schon sehr anmaßend ist. Denn es ist völlig offen, was von »der Natur« zu lernen ist und wie Vorgänge, die wir in der Natur beobachten, auf das Management übertragen werden sollen. Grob gesagt gibt es drei unterschiedliche, ja kontroverse Ansätze:
Den »pragmatischen Ansatz«
Den »ganzheitlichen Ansatz«
Den »biologistischen Ansatz«
Die Anführungszeichen lassen es schon vermuten: Diese Begriffe sind in keiner Weise verbindlich, sondern eine Eigenkreation, um ein wenig Ordnung zu schaffen.
Der »pragmatische Ansatz«
Beim »pragmatischen Ansatz« werden einzelne Phänomene, die sich im Tier- oder Pflanzenreich aufspüren lassen, auf menschliche Organisationen und Führungsfragen übertragen und den Bedürfnissen entsprechend angepasst. Ganz im Sinne der Bionik ist die Natur Ideengeberin, Inspirationsquelle. Nicht mehr und nicht weniger.
Man kann sagen, die Beispiele aus der Natur sind Metaphern. Es handelt sich um Übertragungen von einem Bereich (Natur) in einen anderen (Management, Unternehmensführung). In diesem Sinne sind die Beispiele niemals »wörtlich« zu nehmen. Es geht immer nur um bestimmte Teilaspekte, die uns interessieren. So lassen sich aus der »Schwarmintelligenz« der Bienen und Ameisen zahlreiche Anregungen aufgreifen. Aber die müssen sich in unserer Welt bewähren. Sie müssen mehr oder weniger stark angepasst und verändert werden. Aus dem einfachen Grund, weil Menschen nun einmal keine Ameisen sind, keine Delfine, keine Leitwölfe und keine Füchse. Gleichwohl können Sie sich von Ameisen, Delfinen und Füchsen auf ganz verschiedene Weise anregen lassen und so auf neue Ideen kommen oder neue Sichtweisen entwickeln.
Diesem Ansatz geht es gar nicht darum, »Naturgesetze der Führung« zu formulieren, sondern bestimmte Vorgänge besser begreiflich zu machen oder auch neue Konzepte auszuprobieren ‒ durchaus auf die Gefahr hin, dass es eben nicht so gut funktioniert wie bei der Amöbe oder im Wolfsrudel.
Der »ganzheitliche Ansatz«
Beim »ganzheitlichen Ansatz« bewegen wir uns auf einer völlig anderen Ebene. Nicht Teilaspekte werden betrachtet, sondern das große Ganze. Und im Unterschied zum »biologistischen Ansatz«, dem wir uns gleich zuwenden, werden hier nicht die Menschen, sondern Unternehmen und andere soziale Gebilde als biologische Entitäten, als »lebende Systeme« aufgefasst. Es werden Grundprinzipien formuliert, nach denen alle »Lebewesen«, d. h. auch »lebensfähige« Organisationen funktionieren.
Dabei handelt es sich um einen sehr weit reichenden Ansatz mit einem sehr weitreichenden Anspruch. Das traditionelle, »mechanistische« Modell der Unternehmen und der Unternehmensführung soll ersetzt werden. Durch ein neues, besseres Modell: Die Organisation als Lebewesen. Üblicherweise werden Unternehmen ja als eine Art Maschine betrachtet. Vielfach noch heute. Diese Maschine soll von den Führungskräften möglichst effizient »gesteuert« werden. Dazu stehen ihnen bestimmte »Stellhebel« zu Verfügung. Management erscheint als technischer, leidenschaftsloser Vorgang, der nach einer zwingenden Logik funktioniert.
Eben dieses Maschinenmodell verwirft der »ganzheitliche« Ansatz und ersetzt es durch die Vorstellung vom »lebenden System«. Das zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es sich ständig verändert und sich nicht so ohne Weiteres »steuern« lässt. Vielmehr führt es ein Eigenleben. Es steuert und organisiert sich im Wesentlichen selbst. Welche Rolle da den Führungskräften zukommt, darüber gibt es unterschiedliche Auffassungen. Davon wird gleich noch zu sprechen sein. Konsens ist immerhin, dass es in einer solchen Organisation keine Machtpyramide gibt, ja nicht einmal eine zentrale Steuerungsinstanz, die von oben herab Befehle erteilt und Entscheidungen trifft. Vielmehr sind Führungskräfte selbst Teil des »lebenden Systems«, sie stehen nicht außerhalb. Sie nehmen Einfluss und sie werden beeinflusst. Sie haben die Aufgabe, Teams arbeitsfähig zu machen und ihnen Verantwortung zu übertragen. In den Worten des Organisationstheoretikers Frederic Laloux zeichnen sich Manager dieser neuen, zeitgemäßen Art von Organisation durch einen »fürsorglichen, dienenden Führungsstil« aus.
Zum »ganzheitlichen Ansatz« gehört auch das Konzept vom »evolutionären Management«. Dabei werden Begriffe aus der Evolutionstheorie auf die Unternehmensführung und das Management übertragen: Selektion, Überlebensvorteil, Adaptionsfähigkeit, Koevolution und vieles mehr. Nicht selten verbinden sich auch beide Ansätze: Die Organisation erscheint als lebendes System, das sich nach evolutionären Gesetzmäßigkeiten weiterentwickelt und sich ständig an seine Umwelt anpasst. Gelingt dies nicht, verliert es seine Überlebensfähigkeit. Es geht zugrunde.
Der »biologistische Ansatz«
Als dritte Variante kommt ein Ansatz ins Spiel, bei dem unser »biologisches Erbe« im Vordergrund steht. Denn als Menschen sind wir keine reinen Vernunftwesen, sondern werden auch von unserer Biologie bestimmt. Auch und gerade als Angehörige eines Unternehmens sind wir das. Die Evolution hat nicht nur Wölfe, Ameisen und das Pantoffeltierchen geformt, sondern eben auch uns und unsere Gehirne, mit denen wir über das Management nachdenken. Wir sind Geschöpfe der Natur und nicht am Reißbrett konstruiert worden.
Unsere Gene teilen wir nicht nur mit den Affen, sondern auch mit Hunden, Schweinen, Mäusen, Fadenwürmern und ‒ hätten Sie das gewusst? ‒ der Bäckerhefe. Die Verwandtschaft mag weitläufig sein, doch sind wir gewissermaßen Teil derselben Familie. Entscheidend aber ist: Unser Denken und Handeln wurzelt in unserer Natur. Wir werden weit stärker von ihr bestimmt, als es uns bewusst ist. Und das gilt ganz besonders für Fragen, die für Führungskräfte relevant sind: Wieso besitzen manche Menschen eine natürliche Autorität und andere nicht? Wie entsteht Vertrauen? Wodurch geht es verloren? Wen betrachten wir als Konkurrenten und wen als Verbündeten? Wie groß sollte eine Gruppe sein und wann verlieren wir die Übersicht? Wie können wir mit Aggressionen umgehen, so dass sie uns nicht schaden? Wie mit starken Gefühlen, Euphorie, Stolz, Verachtung, Wut? Wie lässt sich Kooperation und Austausch fördern? Wie lassen sich Veränderungen anschieben? Und wann müssen wir mit Widerstand rechnen?
Dabei darf keineswegs in Vergessenheit geraten, was uns Menschen als Kulturwesen auszeichnet: dass wir über Sprache verfügen, mit Werten und Moral umgehen und eine einzigartige Form der Kooperation ausgebildet haben: die Kooperation unter Fremden (mehr dazu gleich). Doch ein »biologischer« Blick auf uns und unsere Unternehmen kann helfen, manches besser zu verstehen ‒ und Fehlentscheidungen zu vermeiden, die gegen unsere innere Natur gerichtet sind.
Lebende Systeme: »It’s a livin’ thing«
Unternehmen sind keine Maschinen. Sie lassen sich nicht konstruieren, bauen und benutzen. Vielmehr führen sie ein Eigenleben, wie alle sozialen Gebilde. Wir können sie als eine Art Lebewesen betrachten, als »lebendes System«. Dabei handelt es sich weniger um eine Zustandsbeschreibung als vielmehr um eine Zielvorstellung, ein Leitbild, eine »neue Metapher«, wie der bereits erwähnte Frederic Laloux in seinem vielbeachteten Buch »Reinventing Organizations« schreibt. Unternehmen, die sich als »lebendes System« organisieren, sind den »Maschinenunternehmen« überlegen. Sie sind adaptiver, lernfähiger und verfügen über engagiertere Mitarbeiter. Dadurch sind sie weit eher in der Lage, mit komplexen Herausforderungen umzugehen und Umbrüche zu meistern. Ändern sich die äußeren Bedingungen, funktionieren Maschinen nicht mehr richtig, sie müssen mit erheblichem Aufwand neu justiert werden, womöglich gehen sie auch kaputt. Lebewesen passen sich hingegen an, sie wachsen an ihren Aufgaben, bilden neue Fähigkeiten aus. Und zwar ganz von allein.
Es gibt eine ganze Reihe von Autoren, die sich auf das Konzept vom »lebenden System« oder vom »lebenden Unternehmen« beziehen: Etwa Arie de Geus, Peter M. Senge, Fredmund Malik, Richard T. Pascale und Frederic Laloux. Jeder von ihnen setzt seine eigenen Akzente. Und doch lassen sich aus dem Gesamtbild die folgenden neun Grundsätze ableiten:
Ein lebendes System entsteht nicht durch Planung und Konstruktion. Es entwickelt aus sich heraus eigene Strukturen und Prozesse. Es folgt dem Prinzip der Selbstorganisation.
Ein lebendes System lässt sich nicht von außen kontrollieren und steuern. Es steuert sich selbst. Von außen lässt es sich allenfalls beeinflussen.
In einem lebenden System gibt es keine zentrale Steuerungsinstanz, dazu ist es viel zu komplex. Steuerung findet auf vielen Ebenen gleichzeitig statt; sie ist in Netzwerken verteilt.
Ein lebendes System wird gestärkt durch Belastungen und Krisen, die Gegenkräfte mobilisieren.
Ein lebendes System wird robuster durch innere Vielfalt.
Ein lebendes System muss durchlässig sein. Es steht im Austausch mit seiner Umwelt. Es reagiert auf Veränderungen, es lernt dazu. Es verhält sich adaptiv.
Ein lebendes System ist ein kohärentes Gebilde mit einer starken Identität, einem Wesenskern, der bei allen Veränderungen erhalten bleibt. Es ist unverwechselbar.
Bei einem lebenden System darf man die einzelnen Teile nicht isoliert voneinander betrachten. Sie wirken aufeinander ein. Veränderungen an der einen Stelle haben Folgen für das gesamte System. Man muss solche Organisationen »ganzheitlich« betrachten.
Ein lebendes System muss sich ständig erneuern. Sonst erstarrt es und geht zugrunde. Ein lebendes System steckt voller Überraschungen.
Peter M. Senge gibt noch einen weiteren Aspekt zu bedenken: Eine Maschine gehört in der Regel jemandem. Der Eigentümer kann frei über sie verfügen. Ein lebendes System hingegen geht niemals vollständig in den Besitz einer Person über. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass die Inhaber und Anteilseigner nicht über das Unternehmen und seine Vermögenswerte verfügen könnten. Vielmehr macht Senge darauf aufmerksam, dass eben das, was die »Lebendigkeit« einer Organisation ausmacht, nichts ist, was das Eigentum von jemandem sein könnte. Vielmehr tragen alle, die an diesem System beteiligt sind, Mitarbeiter, Kunden, Kooperationspartner und Führungskräfte, dazu bei, dass diese »Lebendigkeit« entstehen kann. Jeden Tag.
Neue Aufgaben für Führungskräfte
Da sich »lebende Systeme« nicht steuern lassen, erhebt sich die Frage: Brauchen solche Organisationen überhaupt noch Führungskräfte? Oder sollten sich die Mitarbeiter und die »agilen Teams« nicht gleich selbst steuern? Tatsächlich gibt es die Auffassung, das traditionelle Management habe ausgedient, Führungskräfte im herkömmlichen Sinn seien in solchen Organisationen verzichtbar, ja sogar störend. Hierarchien sollen abgebaut, eingeebnet werden oder am besten ganz verschwinden. Vor allem das mittlere Management, ohnehin seit Längerem unter starkem Rechtfertigungsdruck, soll weiter an Einfluss und Bedeutung verlieren.
Nach dieser Auffassung geben Führungskräfte keine Anweisungen mehr, sie kontrollieren nicht, bewerten nicht und setzen keine Ziele. Stattdessen unterstützen die Führungskräfte ihre Mitarbeiter. Sie stellen Verbindungen her, sorgen dafür, dass die Teams mit den nötigen Ressourcen ausgestattet werden. Sie »dienen«, sind fürsorglich und üben keine Macht aus. Für ihre Mitarbeiter sind sie »Enabler«, das heißt, sie machen es möglich, dass die ihre Arbeit tun können, im Sinne der Unternehmensziele. Wie sie die erreichen, das festzulegen, ist Sache der Mitarbeiter oder vielmehr der Teams, die auch ihre Ergebnisse selbst kontrollieren.
Eine solche Auffassung geht schon sehr weit über das hinaus, was heute üblich ist, auch in Unternehmen, die sich von ihren Konkurrenten absetzen und neue Wege gehen. Wir können durchaus ein Fragezeichen machen, wenn wir uns überlegen, ob überhaupt irgendeine Organisation dieser Art von Management auch nur nahekommt. Allerdings gibt es das Konzept der »lebenden Organisation« auch ein paar Nummern kleiner. Und da ist sie vermutlich etwas näher an dem, was heute machbar ist und Erfolg verspricht.
Die Idee ist ja nicht falsch, dass Führungskräfte zuhören, ihre Mitarbeiter nicht als Befehlsempfänger betrachten, sondern sich tatsächlich als diejenigen begreifen, die es möglich machen, dass Sinnvolles geschieht. Allerdings wäre es ein wenig voreilig, die altbewährten Führungsaufgaben über Bord zu werfen. Führungskräfte sind heute ganz gewiss nicht die allwissenden Entscheider. Sie tun gut daran, Aufgaben zu delegieren, ihren Mitarbeitern gut zuzuhören und es sich mit dem eigenen Urteil nicht allzu leicht zu machen. Doch genau darin liegt eben ihre Verantwortung als Führungskräfte. Sie sind diejenigen, die dafür sorgen, dass die anderen die Arbeit tun. Und zwar möglichst gut im Sinne der Organisation. Aus dieser Verantwortung sollten Führungskräfte auch gar nicht entlassen werden. Viel spricht dafür, dass eine Organisation mit verantwortungsvollen und selbstbewussten Führungskräften besser abschneidet als eine, deren Führungspersonal jeden Anspruch zu gestalten aufgegeben hat.
Hierarchien im lebenden System
Tatsächlich lässt sich das Modell vom »lebenden System« sehr wohl mit einer aktiven und gestalterischen Rolle von Führung verbinden. Dabei ist es gewiss von Vorteil, Verantwortung zu teilen, viele Entscheidungen den Mitarbeitern zu überlassen und in die Organisation »hineinzuhören«, anstatt die Vorgaben von oben »durchzudrücken«. Und doch haben Führungskräfte auch in einem »lebenden Unternehmen« die Aufgabe, gelegentlich von oben einzugreifen: Wenn etwas aus dem Ruder läuft oder ein Problem »lokal« nicht bewältigt werden kann. Auch gibt es sensible Bereiche, in denen die Einhaltung der Regeln penibel überwacht werden muss. Weil andernfalls das gesamte Unternehmen in Schieflage geraten könnte. Dazu gehört die Einhaltung bestimmter Standards, auch ethischer Standards. Eben das, was für die Organisation essenziell wichtig ist.
Genau diese Zweiteilung findet sich in lebenden Systemen: Auch dort werden viele Aufgaben, man möchte sagen: stillschweigend erledigt. Hierarchisch auf der untersten Ebene. Hier werden auch Probleme gelöst und Veränderungen angeschoben, von denen die höheren Ebenen nicht viel mitbekommen. Es herrscht das Prinzip der Selbstorganisation. Sobald allerdings die Aufgabe nicht bewältigt werden kann oder die Veränderungen einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, kommen die höheren Instanzen ins Spiel. Sie greifen ein, setzen Veränderungen in Gang, mobilisieren Ressourcen, die auf der unteren Ebene nicht verfügbar sind. Dieses Prinzip setzt sich fort. Auf diese Weise kann ein lokales Problem das gesamte System beschäftigen: Alle verfügbaren Kompetenzen werden aufgeboten, um die Sache in den Griff zu bekommen. Das kann auch mal länger dauern und die Prioritäten im Gesamtsystem neu ordnen.
Nach diesem Prinzip arbeitet beispielsweise auch unser Bewusstsein. Fast alle Informationen, die unser Körper verarbeitet, werden uns nicht bewusst. Auch komplexe Entscheidungen treffen wir oftmals »per Autopilot«. Dies gilt vor allem, wenn wir sehr schnell handeln müssen. Erst wenn wir nicht weiterkommen, wenn ein Sachverhalt neuartig ist oder mehrdeutig, dann schaltet sich das Bewusstsein ein. Oder ‒ als zweite Möglichkeit: Wir richten gezielt unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge. Dann werden sie uns bewusst ‒ vielleicht. Denn nicht alle Informationen sind unserem Bewusstsein zugänglich.
Anders gesagt, lebende Systeme kennen durchaus Hierarchien, auch wenn die eher netzwerkartig ineinandergreifen und nicht nach Art der traditionellen Machtpyramide geschichtet sind. Dabei verläuft der Informationsfluss in beiden Richtungen: Nach oben und nach unten, bottom-up und top-down. Die meisten Informationen werden allerdings lokal verarbeitet. Und selbstverständlich überlassen es die »höheren Ebenen« den unteren, sich selbst zu organisieren.
Robustheit, Vielfalt und Flexibilität
Eine wesentliche Eigenschaft lebender Systeme darf nicht vergessen werden: Es ist ihre Robustheit. Darunter ist zu verstehen, dass sie mit wechselnden Belastungen zurechtkommen und es verkraften, wenn Störungen auftreten oder bestimmte Teile des Systems ausfallen. Dafür gibt es zwei Gründe: Ein lebendes System »repariert sich selbst«. Dank einer Eigenschaft, die wir bereits kennengelernt haben: die Selbstorganisation. Zweitens verfügt ein lebendes System über Reserven und freie Kapazitäten, auf die es zurückgreifen kann. Lebende Systeme sind nicht »auf Kante genäht«. Sie können zusätzliche Kräfte und Ressourcen mobilisieren. Dabei helfen zwei Eigenschaften: Vielfalt und Flexibilität. Vielfalt bedeutet: Das lebende System kann auf die unterschiedlichsten Kompetenzen zurückgreifen. Das heißt, in einer solchen Organisation sind die verschiedensten Charaktere und Talente willkommen. Jeder hat seine besonderen Stärken und Schwächen, die sich ausgleichen können. Zugleich aber muss Flexibilität hinzukommen: Mitarbeiter und Führungskräfte sind bereit, die unterschiedlichsten Aufgaben zu übernehmen und einander auszuhelfen. Abteilungsgrenzen werden durchlässig, Hierarchien ebenso. Je nach Kompetenz und Interesse können die Mitglieder einer solchen Organisation zeitweise die Führung übernehmen und sich bei der Führung abwechseln.
Zur Robustheit gehört auch, dass sich das lebende System immer wieder regenerieren kann. Alle Mitglieder brauchen Zeit, neue Kräfte zu schöpfen. Auch die gesamte Organisation benötigt Ruhephasen. Sonst verliert sie ihre Robustheit und gerät in eine Phase der Erschöpfung. Sie reagiert nur noch, verliert ihre Fähigkeit zu gestalten und sich zu erneuern. Erschöpfte Organisationen machen ihre Mitglieder krank, sie büßen selbst ihre Gesundheit ein und ihre Überlebensfähigkeit. Daher besteht eine der wichtigsten Aufgaben für das Management darin, die Kräfte der Organisation nicht zu überfordern.
Der schnelle Tod der untauglichen Varianten
Wir haben es bereits erwähnt: Was »die Natur« zum »erfolgreichsten Unternehmen aller Zeiten« macht, das sind nicht zuletzt die fortgesetzten Fehlschläge, die sie produziert. Selbstverständlich nicht vorsätzlich. Aber die Natur optimiert die eigene Produktpalette dank zweier Mechanismen: Variation und Selektion. Es wird alles Mögliche ausprobiert (bisweilen auch das Unmögliche) ‒ und dann wird aussortiert. Die meisten neuen Varianten sind nicht überlebensfähig. Doch manche eben schon. Vielleicht haben sie nur einen winzigen Vorteil gegenüber anderen Varianten. Doch der macht den Unterschied.
Dieses Verfahren können sich auch Unternehmen zunutze machen: Sie probieren viele kleine Prototypen und Varianten aus. Die können im »laufenden Betrieb« noch nachjustiert werden. Entscheidend ist aber: Die untauglichen Varianten werden ausgesondert. Dazu braucht es Probeläufe, Experimente und Kundenfeedback. Wie schnell eine Variante fallengelassen wird, das ist eine Ermessensfrage. Auch in der Natur gibt es Varianten, die erst mit zeitlicher Verzögerung ihre Qualitäten entfalten und allen anderen Lösungen überlegen sind. Und doch ist es meist von Vorteil, untaugliche Varianten einen »schnellen Tod« sterben zu lassen. Vor allem wenn eine taugliche Lösung zur Verfügung steht, mit der sich weiterarbeiten lässt.
Mindset im Management
Wie »lebendig« eine Organisation sein kann, das hängt ganz von den Menschen ab, die dort arbeiten. Besondere Verantwortung trägt dabei das Management ‒ auch und gerade weil die Mitarbeiter aufgewertet werden und mehr Autonomie bekommen sollen. Das heißt nämlich keineswegs, dass Führungskräfte an Bedeutung verlieren oder sich gar überflüssig machen. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Mit dem Management steht und fällt das ganze Projekt. Es wäre ein großes Missverständnis anzunehmen, die Führung sollte sich einfach zurückhalten und die anderen mal machen lassen. Tatsächlich müssen die Prozesse der Selbstorganisation ermöglicht und gemanagt werden. Auch wird der Bedarf an Entscheidungen keineswegs geringer, wenn viele Entscheidungen an die Mitarbeiter delegiert werden. Manager müssen vermitteln, zusammenführen und gelegentlich beherzt eingreifen, um ihre Aufgabe in einem »lebenden System« zu erfüllen.
Auch darf ein Aspekt nicht unterschlagen werden: Führungskräfte sind Vorbild. Durchaus nicht immer ein positives. Aber das Verhalten der Mitglieder einer Organisation wird wesentlich davon bestimmt, was die Führung »vorlebt«. Was wird belohnt? Was wird stillschweigend geduldet? Welche Regeln gelten und welche werden unterlaufen? Und von wem?
Dreh- und Angelpunkt ist demnach das Handeln der Führungskräfte, aber auch ihre innere Einstellung, ihre Haltung, ihr Selbstverständnis, das ihr Handeln bestimmt. Sagen wir es offen: Was sich in einer »lebenden Organisation« vor allem ändern muss, das ist das Mindset im Management.
Machtbewusste Alphatiere sind hier ebenso fehl am Platz wie die charismatischen Führungsfiguren, die ihre Gefolgschaft mitreißen. Tatsächlich wird das traditionelle Verständnis von Führung in gewisser Hinsicht auf den Kopf gestellt. Es geht gerade nicht um Gefolgschaft, um Dominanz und Hochstatus. Es geht darum, die Mitarbeiter zu unterstützen, ihnen zuzuhören, ihre besonderen Fähigkeiten und Talente zu fördern und im Sinne der Organisation zusammenzuführen. Ein großes Ego, Statusdenken, überbordender Narzissmus sind bei dieser Aufgabe eher hinderlich. Zugewandtheit, Offenheit und Menschenfreundlichkeit sind willkommen. Näheres zu diesem Thema lesen Sie im zweiten Teil unseres Buchs, im Kapitel über den »Hausgarten«. Doch erst einmal müssen wir uns die »biologische Unterseite« der Organisationen und ihrer Mitglieder ansehen, um auf dieser Grundlage zu realistischen Schlussfolgerungen zu kommen. Denn ein kühner Zukunftsentwurf von Organisationen ist wenig wert, wenn er auf reinem Wunschdenken beruht.
Wir superkooperativen eigennützigen Primaten
Was bei der Managementbionik nicht unter den Tisch fallen darf: Wir Menschen sind keineswegs die vernunftbestimmten, konstruktiven Problemlöser, als die wir in der Managementliteratur gerne betrachtet werden. Vielmehr sind wir geprägt von unserem biologischen Erbe. Immer wieder reagieren wir unvernünftig, widersprüchlich, unbeherrscht, folgen unserem Bauchgefühl, verstoßen vermeintlich gegen unsere eigenen Interessen und lassen uns von persönlichen Abneigungen leiten.
Wir sind der »dritte Schimpanse«, wie uns der Evolutionsbiologe Jared Diamond genannt hat. Vom Naturell her irgendwo angesiedelt zwischen dem freundlichen Zwergschimpansen Bonobo und dem robusteren »Gemeinen Schimpansen«. Während der Bonobo bekannt ist für sein überbordendes und doch entspanntes Sexualleben, das ihm den Ruf eingetragen hat, eine Art »Hippie des Regenwalds« zu sein, hat das Image der »Gemeinen Schimpansen« stark gelitten. Seit bekannt geworden ist, dass die Männchen üble Machos sind und ihre Horden regelrecht Krieg miteinander führen. Man könnte sagen: Die Bonobos stehen für »Love« (oder wenigstens für genussvollen Sex), die Gemeinen Schimpansen für »War« (oder wenigstens für Töten im Team) ‒ während der »dritte Schimpanse« zwischen beiden Möglichkeiten hin- und herschwankt.
Es gibt keine Spezies, die so kooperativ ist wie wir Menschen. Zugleich keine, die so sehr zur Grausamkeit neigt. Die Brutalität und Raffinesse, mit der wir zu Werke gehen, die Fähigkeit zu betrügen und zu täuschen, die pure Lust an der Demütigung und Zerstörung unserer Artgenossen, damit besetzen wir im Königreich der Tiere ohne Zweifel den Thron. Und doch sind wir auch einzigartig in unserer Fähigkeit, mit anderen mitzufühlen, vielfältigste Beziehungen einzugehen und zu kooperieren. Auch andere soziale Tiere kennen so etwas wie Mitgefühl, doch wir übertreffen sie bei Weitem. Wir machen uns Sorgen, wenn wir vom Schicksal anderer erfahren, die wir gar nicht kennen. Die tausende von Kilometern von uns entfernt leben und Hunger leiden. Wir lassen uns zu Tränen rühren von Geschichten, von denen wir wissen, dass sie gar nicht stattgefunden haben, sondern erfunden sind. Nicht selten von jemandem, der schon hundert oder tausend Jahre tot ist oder aus einem anderen Kulturkreis stammt.
Wir Menschen sind einzigartig. Aber diese Besonderheit gründet sich auf unsere Entwicklung, die wir mit vielen anderen Lebewesen teilen. Manches davon mag uns nicht gefallen. Aber wir müssen damit zurechtkommen. Und so wollen wir uns unsere »biologische Ausstattung« etwas näher anschauen.
Unser mächtiges Affenhirn
Vielleicht kennen Sie das: Sie haben alle Argumente auf Ihrer Seite, doch seltsamerweise gelingt es Ihnen nicht, Ihr Gegenüber zu überzeugen. Manchmal ist es sogar noch merkwürdiger: Ihr Gegenüber gibt Ihnen recht und entscheidet sich dann doch anders. Anderer Fall: Sie leisten vortreffliche Arbeit, Sie stellen fest, dass Sie allen anderen in Ihrer Abteilung weit überlegen sind. Zugleich registrieren Sie, dass genau dieser Umstand dazu beiträgt, dass Sie mehr und mehr ins Abseits geraten. Sie müssen taktieren, Ihre Qualitäten verbergen, sich mit dem Mittelmaß arrangieren. Sonst bekommen Sie kein Bein mehr auf den Boden. Drittes Beispiel: In einer Diskussion äußern Sie Sätze, über deren Schärfe Sie selbst überrascht sind. Inhaltlich sind Sie gar nicht so weit von Ihrem Gegenüber entfernt, aber Sie tun alles, um ihn schlecht aussehen zu lassen. Gar nicht mal absichtlich. Es geschieht einfach.
Solche Vorkommnisse fallen in die Zuständigkeit unseres »Affenhirns«. Der Begriff geht zurück auf den Hirnforscher Paul MacLean, der in den 1960er Jahren das Konzept des »dreieinigen Gehirns« entwickelt hat. Demnach wird unser Denken von drei verschiedenen Systemen bestimmt. In popularisierter Form sind das: das »Reptilienhirn«, das »Affenhirn« und das »Menschenhirn«. Während das Reptilienhirn die Basisversorgung sicherstellt, wird das Menschenhirn gebraucht, um zu planen, langfristige Folgen zu bedenken und neue Ideen zu entwerfen. Dazwischen: das Affenhirn.
Nun muss man sagen, dass MacLeans ursprüngliches Konzept längst widerlegt ist (so gibt es keine Abfolge von drei getrennten Hirnstadien). Doch als Ordnungsmodell wird es auch von ernstzunehmenden Wissenschaftlern gewürdigt wie dem Hirnforscher Jaap Panksepp oder dem Neurobiologen Robert Sapolsky. Und in der Tat ist es gerade das »Affenhirn«, mit dem sich Führungskräfte beschäftigen sollten. Warum? Weil es so mächtig ist. Gibt es Konflikte zwischen »Affenhirn« und »Menschenhirn«, so setzt sich das Affenhirn durch. Immer. Sie können alle rationalen Argumente auf Ihrer Seite haben, wenn Sie das »Affenhirn« nicht überzeugen, werden Sie gar nichts ausrichten.
Unser »Affenhirn« wird bestimmt durch Gefühle, durch das Streben nach Stabilität und den dringenden Wunsch, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Menschen sind soziale Wesen, die Beziehungen zu anderen sind von enormer Bedeutung. Das gilt sogar für Einzelgänger, die sich in einer Randposition eingerichtet haben. Auch dort erfüllen sie eine wichtige Funktion und können sich Anerkennung erwerben. Tatsächlich sind einige Exzentriker zu bewunderten Führungspersonen geworden. Ob Steve Jobs, Bill Gates oder Elon Musk. Allerdings sind Führungskräfte nur dann erfolgreich, wenn sie ihr »Affenhirn« beherrschen und mit den Affenhirnen der anderen zurechtkommen.
Das Streben nach Stabilität
Es gehört zu den großen Mythen, dass Organisationen besonders attraktiv und leistungsfähig sind, wenn sie sich ständig im Aufbruch befinden, durchlässig und flexibel sind und bloß nicht zur Ruhe kommen. Nun gibt es tatsächlich eine natürliche Neugier, eine Lust auf Neues (der wir uns gleich zuwenden), doch mit der permanenten Verunsicherung und dem allgemeinen Aufscheuchen aller Beteiligten hat das gerade nichts zu tun. Die untergräbt eher Neugier und Kreativität (mehr dazu im Kapitel über den »Senkgarten«).
Es ist eine Grundtatsache, dass uns Unsicherheit belastet. Das gilt besonders für unser soziales Leben: Menschen kommen viel besser damit zurecht, wenn sie in der Hierarchie einen unteren Rang einnehmen, als wenn sie unsicher sind, wo sie stehen. Damit ist keineswegs die offizielle Hierarchie gemeint, die sich in Titeln und Organigrammen ausdrückt. Vielmehr haben Menschen ein feines Gespür für die tatsächliche Hierarchie. Wenn die aber unklar und ständig in Bewegung ist, belastet sie das und mindert ihre Fähigkeit zusammenzuarbeiten. Wohlverstanden: Solche Bewegungen sind immer wieder mal notwendig; sie halten die Organisation flexibel und geschmeidig. Nur dürfen sie nicht zum Dauerzustand werden. Und sie haben immer einen Preis.
Allgemein gilt: Unser »Affenhirn« bevorzugt das Vertraute. Die Methode, die wir schon kennen, die Partner, mit denen wir schon zusammengearbeitet haben. Auch wenn da manches nicht gut gelaufen ist, jetzt wissen wir Bescheid und können uns darauf einstellen. Was oftmals bedeutet: Alles läuft so ab wie beim letzten Mal. Das beste Argument für etwas Neues lautet daher: Im Grunde ist es so ähnlich wie das, was ihr schon kennt. Es ist das Vertraute in neuer Gestalt. In seiner ursprünglichen Bedeutung steht das Wort »Revolution« auch keineswegs für »durchgreifende Veränderung«. Das lateinische »Revolutio« bedeutet vielmehr »Zurückdrehen« und bezeichnete zunächst einmal die Umlaufbahn der Planeten, die ständige Rückkehr auf eine Position, auf der sie sich schon einmal befunden haben.
Unsere Lust auf Neues
Gleichzeitig gibt es aber auch die Lust auf etwas Neues: Dinge auszuprobieren und Unbekanntes zu entdecken. Tatsächlich richtet sich unsere Aufmerksamkeit zuverlässig auf alles, was neu und überraschend ist. Das möchten wir ergründen, verstehen, einordnen. Und das gelingt uns am besten, indem wir uns einen möglichst stabilen Rahmen geben. Es ist kein Zufall, dass besonders schöpferische Menschen Routinen und Rituale brauchen. Das Sichere, das Vertraute, das Verlässliche. Manche arbeiten auch gerne mit immer denselben Menschen zusammen. Nur dann fühlen sie sich in der Lage, Neues zu schaffen. Zumal wenn das Neue auf dem aufbaut, was man zuvor entwickelt hat.
Außerdem sollte man nicht vergessen: Die Lust auf Neues ist individuell sehr verschieden ausgeprägt. Manche mögen es eher kleinteilig, andere arbeiten lieber am großen Wurf. Manche neigen zur Vorsicht, andere reizt das Risiko. Vergnügen stellt sich vor allem dann ein, wenn man sich auf seine Art dem Neuen nähern kann. Dann entfaltet es ganz von alleine seinen Reiz ‒ und nicht wenn es als Bedrohung empfunden wird.
Wir und die anderen
Eine der wichtigsten Unterscheidungen, die unser »Affenhirn« macht, betrifft die Frage: Gehört jemand zu uns oder zu den anderen? Gehört die Person zu uns, betrachten wir sie mit Sympathie, wir sind bereit, ihr zu vertrauen und sie zu unterstützen. Zugleich erwarten wir, dass sie sich an »unsere Regeln« hält. Jede Gruppe hat ihre eigenen Normen, Regeln und Erkennungszeichen, mit denen sie sich von anderen abgrenzt. Wer sich darüber hinwegsetzt, muss mit Schwierigkeiten rechnen.
Dabei gehören wir nicht nur einer Gruppe an, sondern vielen. Und die können ganz willkürlich zustande kommen. Dennoch sind wir auch dann loyale Gruppenmitglieder, bevorzugen »unsere Leute« und setzen uns dafür ein, dass »wir« Erfolg haben. »Wir« nicht als Summe aller Gruppenmitglieder, sondern als eigene Größe mit eigenen Zielen und Interessen. Eben das ist das Faszinierende: »Wir« bilden eine neue kollektive Identität ‒ und die kann durchaus Ziele verfolgen, die mit unseren Eigeninteressen kollidieren. In solchen Fällen neigt unser »Affenhirn« dazu, der Gruppe den Vorzug zu geben. Vor allem wenn sich die Gruppe Angriffen von außen gegenübersieht, ist es fast unmöglich, die anderen »im Stich zu lassen« ‒ sogar wenn wir uns massiv selbst schädigen. Diese Dynamik können wir nur dann aufhalten, wenn wir unseren »Menschenverstand« einschalten und nüchtern analysieren.
Das »Wir« wird nicht nur dadurch zusammengehalten, dass die Mitglieder irgendwelche Gemeinsamkeiten teilen. Sondern mehr noch durch den Umstand, dass es »die anderen« gibt, die nicht »zu uns« gehören. Stehen diese »anderen« auch noch in einem Konkurrenzverhältnis zu »uns«, dann festigt das den Zusammenhalt beträchtlich. Tatsächlich kann man bei seinen Mitstreitern Punkte sammeln, wenn man »die anderen« herabwürdigt und ihnen Schaden zufügt. Von außen ist dagegen kaum anzukommen. »Wir« fühlen uns immer stärker und immer besser, weil wir »die anderen« so schwach und so schlecht aussehen lassen.
Und genau dieser Mechanismus kann für jede Organisation zum Verhängnis werden. Denn ihre Geschlossenheit mag sie schlagkräftiger machen und das Engagement ihrer Mitglieder verstärken. Doch gibt es zwei gravierende Nachteile: So eine verschworene Gemeinschaft hat nur eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung. Die Welt wird radikal vereinfacht, im schlimmsten Fall auf Freund und Feind reduziert. Zweitens entfesselt dieses Freund- und Feinddenken destruktive Kräfte und blockiert das Erfolgsprinzip der menschlichen Zivilisation: Die Kooperation mit Fremden.
Die Biologie der Belohnung
Es gibt viele Dinge, die wir als beglückend empfinden und natürlich gibt es individuelle Unterschiede. Doch sehr weit vorne rangiert die Anerkennung durch andere, vorzugsweise durch diejenigen, die wir selbst besonders hochschätzen. Zum Beispiel weil sie Macht und Einfluss haben oder moralische Autorität besitzen. Das wertet uns auf und wir fühlen uns gut.
Auch materielle Dinge haben ihre Wirkung. Vor allem Geld gilt als zuverlässiger Gradmesser der Wertschätzung: Je mehr wir bekommen, desto mehr sind wir der Organisation wert, für die wir arbeiten. Allerdings haben Belohnungen so ihre Tücken, vor allem Belohnungen finanzieller Art: Sie nutzen sich recht schnell ab. Das lässt sich sogar hirnphysiologisch messen: Wird Ihre Prämie verdoppelt, schüttet ihr Gehirn auch doppelt so viel Dopamin aus, das Glückshormon. Allerdings steigt nun auch die Erwartung. Und jedesmal, wenn die nun doppelt so hohe Prämie ausgezahlt wird, nimmt die Dosis an Dopamin ab, bis wieder genauso viel ausgeschüttet wird wie vor der Verdoppelung. Und bekommen Sie nun den alten Betrag ausgezahlt, fühlen Sie sich regelrecht bestraft. Allerdings findet auch dann wieder eine Angleichung statt. Nach einigen Zahlungen haben Sie sich mit dem ursprünglichen Betrag wieder arrangiert.
Etwas überraschend ist allerdings der Zeitpunkt, zu dem das Dopamin ausgeschüttet wird. Nämlich nicht so sehr, wenn Sie die Belohnung erhalten, sondern wenn sie in Aussicht gestellt wird. Man gibt Ihnen zu verstehen: Leisten Sie dieses und jenes, bekommen Sie die Belohnung. Genau dann schießt der Dopaminspiegel in die Höhe. Erledigen Sie Ihre Aufgabe und bekommen Sie dann die Belohnung, gibt es noch einmal eine kleine Ausschüttung, aber das wahre Glück liegt in der Erwartung der Belohnung.
Und vergessen Sie nicht: Der Grad der Beglückung flacht von Bonuszahlung zu Bonuszahlung ab. Lässt sich das verhindern? Allerdings. Fügen Sie ein Element der Unsicherheit ein. Gibt es nicht automatisch, sondern nur in der Hälfte aller Fälle eine Belohnung, geht der Dopaminspiegel durch die Decke ‒ und zwar nicht, wenn Sie die Belohnung bekommen, sondern wenn die Sache angekündigt wird. Das Problem ist dann halt nur, dass die Enttäuschung erst mal groß ist, wenn die Belohnung ausbleibt. Doch solange die Aussichten gut sind, dass es beim nächsten Mal klappt, wirkt diese Art der Belohnung wesentlich stärker. Wohlverstanden: Es geht hier um eine zusätzliche Prämie und nicht um angemessene Bezahlung. Wenn die ausbleibt, fühlen Sie sich missachtet.
Die Konkurrenz schläft nicht
Es sind die beiden widerstreitenden Prinzipien, die unserer Natur geradezu eingebrannt sind: Wettbewerb und Kooperation. Dabei ist beides eng miteinander verwoben. Konkurrenzfähig sind wir nur, wenn wir auch kooperieren. Und wer kooperiert, muss sich immer auch gegen Konkurrenz behaupten. Doch das ist noch nicht alles: Auch innerhalb einer Kooperation stehen wir von Zeit zu Zeit im Wettbewerb mit unseren Verbündeten (zum Beispiel, wenn es unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, was als nächstes getan werden soll). Und unsere Konkurrenten sind in gewisser Hinsicht unsere Partner. Denn sie sind es, die uns dazu zwingen, unsere Fähigkeiten immer weiter zu verbessern. So gesehen kann einem gar nichts Schlimmeres passieren, als dass man seine Konkurrenten tatsächlich »ausschaltet«.
Und doch hat das Konkurrenzprinzip seine besonderen Gefahren. Nicht immer setzt sich die beste Lösung durch, die beste im Sinne aller Beteiligten. Vielmehr kommen andere Qualitäten ins Spiel: Taktisches Geschick, Imagepflege, Einschüchterung, Tarnen und Täuschen, Anschwärzen der Wettbewerber, Erpressung oder auch der Einsatz von Gewalt. Der menschlichen Erfindungskraft ist auch auf diesem Gebiet keine Grenze gesetzt. Vor allem in Bereichen, in denen es um sehr viel geht, Geld und Macht, sind Menschen in der Wahl ihrer Mittel nicht gerade zurückhaltend.
Daher braucht jeder Wettbewerb Regeln und eine halbwegs neutrale Instanz, die darauf achtet, dass sich niemand darüber hinwegsetzt ‒ und die Strafen verhängen kann. Genau solche Instanzen gibt es seit dem Beginn der menschlichen Zivilisation. Sie arbeiten vielleicht nicht immer ganz perfekt und sind ihrerseits Ziel mehr oder weniger verdeckter Einflussversuche. Doch sind diese Instanzen unverzichtbar.
Superkooperative Egoisten
Wettbewerb ist nur die eine Seite unserer Natur, Kooperation die andere. Und die hebt uns in jeder Hinsicht auf eine neue Stufe. Keine andere Spezies kooperiert so ausgiebig und so vielfältig wie wir Menschen. Vor allem sind wir in der Lage, im Prinzip mit jedem zu kooperieren, auch und gerade mit Fremden. In seinem wegweisenden Buch »The Company of Strangers« erklärt der britische Ökonom Paul Seabright diese Fähigkeit zum entscheidenden Faktor in der menschlichen Entwicklung. Soziale Tiere kooperieren vornehmlich mit ihren Verwandten. Je enger die Verwandtschaft desto stärker die Unterstützung. Auch beim Menschen gibt es solche Tendenzen. Doch seit vielen Jahrtausenden schließen sich auch Personen zusammen, die nicht zur selben Familie gehören. Es gibt eine grundsätzliche Bereitschaft, einander zu helfen. Das zeigen auch Studien, die das Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig durchgeführt hat. Kleinkindern und Menschenaffen wurden Aufgaben gestellt, die beide Gruppen verstehen und lösen konnten (Sie vermuten richtig, es ging hauptsächlich darum, an irgendwelche Leckereien heranzukommen). Was Sie aber vielleicht nicht gedacht hätten: Die Affen waren häufig besser. »Sie haben verstecktes Futter schneller gefunden, kleine Summen besser addiert und Werkzeuge öfter benutzt«, berichten die Forscher. Also sogar im Rechnen waren die Affen besser. Und im Gebrauch von Werkzeugen!
Aber es gab einen Aufgabentypus, da waren die Kinder den Affen haushoch überlegen: Immer wenn es darum ging, Hinweise von anderen aufzunehmen. So was begreifen Kinder ohne Mühe, geradezu automatisch. Warum? Weil sie im Grundsatz kooperativ denken. Sie setzen voraus, dass die andern sie unterstützen und ihnen die Hinweise geben, die ihnen helfen. Es kommt noch etwas hinzu: Wir Menschen sind Meister im genauen Kopieren. Das Nachäffen beherrschen wir wesentlich besser als jeder Schimpanse. Und wir tun es ständig. Wir machen etwas nach.
Das hat einschneidende Konsequenzen: Erfolgreiche Praktiken breiten sich schneller aus. Der besondere Clou dabei ist: Wir müssen die Sache noch nicht einmal verstehen. Wie der Anthropologe Robert Boyd gezeigt hat, ist es keineswegs ihre überragende Intelligenz gewesen, die den Menschen einen so großen Vorsprung vor ihren haarigen Vettern verschafft hat. Es ist vielmehr ihre Fähigkeit, miteinander zu kooperieren und einander zu kopieren. Allerdings, so führt Robert Boyd aus, imitieren wir nicht wahllos. Vielmehr sind es diejenigen, die wir für vertrauenswürdig halten, denen wir nacheifern. Wen aber halten wir für vertrauenswürdig? Diejenigen, die über besondere Fähigkeiten verfügen und die es gut mit uns meinen. Von Anfang an geht es darum, zwei Personengruppen zu meiden: Die Aufschneider, die ihre Kompetenz nur vortäuschen, und die Trickser, die versuchen uns reinzulegen. Für Führungskräfte heißt das: Sie werden vor allem dann viel bewirken können, wenn Sie drei Eigenschaften zeigen: Kompetenz, Wohlwollen und Glaubwürdigkeit. Das heißt: Auch in einem ungünstigen Umfeld können Sie dafür sorgen, dass Menschen Ihrem Beispiel folgen: Wenn Sie ein gutes Vorbild abgeben.
Der erste Teil: Von Bienen und Leitwölfen
In diesem ersten Teil folgen wir vor allem dem »pragmatischen Ansatz«, den wir im Eingangskapitel vorgestellt haben. Das heißt, bestimmte Phänomene aus der Tier- und Pflanzenwelt werden auf Managementthemen übertragen. Dies geschieht aus drei Gründen:
Die Vorgänge in der Natur sind so ähnlich.
Sie beschreiben eine erfolgreiche Lösung, eine Adaption, die funktioniert.
Die Beispiele aus der Natur sind anschaulich. Sie machen Abstraktes verständlich und wirken inspirierend.
Das bedeutet, die Beispiele aus der Natur sind Metaphern und nicht wörtlich gemeint. Sie erfassen immer nur bestimmte Teilaspekte, nämlich die, um die es gerade geht. Metaphern sind keine Erklärungen, sondern Übertragungen aus einem anderen Bereich. Sie gehören zu unseren wichtigsten Denkwerkzeugen. Sie bestimmen unser Denken und sind auch dort wirksam, wo wir sie gar nicht vermuten. Zum Beispiel wenn wir über Geld sprechen. Zahlungsmittel sind eine recht abstrakte Größe. Uns fehlen oft buchstäblich die Worte, um »direkt« über Geld zu sprechen. Also greifen wir zu Metaphern. Doch ist Ihnen überhaupt bewusst, welche Metapher wir da völlig unbekümmert einsetzen? Es ist das Wasser. Das unterscheidet sich nun in vielerlei Hinsicht von einem Zahlungsmittel. Doch Geld »fließt« auf unser Konto, »Geldströme« werden irgendwo »hingeleitet«, jemand dreht uns den »Geldhahn« zu, sodass wir nicht mehr »flüssig« sind. Ja, das Geld, das uns zur Verfügung steht, nennt man auch unsere »flüssigen Mittel«, fachsprachlich unsere »Liquidität«, was dasselbe bedeutet.
Oder wenn Sie an Ihre berufliche »Laufbahn« denken, ein »Weg«, der »gepflastert« ist mit Metaphern. Mit dem »Auf- und Abstieg auf der Karriereleiter«, den unvermeidlichen »Karrierehindernissen«, die man Ihnen in den »Weg stellt«, und den »Senkrechtstartern«, die später über eine unschöne Angelegenheit »stolpern«. Manche »kleben« an ihren »Sesseln«, andere »sägen« an Ihrem »Stuhl«. Und wenn Sie »ganz oben angekommen« sind, stellen Sie vielleicht fest, dass die »Luft sehr dünn geworden« ist.
Neue Metaphern aus der Natur
Nun sind uns diese Metaphern sehr vertraut. Wenn wir sie benutzen, bewegt sich unser Denken in gewohnten Geleisen. Worum es in diesem Buch geht, das ist jedoch gerade das Gegenteil. Es geht um neue und bessere Metaphern für das Management. Metaphern, die uns anregen, die unser Denken auf neue Wege führen. Metaphern, die uns helfen, komplexe Angelegenheiten anschaulich und damit verständlich zu machen. Selbstverständlich sind Wölfe nicht »die besseren Chefs«. Sie sind überhaupt keine »Führungskräfte« im eigentlichen Sinn. Doch aus ihrem Verhalten können wir manches ableiten, was uns weiterhilft, Mitarbeiter in schwierigen Situationen zu führen. Ähnlich wie in der klassischen Bionik: Dort muss ein Haifisch auch nichts mit Autos zu tun haben, um den Designern brauchbare Anregungen für die Gestaltung der Karosserie zu geben. Das gilt nicht nur für die einzelnen Tiere, das gilt auch für manche Konzepte, die wir aus der Natur ableiten, wie die »Schwarmintelligenz«: Natürlich gibt es gewaltige Unterschiede zwischen einem Ameisenhaufen und einem Unternehmen ‒ auch wenn es uns manchmal schwerfällt, das zu glauben.
Und doch sind die Beispiele in diesem Buch nicht willkürlich gewählt. Sie entstammen der Natur und haben eine bestimmte Zielrichtung. Zunächst ganz grundsätzlich: Es markiert einen Unterschied im Denken, ob wir unsere Metaphern für das Management der Welt der Werkzeuge entnehmen oder der Welt der Natur. Die Werkzeug-Metaphern sind noch heute die vorherrschenden. Sie sind nicht mehr zeitgemäß. Sie erzeugen die Illusion, dass sich Menschen steuern, ja »bearbeiten« lassen, wenn man nur die richtigen »Tools« einsetzt.