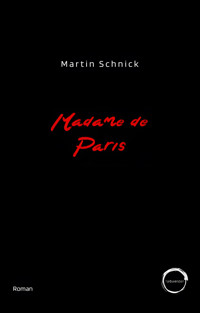
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Turbulenzen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
'Madame de Paris' entführt die Lesenden in die düstere Welt des Henkers von Paris ein. Henri-Clément Sanson, der letzte Spross der berüchtigten Scharfrichterdynastie, gewährt dem jungen Journalisten Georges Dumas Einblick in seine Familiengeschichte. Über Generationen hinweg stellten die Sansons den gefürchteten "Monsieur de Paris". Von der Hinrichtung Marie Antoinettes bis zu den Köpfen der Revolutionäre – ihre Guillotine prägte die Geschichte Frankreichs. Georges Dumas, ein unehelicher Sohn des berühmten Schriftstellers, kommt dabei den dunklen Geheimnissen des alten Sanson auf die Spur: Ist der Henker homosexuell und spielsüchtig? Hat er einst die Guillotine verpfändet, um seine Schulden zu begleichen? Und was hat seine Abberufung mit dem Skandal um den Justizminister zu tun? Doch auch der junge Dumas kämpft mit seinen Dämonen: Er sucht die Anerkennung seines Vaters, verliebt sich heimlich in die Verlobte seines besten Freundes und ist bereit, diese Freundschaft für seine politischen Ideale zu verraten. In diesem fesselnden historischen Roman verschmelzen die dunklen Kapitel der französischen Geschichte mit den intimen Bekenntnissen zweier Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. „Madame de Paris“ erstellt ein tiefgründiges Psychogramm eines blutrünstigen Gewerbes und zeichnet zugleich ein Pariser Sittengemälde zur Zeit des Second Empire.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Kapitel 1: Küssen Sie mich!
Kapitel 2: Magarita
Kapitel 3: Die Erfindung der Guillotine
Kapitel 4: Freiheit oder Tod
Kapitel 5: Marie Antoinette
Kapitel 6: Der Ring
Kapitel 7: Das Maison bleue
Kapitel 8: Bella Figura
Kapitel 9: Der Ursprung der Welt
Kapitel 10: Überraschung
Kapitel 11: Madame de Paris und das kleine Schweinchen
Kapitel 12: „An eine, die vorüberging“
Kapitel 13: Die letzte Hinrichtung
Kapitel 14: Geheimnisse
Kapitel 15: Endlich vorbei
Kapitel 16: „Monsieur … Papa?“
Nachwort: Die Geschichte hinter der Geschichte
Kapitel 1: Küssen Sie mich!
„Küssen Sie mich!“
Henri Sanson zuckte zusammen. Überrascht schaute der unerfahrene Henker in die dunklen Augen des jungen Delinquenten, ein hochgewachsener, ehemaliger Soldat der königlichen Garde, und wie er selbst noch keine zwanzig Jahre alt. Das eiserne Fallbeil der Guillotine blitzte bedrohlich in der tief stehenden Wintersonne. Aus den Schornsteinen der umliegenden Häuser stieg Rauch auf. Unzählige Schaulustige drängten sich auf den Balkonen, um das Spektakel auf dem Rathausplatz zu verfolgen. Wenige Schritte vom jungen Scharfrichter entfernt kniete ein betender Priester mit gesenktem Haupt auf dem Schafott. Anschließend wanderte sein Blick über die Menschenmenge auf dem Place de l’Hôtel de Ville und über die Soldaten der Garde, die das Podest bewachten. Sodann sah Henri Sanson wieder auf den verurteilten jungen Mann, der mit halb nacktem Oberkörper und auf dem Rücken gefesselten Händen stolz und aufrecht auf dem Schafott stand. Der ehemalige Gardist schaute Henri Sanson weiterhin entschlossen an und sprach erneut mit klarer, fester Stimme: „Ich möchte nicht von dieser Welt gehen, ohne mit jedermann versöhnt zu sein. Selbst mit meinem Henker. Daher bitte ich Sie, Monsieur de Paris: Küssen Sie mich!“
Regungslos verharrte Henri Sanson auf der anderen Seite des Holzgerüstes. Innerlich brodelte es in ihm. Wohin sollte er ihn küssen? Auf die Stirn? Oder auf den weißen Hals, den am Morgen noch braune Locken bedeckten? Locken, die er ihm ebenso wie den Hemdkragen bei der Toilette abgeschnitten hatte, damit das Fallbeil freie Fahrt hat. Oder gar auf den Mund? Sollte er ihn etwa auf die wohlgeformten Lippen küssen, hier vor aller Augen? Henri Sanson überkam ein Schwindel. Unmöglich, dachte er, unmöglich könne er, wenn er diesen hübschen jungen Mann geküsst, anschließend diese tödliche Maschinerie in Gang setzen. Niemals. Er senkte den Blick, ein Trommelwirbel setzte ein. Und plötzlich ging alles ganz schnell. Ohne sein Zeichen abzuwarten, schnallten die Gehilfen den jungen Gardisten mit geübten Griffen auf das Fallbrett und kippten es in die Waagerechte. Noch in derselben Sekunde schloss sich der eiserne Ring um den Hals des Verurteilten. Ein letzter Blick in den Korb, in den gleich sein abgetrennter Kopf fallen würde. Sanson schloss die Augen und vernahm nur mehr das dumpfe Geräusch des Fallbeils, das blitzschnell herabstürzte. Als er die Augen wieder öffnete, hielt ein Gehilfe bereits den Kopf des Delinquenten am Schopf und präsentierte ihn der mordgierigen Meute. Andere Gehilfen legten derweil den kopflosen Rumpf in den bereitstehenden Bastkorb und wischten mit Schwämmen das Blut vom Boden auf. Sanson war kurz davor, ohnmächtig zu werden. Taumelnd stieg er vom Podest und bahnte sich einen Weg durch die Menge, die ihn wortlos passieren ließ. Dann beschleunigte er seine Schritte. Er wurde immer schneller und schneller. Stundenlang rannte er durch die Stadt, sich immer wieder umblickend. Wurde er verfolgt? Keuchend hastete er die Rue Saint-Honoré entlang, hinaus nach Neuilly. Hier, am nebligen Ufer der Seine, brach er weinend zusammen. Schlagartig wurde ihm bewusst, dass er heute eine Grenze überschritten hatte, hinter der es kein Zurück mehr gab.
***
Der sechzig Jahre alte Sanson hält einen Augenblick lang gedankenverloren inne. Dann stemmt er sich schwerfällig aus seinem Sessel und holt eine Flasche Cognac aus der Kommode. Die langen Vorhänge wehen in der leichten Brise und milde Sonnenstrahlen fallen durch die halb offenen Fenster. An der hellgrünen Tapete über dem Kamin hängen die Porträts seiner Vorfahren. Sein Großvater Charles-Henri, stolz im Jagdgewand, mit dem Gewehr in der Hand und seinem treuen Hund zu Füßen. Außerdem Charles-Jean-Baptiste Sanson, sein Urgroßvater im roten Wams des Henkers, sowie ein Ölgemälde seines Vaters im Sessel sitzend, während seine Mutter hinter ihm steht und ihm liebevoll die Hand auf die Schulter legt.
„Möchten Sie auch einen Cognac, junger Mann?“, fragt Sanson.
Georges Dumas hebt den Blick von seinen Notizen.
„Sehr gerne, Monsieur!“
Seine Wangen glühen.
„Das war also Ihre allererste Hinrichtung.“
„Der 17. Februar des Jahres 1819. Die Exekution des Pierre Foulard. Der Tag, an dem ich meine Unschuld verlor, wenn Sie so wollen.“
Sanson schenkt Cognac ein und reicht Dumas das Glas.
„Auf Ihre Gesundheit!“
„Auf die Ihre, Monsieur!“, erwidert der junge Journalist.
Sanson nimmt wieder Platz und blickt traurig ins Leere.
„Noch heute, mehr als vierzig Jahre später, träume ich von dieser Hinrichtung. Ein Albtraum, der mich nicht mehr loslassen will. Von Zeit zu Zeit kehrt er nachts zurück und fährt mir in die Glieder, bis mich das dumpfe Geräusch des Fallbeils aus dem Schlaf katapultiert.“
Georges Dumas stellt das Glas beiseite und greift mit seinen feingliedrigen Fingern wieder nach Stift und Papier.
„Aber der Traum ist noch nicht zu Ende“, fährt der Alte fort, „wieder eingeschlafen träume ich, wie ich den abgeschlagenen Kopf des jungen Gardisten am Haarschopf gepackt in meinen Händen halte und er mich fragend ansieht ...“
Er nippt an seinem Cognac und überlegt.
„Wissen Sie, es ist wirklich seltsam, aber für einen Moment scheint das Leben noch im abgetrennten Kopf zu weilen. Ungläubig schauen sie einen an, nicht begreifend, welche Gewalt ihrem Körper soeben widerfahren ist. Und manchmal versuchen sie auch noch zu sprechen, ihre Lippen bewegen sich. Aber natürlich können sie nicht mehr sprechen, sie haben ja keine Luft mehr. Man kann nur mehr rätseln, was sie einem sagen möchten.“
Sanson hält wieder inne. Georges Dumas wischt sich eine krause Locke aus der verschwitzten Stirn.
„Es ist in der Tat sehr, sehr merkwürdig, dass die enthaupteten Köpfe noch sprechen wollen. Aber sagen Sie, wessen war der junge Foulard überhaupt angeklagt?“
„Weshalb er abgeurteilt wurde, wollen Sie wissen? Wegen Mordes.“
„Ach?“
„Er hatte eine alte Dame erwürgt und ausgeraubt. Wegen einer lächerlichen Uhr und zweier Ohrringe warf er sein Leben weg.“
Dumas schaut erstaunt.
„Ein blutjunger Mann begeht wegen einer Uhr ein derart brutales Verbrechen?“
„Kaum zu glauben, in der Tat. Schon damals vor Gericht hatten sich alle gewundert, wie in einem solch wohlgeformten Körper eine solch verkommene Seele innewohnen konnte. Aber er hatte alles gestanden, sich vor Gericht selbst bemitleidet. Er stamme aus ärmlichen Verhältnissen, habe nie eine Erziehung genossen, geschweige denn finanzielle Zuwendungen seitens seiner Eltern erhalten. Und der karge Sold bei der Garde reiche kaum aus für ein auskömmliches Leben in Paris.“
„Und dann wurde er verurteilt und Sie wurden mit der Hinrichtung beauftragt?“
Sanson greift nach seiner Pfeife und stopft sie mit Tabak.
„Nicht direkt. Meine Mutter wollte mich so lange als möglich vor meinem unausweichlichen Schicksal bewahren. Sie verabscheute unseren Beruf, das, was wir seit Generationen über taten, tun mussten. Außerdem war sie sehr gläubig und besuchte jeden Sonntag die Messe. So kam es, dass ich mit siebzehn Jahren erstmals an einer Hinrichtung teilnahm, als stummer Zuschauer am Fuße des Schafotts, ohne jede Aufgabe. Das folgende Jahr 1818 war ein sehr glückliches Jahr für meine Mutter, denn es war ein Jahr ohne eine einzige Hinrichtung. Überdies hatte man mich verheiratet. Mit Virginie, der Tochter eines Scharfrichters aus Rennes. Ein hübsches Kind, nur ein Jahr älter als ich.“
Er zündet sich die Pfeife an und bläst den Qualm gegen die Stuckdecke.
„Doch schon Anfang Februar des nächsten Jahres fand die kurze Idylle ein jähes Ende. Der Justizminister beauftragte meinen Vater mit der Vollstreckung der Todesstrafe an eben jenem Pierre Foulard. Doch eine Krankheit hatte meinen Vater wochenlang ans Bett gefesselt. Er schien dem Tode näher als dem Leben. Es war ihm unmöglich, das Urteil selbst zu vollstrecken. Und so lag es an mir. Mein Vater instruierte mich und versprach, seine besten Gehilfen zu verpflichten. Er versuchte, mir die Angst zu nehmen und mich zu beruhigen, denn eigentlich müsse ich gar nichts tun, da alle Arbeiten von den Gehilfen erledigt würden. Meine Anwesenheit sei nur ... und das sagte er wörtlich ... meine Anwesenheit sei nur eine reine Formalität.“
„Eine reine Formalität?“, fragt Georges Dumas und muss schlucken.
„Und wenn man es genau betrachtet, so hatte mein Vater ja recht.“
Plötzlich klopft es an der Tür, die sich kurz darauf einen Spalt weit öffnet.
„Henri, das Diner ist fertig“, ertönt eine sanfte Stimme.
„Gut Jean, ich komme gleich.“
Sanson legt seine Pfeife in den Aschenbecher, erhebt sich aus dem Sessel und stellt den Cognac zurück in die Kommode. Dumas sammelt unterdessen hastig seine Notizen zusammen.
„Ich habe Sie über Gebühr in Anspruch genommen, Monsieur Sanson, entschuldigen Sie.“
„Im Gegenteil, Monsieur Dumas, es war mir eine wahrhaftige Freude ... Aber der Traum, von dem ich Ihnen erzählte, wollen Sie nicht noch hören, wie er endet?“
Georges Dumas hält überrascht inne.
„Aber gerne doch.“
Sanson, mit beiden Händen auf der Kommode gestützt, schließt die Augen.
„Normalerweise kann man sie nicht sprechen hören, die abgeschlagenen Köpfe, aber der Kopf des jungen Gardisten, den ich im Traum in meinen Händen halte, er spricht tatsächlich zu mir.“
„Und ...?
Dumas steht wie gebannt vor dem Tisch.
„Und was sagt er?“
Sanson schließt die Kommode, wendet sich seinem Gast zu und blickt ihn leicht lächelnd mit seinen sanften Augen an.
„Raten Sie einmal.“
Kapitel 2: Magarita
Gegen sieben Uhr abends verlässt Georges Dumas die verwinkelten Gassen des Marais-Viertels und gelangt auf den breiten Boulevard Sébastopol. Wie selbstverständlich taucht der kleine junge Mann mit der Kraushaarfrisur in den pulsierenden Rhythmus der Stadt ein. Droschken, schwere Fuhrwerke und Pferde-Omnibusse rollen polternd über das Kopfsteinpflaster. Auf dem Trottoir eilen Laufburschen, Tagelöhner und Herrschaften in Frack und Zylinder gleichgültig aneinander vorbei, ohne einander wahrzunehmen. An den Wänden der Häuser kleben unzählige Reklamen; Nähmaschinen, Dampfschiffreisen, exotische Seifen und einbruchsichere Panzer-schränke versprechen das Glück der Moderne. Vom Cognac beschwingt, flaniert Georges Dumas den Boulevard hinunter zur Seine, über die Pont Neuf ins Quartier Latin, wo er ein Mansardenzimmer angemietet hat. Als er den Place de l’Odéon überquert, hört er plötzlich jemanden seinen Namen rufen. Im Gedränge eines Straßencafés erblickt er seinen Freund Philippe, der ihm freudig zuwinkt. Vor nicht allzu langer Zeit waren sie beide noch Studenten an der ehrwürdigen Sorbonne. Philippe ist von kräftiger Statur und gut einen Kopf größer als er.
„Salut Georges, komm her, setz dich zu uns, es gibt etwas zu feiern!“, begrüßt ihn Philippe. Seine braunen Haare hat er zu einem Zopf gebunden und sein Hemd ist halb geöffnet. Neben ihm sitzt Isabelle, die wie Georges aus dem gleichen Vorort stammt und die er von Jugend an kennt. Die zierliche junge Frau arbeitet als Blumenverkäuferin in den Markthallen und hat sich wie immer nach Feierabend eine Blumenblüte ins lange, blonde Haar gesteckt. Georges umarmt und begrüßt sie mit Küssen auf die linke und rechte Wange.
„Salut Isabelle, du siehst bezaubernd aus!“
„Salut Georges, danke für das Kompliment, wie schön dich zu sehen!“, freut sich Isabelle.
Philippe wendet sich indes dem Kellner zu.
„Garçon, bring uns noch eine Karaffe von dem Weißwein!“
„Sag Philippe, was gibt’s für Neuigkeiten!“, fragt Georges, während er sich zu ihnen an den Tisch setzt. Stolz lehnt sich der Freund zurück.
„Ich habe eine Zusage erhalten. Meine Bewerbung bei der Polizeipräfektur wurde angenommen, schon nächsten Montag kann ich anfangen.“
„Das freut mich für dich, ich gratuliere“, erwidert Georges, während Philippe ihm ein gefülltes Glas Weißwein zuschiebt.
„Jetzt geht mein Held auf Verbrecherjagd“, scherzt Isabelle, die vom Wein schon leicht angeheitert ist.
„Verbrecher jagen und nachts durch die Straßen patrouillieren? Davon kann keine Rede sein“, entgegnet Philippe. „Ich habe mich doch nicht um einen Posten als Sergent, sondern um eine Anstellung in der Verwaltung beworben. Wenn alles glatt läuft, bin ich in zehn Jahren Polizeipräfekt.“
„Puh!“, seufzt Isabelle erleichtert und schmiegt sich an ihn. „Dann muss ich mir nachts ja keine Sorgen um dich machen.“
Sie nippt am Glas und wendet sich an Georges.
„Aber erzähl Georges, woher kommst du? Warst du wieder unterwegs für einen Artikel für deine Zeitung?“
„Nein, nein, ich war, wie soll ich sagen, ihr werdet es kaum glauben ...“
„Na los, erzähl schon!“, ermuntert ihn Philippe.
„… um es kurz zu machen, ich war beim alten Sanson.“
„Was? Du warst beim ehemaligen Monsieur de Paris?“
Philippe schaut ungläubig.
„Wer bitte schön ist der alte Sanson?“, wendet sich Isabelle ahnungslos an ihren Geliebten.
„Du hast noch nie etwas von den Sansons gehört?“, fragt Philippe verblüfft. „Der alte Sanson war einst der Henker von Paris, und sein Großvater Henri-Charles Sanson hatte zu seiner Zeit Louis XVI. und Marie Antoinette enthauptet.“
„Oh mein Gott, wie schauerlich!“
Mit großen Augen schaut Isabelle ihn entsetzt an.
„Georges, was um alles in der Welt wolltest du denn bei einem solchen Menschen?“
Georges Dumas greift nach seinem Glas und lehnt sich zurück.
„Die Wahrheit ist: Ich verspüre keine große Lust, als Journalist nur Artikel zu verfassen, über die Einweihung eines neuen Bahnhofs, über plüschige Operettenaufführungen oder die selbstherrlichen Bauprojekte von Napoleon III. Ich habe beschlossen, Dichter zu werden und einen Roman zu schreiben.“
Philippe verschränkt mit einem selbst gefälligen Lächeln die Arme.
„Du möchtest einen Roman schreiben? Ausgerechnet über den Henker von Paris? Da hast du dir aber ein schönes Sujet für dein Debüt ausgesucht.“
„Was gibt‘s denn da zu lachen?“, erwidert Georges beleidigt, „das ist doch ein interessanter Stoff.“
„Mag sein“, gibt Philippe lakonisch zur Antwort. Dann wendet er sich Isabelle zu.





























