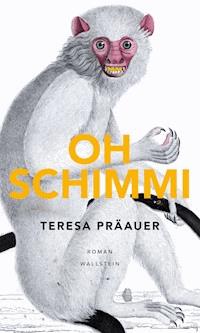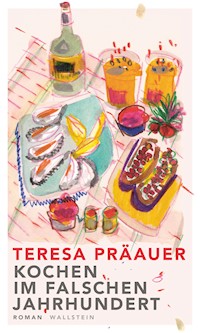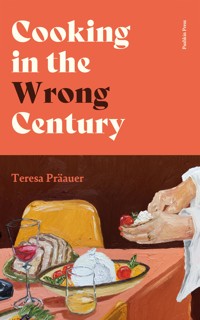Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein literarisch-verspielter Text über Zugehörigkeit und Abgrenzung, über die Schwierigkeiten und Heiterkeiten des Heranwachsens. Teresa Präauer widmet sich in diesem Buch einer Figur, die in ihren Büchern bisher beinah ausgespart geblieben ist: dem Mädchen. In persönlichen Erinnerungsstücken und literarischen Betrachtungen erzählt sie über Kindheit und Konkurrenz, Mädchenbanden und Bubenspiele. Über Zugehörigkeit und Abgrenzung und über die Schwierigkeiten und das Glück des Heranwachsens. »Mädchen« steckt voller Beobachtungen, Zärtlichkeit und Heiterkeit und ist ein intimes Geschenk der sprachmächtigen Autorin an ihre Leserinnen und Leser.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 79
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Teresa Präauer
Mädchen
WALLSTEIN
Inhalt
Umschlag
Titel
Mädchen
Impressum
Wir beginnen mit einem neunjährigen Kind, einem Jungen, ausgerechnet hier und jetzt. Ich habe ihn nicht in die Welt gesetzt, er wurde vom Universum geschickt. Er trägt einen dunkelblauen Pyjama mit hellen Sternen und Kometen darauf, die er auf seiner Reise zur Erde eingesammelt und mitgenommen hat.
Der kleine oder auch mittelgroße Junge sitzt morgens auf seinem Teppich und hat schon ein beinah symmetrisches Schlachtfeld aufgebaut.
Die Schlossruine, sagt er, ist von Harry Potter. Die Figuren sind von Ninjago. Die anderen sind die Rebellen.
Und das braune Monster?, frage ich ihn.
Das ist ein Rancor von Star Wars, und dem steckt er jetzt einen der Rebellen ins Maul. Schau, sagt er, er kann die ganze Figur fressen.
Ich nehme eine der größeren Playmobilfiguren in die Hand und beuge mich zum Teppich hinunter. Dort stelle ich sie aufs Schlachtfeld, sie sieht im Vergleich zu den anderen aus wie ein Riese. Im Plastikbehälter daneben finde ich einen Gummiball mit bunten Alufäden daran und nehme ihn in die Hand.
Dir gefallen auch noch meine alten Spielsachen, sagt der Junge, dem seine alten Spielsachen nämlich schon geläufig und langweilig geworden sind.
Ich sehe diesen Jungen nicht täglich, manchmal auch für Wochen nicht. Aber wenn wir miteinander sprechen, bin meistens ich diejenige, die zuhört. Sein Tag besteht, laut meiner Beobachtung, aus Schule und Pausenbrot, Fernsehen und Schneeburgenbauen, einem Referat über Komodowarane und einem Popsong des Duos Younotus. Würde ich mich nun hier auf seinen Teppich legen, wären meine Augen auf gleicher Höhe mit der Flagge von Harry Potters Schlossruine. Sie weht im Wind des Kinderzimmers.
Ich könnte mir alles ganz genau ansehen, die Dinge um mich herum, während der Junge spielt und schießt. Irgendwann schliefe ich vielleicht ein, und die vielen Figuren, von denen der Junge einige hundert Stück besitzt, würden sich an mir, diesem Berg aus schwarzem Textil und blondem Haar, zu schaffen machen. Sie bänden mich mit einem Seil fest, wie es die kleinen Menschen mit Gulliver gemacht haben auf seiner Reise um die Welt.
Ich muss tatsächlich eingeschlafen sein, denn als ich aufwache, hat ein Pirat aus Plastik seine Leiter an mein Bein gelehnt, ist hinaufgeklettert und genießt nun von der Kniescheibe aus die Aussicht.
He!, rufe ich.
Der Pirat justiert sein Fernrohr und antwortet nicht.
Ein Seil ist um meine Füße gewunden und mit einem Knoten verschnürt. Ich ziehe daran und versuche mich zu bewegen. Es wäre ein Leichtes, mich zu befreien, aber ich bleibe liegen. Es ist nicht unbequem auf einem Teppichboden. Die letzten Wochen und Monate vergingen ohnehin wie im Flug. Wieso nicht den Piraten und seine kleinen Freunde eine Zeitlang gewähren lassen?
Mit geschlossenen Augen liege ich im Kinderzimmer des kleinen Jungen und erinnere mich daran, wie das Leben als Mädchen gewesen ist. Ich errichte in Gedanken ein Schlachtfeld, auf dem meine eigenen Figuren aus der Kindheit – der Affe Nilli und der Bär Ditschi, der Bazillenträger, Schere, Stein und Papier und der damals noch junge Vater mit dem römischen Streitwagen – sich formieren zu einem ähnlich disparaten Bild. Der Gummiball mit den bunten Alufäden springt durch diese Szene.
In der Schule sollten wir damals, daran erinnere ich mich jetzt, aus dem Möbelkatalog ein uns zugewiesenes Schnipsel weiterzeichnen. Ich hatte eine halbe Herdplatte bekommen und einen weiteren Teil der Küchenzeile. Ich setzte also mit einem Fliesenboden fort, ergänzte die Wandschränke, malte einen zum Wohnzimmer hin offenen Küchenbereich. Dort hinein setzte ich einen Vater mit zwei Töchtern, in die Küche stellte ich eine Mutter mit Schürze, auf ihren flachen Händen trägt sie ein Blech mit frischen Keksen aus dem Ofen. So hatte ich mir als Kind die Welt vorgestellt. Die Mutter, als sie das Bild gesehen hat, hat den Kopf geschüttelt darüber.
Ich höre die Stimme des kleinen Jungen, der wieder mit mir über seinen Flummi spricht, diesen fliegenden Gummiball, den er nämlich nur draußen im Garten benutzen dürfe, damit nicht eine weitere Lampe oder Fensterscheibe zu Bruch ginge.
Ich liege gefesselt auf dem Teppichboden und habe die Zeit und die Möglichkeit, also das Privileg, mich zu fragen, an welchem Ort ich hier gestrandet bin, wo nämlich Nutzen und Spiel so etwas wie eine magisch-ernste Schnittmenge bilden. Wo der Flummi, der in belanglosen Plaudereien als Synonym gebraucht wird für einen von seinen Gefühlen beduselten und besudelten Menschen, nicht durchs Haus, aber hoch und nieder, und wieder hoch durch den Garten springt, gegen die Hausmauer geworfen wird, im Swimmingpool landet, die rötlich-weiß-gescheckte Katze des Nachbarn aufschreckt und hinter die nächste Hecke jagt.
Dieser Garten ist eine Idylle, die nur einer stört mit seinem Ball, mitten ins Blumenbeet gepfeffert. Inmitten von Dahlien, Pfirsichen, Rosen. Rhododendrenbüschen, Ilexzweigen. Rosmarin, Salbei und Lavendel. Der kleine Junge wird mich auch weiterhin unterbrechen, während ich längst begonnen habe, mich an meine eigene Kindheit zu erinnern.
Wer über das Mädchen nachdenkt, denkt über Anfänge nach. Eine der ersten Freuden jedes Kindes gehört dem Benennen von Welt. Mit dem ausgestreckten Finger zeigt es auf alles, was es zu sehen gibt. Es dreht und dreht sich, um auch nichts zu übersehen und nichts auszulassen. Da!, ruft es, und stellt damit schon die Frage. Denn was da ist, hat einen Namen. Was keinen hat, bekommt einen: Mais, Baum, Auto, Krähe.
Und das Kind besitzt bereits etwas. Ich hatte damals eine braunhaarige Puppe Susi (Modell Schlummerle von Schildkröt), einen Affen und einen Teddybären. Susi schloss ihre Lider, wenn ich sie hinlegte, und sie öffnete sie sofort wieder, wenn ich sie aufrichtete. Ihr Körper war aus Stoff, mit Watte gefüllt, wohingegen ihr Kopf, ihre Beine und Arme aus Plastik waren. Da Susi sehr brav war, musste ich sie nur einmal schlagen.
Alle Namen, die von Stofftieren wie die von Menschen, endeten auf -i. Und auch heute, wenn ich den kleinen Kindern zuhöre, die gerade erst sprechen lernen: Da gibt es Mami und alle anderen, nämlich Babi. Es gibt das Wort Hallo, und es gibt das Wort Gabel. Gabel bedeutet Gabel als auch Kabel.
Ein Kind kann nicht aufhören, Hallo zu rufen. Wer Hallo ruft, bekommt ein Hallo zurück, fast immer. Hallo rufen und dabei winken: diese freundlichste Geste der Welt.
Ein Sprachwissenschaftler-Ehepaar, so hat es einmal eine Professorin an der Universität berichtet, habe, um zu erproben, ob und wie Sprachentwicklung mit sozialer Bindungsfähigkeit einhergehe, seinem Kind, als es sprechen lernte, den Namen der Mutter als Mama oder Mami vermittelt, den Namen des Vaters aber, erfundenermaßen, als Fiffi. Der Laut F, so die dem Experiment vorangegangene Annahme der Forschung, könne erst spät gebildet werden, M, B, A und I seien hingegen einfach zu formen und stünden daher am Anfang unseres kindlichen Sprechens.
Das Kind des Sprachwissenschaftler-Ehepaars nun rief nach seiner Mama, aber rief nicht nach seinem Fiffi. Es rief lange nicht nach ihm und baute auch erst spät eine Beziehung auf zu seinem Vater. Ob sich diese innerfamiliäre Feldforschung nun genau so zugetragen hat und ihre Ergebnisse heute noch dem wissenschaftlichen Standard gerecht werden? Ich muss öfter an diese Geschichte denken, weil sie spannend ist und auch ein wenig grausam, zugleich komisch, auch lächerlich. Das Sprachwissenschaftler-Ehepaar stelle ich mir als sehr ernsthaft bei der Sache vor, nichts als der Wissenschaft verpflichtet. Ich denke an den Vater, wie er Fiffi genannt worden ist. Und ich denke an das Kind, das, längst erwachsen, mit seiner Therapeutin nun über Mama und Fiffi spricht, Woche für Woche, aber nichts wird davon besser.
Ich habe nie geglaubt, dass Sprache nichts als ein Spiel wäre oder dass ihre Spiele nicht ernst wären, der Wirklichkeit nachgereiht. Wie könnte ich? Kleine Menschen, groß wie Playmobilfiguren, haben mich gefesselt!
Was sind Sprachwissenschaftler?, fragt mich der kleine Junge jetzt.
Das sind –, beginne ich.
Ach so, sagt der kleine Junge, ohne eine Erklärung abzuwarten, und bindet ein Lederband an seinen Gürtel. Dort befestigt er das selbstgebastelte Holster für seinen Spielzeugrevolver. Ich bin ein Cowboy, sagt er.
Ich sehe es. Ein Cowboy im Pyjama.
Der kleine Junge, der offensichtlich Spaß dabei hat, mich hier festzuhalten, obwohl er mich gleichzeitig auch loswerden will, hat zum Geburtstag ein Buch von einem Mädchen aus seiner Klasse geschenkt bekommen. Es liegt auf seinem Nachtkästchen als eines der ersten Bücher, die er in seinem Leben selbst lesen wird. Hundert Dinge, die ein Junge wissen muss ist der Titel dieses Buches. Sein Inhalt sind Tricks, Streiche und Fallen, aber auch Wissenswertes über Schluckauf und Morsecodes. Das Buch verkauft sich gut, habe ich im Internet gelesen. Ob Mädchen eigentlich keinen Schluckauf haben, steht dort nicht.
Wenn ich mich auf die Suche begebe, wie Erziehung und Bildung von Mädchen in unterschiedlichen Zeiten vonstatten gingen, finde ich diverse Handbücher aus der Zeit der Erfindung der Druckerpresse, betitelt zum Beispiel mit La institutione di una fanciulla nata nobilmente aus dem Jahr 1555 von einem Autor namens Giovanni Michele Bruto. Fanciulla ist das Mädchen in antiquiertem, poetisierend gebrauchtem Italienisch, ins Englische übersetzt als young gentlewoman.
Im Mittelalter unterschied man, laut der Historikerin Shulamith Shahar, drei Stufen der Kindheit, die infantia (bis zum Alter von sieben Jahren), die pueritia (bis zwölf) und die adolescentia (bis zum Erwachsenenalter) – zwischen Mädchen und Jungen wurde dabei in der Erziehung offenbar weniger differenziert. Später forderten die Humanisten Schulbildung für Knaben und Mädchen, bei Luther hießen sie ›Maidlein‹ – bis zum 16. Jahrhundert blieb den Mädchen der Unterricht an Schulen noch untersagt. Umfassende Bildung bekamen bis ins 20. Jahrhundert adelige oder Bürgersöhne, mit Ausnahme von einzelnen Kaufmannstöchtern in größeren Handelsstädten.