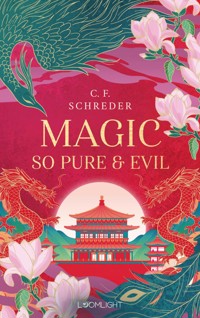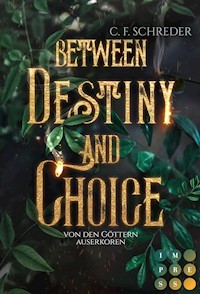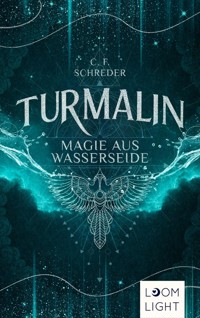4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Kari und ihre Freunde sind auf der Flucht vor dem skrupellosen Skarabäusclan. Deren unbarmherziger Anführer hat sich mit dem Syndikat der Brennenden Lilie verbündet und will die Macht über ganz Magnolia Bay an sich reißen. Um ihn zu stoppen, wagen sich Kari und ihre Begleiter auf gefährliches Terrain – und suchen Hilfe bei einem unerwarteten Feind, der nicht zögert, seine Krallen auszufahren. Gleichzeitig kämpft Kari mit ihren eigenen Gefühlen. Der Nebel hat ihr eine geliebte Person genommen, ohne die ihr Herz zerbrochen zurückbleibt ... oder etwa doch nicht?
//Dies ist der zweite Band der »Magnolia Bay«-Dilogie. Alle Romane der High Fantasy-Serie im Loomlight-Verlag:
- Magic so Pure and Evil
- Love so Bitter and Sweet//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Das Buch
Liebe ist stärker als jede Magie!
Kari und ihre Freunde sind auf der Flucht vor dem skrupellosen Skarabäusclan. Deren unbarmherziger Anführer hat sich mit dem Syndikat der Brennenden Lilie verbündet und will die Macht über ganz Magnolia Bay an sich reißen. Um ihn zu stoppen, wagen sich Kari und ihre Begleiter auf gefährliches Terrain – und suchen Hilfe bei einem unerwarteten Feind, der nicht zögert, seine Krallen auszufahren. Gleichzeitig kämpft Kari mit ihren eigenen Gefühlen. Der Nebel hat ihr eine geliebte Person genommen, ohne die ihr Herz zerbrochen zurückbleibt ... oder etwa doch nicht?
Episch, magisch, fesselnd – das große Finale der Magnolia Bay-Dilogie
Die Autorin
© Christoph Ascher
C. F. Schreder ist das Pseudonym von Christina Fuchs. Sie wurde 1992 in einem kleinen Tiroler Städtchen geboren, studierte Psychologie und Wirtschaftswissenschaften, lebte ein Jahr lang in Hongkong und arbeitete anschließend als Personalmanagerin in Österreich und in den USA. Vor allem während ihrer Reisen und Auslandsaufenthalte sammelte sie Inspirationen für ihre Geschichten. Heute lebt und schreibt sie in Salzburg.
Für mehr Informationen über C. F. Schreder und ihre Bücher folgt der Autorin auf:www.instagram.com/christina.schreibt/
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Loomlight auch!Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autor:innen und Übersetzer:innen, gestalten sie gemeinsam mit Illustrator:innen und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher und Autor:innen auf:www.thienemann.de
Loomlight auf Instagram:https://www.instagram.com/thienemann_booklove
Loomlight auf TikTok:https://www.tiktok.com/@thienemannverlage
Viel Spaß beim Lesen!
C. F. Schreder
Love so Bitter and Sweet
Loomlight
für Elias & Luisa
Prolog
Chichiko
30 Jahre zuvor
Am Morgen ihrer Hochzeit sangen die Sterne ein Lied über Göttinnen und Krieger, über ein Auge im Zentrum der Welt und über die Zukunft, die in ihren Händen lag. Eine Geschichte, älter als das Leben selbst, und begleitet von den schönsten Klängen eines Frühlingsmorgens.
Die Sterne hatten immer zu Chichiko gesungen, schon als sie ein kleines Kind war. Ihr Flüstern weckte sie am Morgen, wenn die Schwärze der Nacht in Dämmerung überging, und begleitete sie in jedem wachen Augenblick. Wenn Chichiko allein durch die Bambusgärten des Dorfs spazierte, erzählten die Sterne ihr Geschichten über die entlegensten Ecken der Welt, und in der Nacht säuselten sie sie ins Reich der Träume.
Auch heute, an ihrem Hochzeitstag, begleiteten die Sterne sie. Chichiko trug ein pompöses Kleid aus glänzend silbernem Stoff – die traditionelle Farbe für palay’sche Hochzeitskleider – und mit unzähligen Diamanten bestickt, die wie die Sterne am Nachthimmel funkelten. »Heute bin ich fast so schön wie ihr«, flüsterte sie zum Himmel hinauf und legte lächelnd den Kopf in den Nacken.
Seit der gut aussehende Fremde vor einem halben Jahr vor der Türschwelle ihrer Familie gestanden und überraschend um Chichikos Hand angehalten hatte, sprühten sie selbst und ihre Eltern vor Aufregung. Daishiro Nemea. Chichiko hatte seinen Namen unzählige Male ausgesprochen, hatte Buchstabe für Buchstabe auf der Zunge gekostet, und wusste, dass sie nie genug davon bekommen würde. Er war gepflegt und gut gekleidet, höflich und charmant. Er hatte einen Nachnamen. Er war wohlhabend und entstammte einer der ältesten Familien Palays. Er überschüttete Chichiko und ihre Familie mit Geschenken. Aber am allerwichtigsten: Er lächelte Chichiko auf eine Art an, die sie für den Moment glauben ließ, sie sei das schönste Mädchen der ganzen Welt.
Während sie die Treppen des zeremoniellen Tempels hinauf und bis zum Altar in dessen Zentrum schritt, war das Wispern der Sterne aufgeregter als gewöhnlich. Der Knoten in Chichikos Magen löste sich erst, als sie vor den Mann trat, der bald ihr Ehemann sein würde.
»Du musst nicht nervös sein«, flüsterte er leise, während der Hohemagier den Vermählungsgesang anstimmte. »Du bist der schönste Stern der Welt. Und ich bin der glücklichste Mann.«
Chichikos Herz schlug so schnell, als könnte es jeden Moment ihre Brust verlassen und davonrennen – und dann blieb es beinahe stehen, als der Hohemagier seinen Gesang beendete und Daishiro sich zu ihr beugte, um sie zu küssen. Nie zuvor hatte Chichiko einen Mann geküsst, und als ihre Lippen seine berührten, war es, als erglühte in ihrem Inneren ihr ganz eigener Stern.
Nach dem Ende der Zeremonie fuhren Daishiro und sie zu seiner Villa – ihrem neuen Zuhause –, wo sie in ihrem Ehegemach auf ihn warten würde. So sah die Tradition es vor. Zwei Dienerinnen halfen ihr, sich aus ihrem Kleid zu schälen, salbten ihren Körper mit duftenden Ölen ein und streiften ihr ein dünnes Seidenkleid über, ehe sie den Raum verließen.
Chichiko wusste, was sie nun erwartete. Ihre Mutter hatte sie darauf vorbereitet, auf, wie sie ihn nannte, den Akt zwischen zwei Eheleuten. Sie hatte Chichiko gewarnt, nicht zu weinen, auch wenn es wehtun sollte. Chichiko hoffte inständig, dass Daishiro sanft sein würde. Doch je länger sie auf ihn wartete, desto nervöser wurde sie.
Als die Tür zu ihrem Schlafgemach sich endlich öffnete, sprang Chichiko auf. Daishiro trat ein – und er war nicht allein. Zwei Männer in weißen Magierroben betraten hinter ihm den Raum und richteten ihre Augen auf Chichiko. Sie versteifte sich, als sie die Gier in den Blicken der Magier sah. Mit einem Mal schwoll das Flüstern der Sterne zu einem lauten Rauschen an.
»Hab keine Angst«, sagte Daishiro und hob beschwichtigend eine Hand. »Ich würde niemals zulassen, dass dir etwas geschieht.«
Chichiko wollte etwas antworten. Wollte fragen, was hier los war. Was die Magier in ihrem Zimmer zu bedeuten hatten. Warum die Sterne plötzlich so panisch durcheinanderflüsterten. Doch ihre Stimme war vor Schreck wie eingefroren.
»Ich werde dir alles geben, was du dir je wünschen könntest. Meine Zuneigung und Liebe, Juwelen und Gold, eine Familie … Sag es und es wird dein sein. Ich werde dir die Welt zu Füßen legen. Zuvor allerdings bitte ich dich, auch mir ein Geschenk zu unserer Hochzeit zu machen.«
»W-was?«, stotterte Chichiko.
Sie hatte doch bereits ihr Zuhause und ihre Familie für ihn zurückgelassen. Nun stand sie vor ihm, eingeölt und in Seide gehüllt, bereit, ihm ihren Körper, ihre Seele, ihr ganzes Leben zu geben. Erkannte er das denn nicht? War es nicht genug? Ihr angstvoller Blick zuckte zu den Magiern, dann zum knappen Saum ihres eigenen Kleids, und sie schlang die Arme um sich. Wollte er sie etwa mit diesen Männern teilen?
»Oh, nein. Nicht das!«, stieß Daishiro aus. Mit zwei langen Schritten stand er neben ihr und legte einen Arm um sie. »Dazu würde ich dich niemals zwingen. Du bist meine Ehefrau. Dein Körper gehört mir. Nur mir.« Er legte einen Finger unter ihr Kinn und zwang sie, ihn anzusehen. »Alles, worum ich dich bitte, ist ein kleiner Funke Magie. Reich den Magiern deine Hand und schließ die Augen. Ich verspreche dir, es wird nicht wehtun.« Er lächelte sanft. »Wenn du nicht möchtest, werde ich sie wegschicken.«
Würde er das? Chichiko wollte es glauben, so, so gerne glauben, doch ein Teil von ihr wusste, dass Daishiro Nemea ein Nein nicht als Antwort gelten ließ. Und warum sollte sie ihm diese Bitte auch ausschlagen? Ein Funke Magie erschien wie ein kleiner Preis, für die Welt, die er versprochen hatte, ihr zu Füßen zu legen.
Also nickte Chichiko. Sie sah gerade noch, wie die Magier ungewöhnlich alt aussehende Zepter hochhoben, an deren Enden glimmende Kristalle saßen, bevor sie die Augen schloss. Dann streckte sie ihre Hände aus, fühlte die Berührung der fremden Männer, einen unsichtbaren Sog, der an der Wärme in ihrem Herzen zerrte, dann das Knistern ihrer Magie, hörte das Flüstern der Sterne erst anschwellen und schließlich verblassen. Sie wusste nicht, wie viel Zeit verging oder was gerade mit ihr passierte. Doch als sie die Augen aufschlug, lag sie in ihrem Ehebett, noch immer vollständig bekleidet, und draußen ging die Sonne auf. Morgenröte legte sich über den Horizont wie an so vielen Tagen zuvor, wie sie es auch gestern getan hatte. Doch die Sterne flüsterten nicht.
Chichiko öffnete das Fenster. Nichts.
Sie legte den Kopf in den Nacken und starrte in den Himmel, bis ihre Augen tränten. Nichts.
Sie stimmte das Lied der Sterne an, in der Hoffnung, dass diese mitsingen würden. Sie rief nach ihnen, sie flehte die Sterne an, mit ihr zu sprechen. Nichts.
Die Sterne sangen nicht mehr. Weder an diesem Morgen noch an irgendeinem anderen in den kommenden Jahren.
Die Welt war immer voller Musik und Magie gewesen.
Nun war sie stumm.
»Wir sind nicht Daishiros Huren.«
Kari
Heißer Tigeratem schlug in Karis Gesicht.
Das Tier war so nah, dass sie das Zittern seiner Schnurrhaare ebenso wie das feuchte Glänzen seiner gefletschten Zähne sehen konnte. Sein Grollen prickelte über ihre Haut, bedrohlich, tödlich. Dieses Tier könnte sie mit nur einem Biss oder Prankenhieb außer Gefecht setzen. Trotzdem zwang sie sich, aufrecht stehen zu bleiben und keine Angst zu zeigen. Kari starrte in die Augen des weißen Tigers, die von einem unwirklichen Grün waren und in denen so etwas wie Belustigung lag. Dieser Blick war ganz und gar menschlich und er verriet, dass der Tiger vor Kari gar kein Tiger war, sondern ein Gestaltwandler.
»Genug«, ertönte die starke Stimme einer Frau.
Erneut grollte der Tiger, trat dann langsam zurück und schritt zu dem Thron, um den weitere Raubkatzen saßen. In die Augen des Tigers zu starren, musste ein Test gewesen sein. Kari hoffte inständig, ihn bestanden zu haben. Sofern es Isobelya Zalaro um ihren Mut oder ihre Tapferkeit ging, hatte sie das wohl. War es hingegen darum gegangen, Karis Intelligenz zu prüfen, eher nicht …
Sie befand sich im Katzenpalast, der den Hauptsitz des Klauenclans markierte. Der Palast war ein ehemaliges Badehaus, dessen Inneres mittlerweile mit unbezahlbaren Gemälden, Goldornamenten und edelsteinbesetzten Statuen gefüllt war und dessen Pforten von Tigern und Jaguaren bewacht wurden. Noch mehr Katzen-Gestaltwandler befanden sich im Sitzungssaal – ein Thronsaal, fand Kari –, in dem Isobelya Zalaro, die Anführerin der Raubkatzen und selbst eine Löwenwandlerin, ihre Audienzen abhielt. Von der Decke baumelten obszön riesige Kronleuchter und die Fenster bestanden aus einem bunten Glasmosaik, dessen Reflexionen dem Raum etwas Magisches verliehen, als befände man sich irgendwo zwischen Realität und Traum. Der riesige Raum war mit Teppichen und Kissen ausgelegt, auf denen zahlreiche Katzenwandler fläzten, und am Kopfende des Raums stand der Thronsessel, auf dem die Anführerin der Zalaros saß.
Isobelya war eine dunkelhäutige Frau in ihren Fünfzigern, deren lange schwarze Haare in Zöpfen bis zu ihrer Taille reichten. Sie trug ein traditionelles chrysanthisches Gewand, dessen leuchtend roter Stoff mit goldener Bestickung sie wie eine Göttin aus Feuer und Wut wirken ließen. Ihr Gesichtsausdruck war überraschend gelassen. Vermutlich, weil sie weder Kari noch Fayola als Gefahr ansah.
»Ich bin überrascht, Don Nemeas Huren in meinem Palast zu begrüßen«, sagte sie und lächelte Fayola und Kari kalt an. »Noch weiß ich nicht, ob ich mich geschmeichelt oder beleidigt fühlen soll.«
»Wir sind nicht seine Huren«, zischte Kari und ballte die Hände zu Fäusten.
Ihr lagen weit schärfere Erwiderungen auf der Zunge, doch sie musste sich zusammenreißen. Dies war ihre einzige Chance, die Zalaros als Verbündete zu gewinnen.
Seit ihrer Flucht aus der Nemea-Villa waren zwei Wochen vergangen, während derer Kari sich zusammen mit Fayola, Haruo und Izumi in den Zalaro-Vierteln verschanzt hatte. Allen war klar, dass das keine langfristige Lösung sein konnte. Nun, da der Don des Skarabäusclans sich mit der Brennenden Lilie zusammengeschlossen hatte, war er mächtiger denn je. Er würde seine gierigen Finger über die Peninsula hinaus nach Magnolia Island ausstrecken, würde versuchen, die gesamte Stadt unter seine Kontrolle zu bringen, und dann … das wusste Kari nicht. Daishiros Ambitionen kannten keine Grenzen. Vermutlich würde er erst aufhören, sobald die ganze Welt sich vor ihm verneigte.
Wenn sie ihn aufhalten wollten, brauchten sie Verbündete. Und wo, wenn nicht im Klauenclan, der Daishiro schon immer ein Dorn im Auge gewesen war, könnten sie diese finden?
»Nein, viel schlimmer als das«, gurrte Isobelya Zalaro nun. »Du bist seine Tochter, was dich noch verachtenswerter, aber auch wertvoller macht. Was würde dein Ziehvater sagen, wenn ich dich scheibchenweise vor seiner Tür ablege?« Sie lächelte auf beinahe liebevolle Art.
Kari hatte sich niemals Illusionen darüber gemacht, dass diese Audienz einfach werden würde, doch nun fragte sie sich, ob ihre Idee, mit Isobelya zu sprechen, von Anfang an zum Scheitern verurteilt war.
»Tochter ist ein interessantes Wort für das, was ich wirklich war. Sklave oder Besitz würden es ebenso treffen«, sagte sie nun. »Ihr wisst vermutlich, dass meine Familie mich an ihn verkauft hat. Genauso wie Ihr es mit Fayola getan habt.« Sie starrte Isobelya direkt in die Augen. Diese wich ihrem Blick nicht aus – natürlich nicht, man wurde nicht zur Anführerin eines der mächtigsten Clans, wenn man solch lästige Emotionen wie Reue oder Scham empfand.
Neben Kari versteifte Fayola sich vollkommen. Seit sie den Katzenpalast betreten hatten, hatte sie kaum ein Wort gesagt. Dabei hatte Kari gehofft, als ehemaliges Mitglied der Zalaros würde Fayola wissen, mit welchen Worten Isobelya sich überzeugen ließ. Offensichtlich hatte sie damit falschgelegen. Süßlicher Lycheeduft stieg in Karis Nase. Fayola hatte Angst.
»Aber all das tut nichts zur Sache. Wir sind hier, um Euch zu warnen«, sagte Kari nun.
Isobelya lachte laut auf. An ihre Katzen gewandt sagte sie: »Nemeas Huren glauben tatsächlich, sie könnten mir etwas sagen, was unsere Späher nicht schon längst berichtet haben. Ich würde lieber etwas hören, was ich noch nicht weiß. Sagt, ihr beiden, wie fühlt es sich an, vor Daishiro Nemea auf die Knie zu gehen? Ihm die Füße zu küssen – oder andere Körperteile –, sich vor ihm zu erniedrigen?«
»In Anbetracht dessen, wie nah Euer gesamter Clan seinem Ende ist, hätte ich gedacht, Ihr würdet uns wenigstens zuhören und Euch eine Meinung bilden, bevor Ihr uns beschimpft«, sagte Kari.
Die Jahre in Daishiros goldenem Käfig, gefüllt mit unzähligen Tests ihrer Loyalität, mochten schlimmer als jedes Gefängnis gewesen sein, doch immerhin hatten sie Kari gelehrt, ihren emotionalen Teil, der gerade nichts lieber wollte, als Isobelya die Augen auszukratzen, bis in den hintersten Winkel ihres Selbst zu schieben und ruhig zu bleiben.
Der Tiger, der Kari vorhin bedroht hatte, und zwei Jaguare erhoben sich und machten knurrend einen Schritt auf sie zu. Isobelya lachte jedoch auf.
»Bescheidenheit ist wohl keine der Tugenden, die euer Besitzer euch mitgegeben hat. Nun gut, erzähl deine Geschichte. Lasst uns sehen, meine Schwestern, ob sie uns unterhalten wird.«
Und Kari erzählte – während Fayola neben ihr stumm und vollkommen steif war. Sie begann mit Saika, der Magierin, die in Gestalt eines gesichtslosen Dämons in den Nemea-Vierteln Seelen geraubt hatte und die, wie sie später herausfand, im Auftrag des Dons selbst gehandelt hatte. Sie berichtete von der Brennenden Lilie, die in ganz Magnolia Bay und darüber hinaus Menschen verschwinden ließ, um deren Lebensessenz zu verkaufen, und davon, wie Daishiro den gesichtslosen Dämon dazu benutzt hatte, die Aufmerksamkeit ebendieser Organisation zu gewinnen und ein Bündnis mit ihr zu schließen. Sie schilderte den blutigen Kampf in der Walled City und schließlich ihre Flucht aus Daishiros Villa.
»Die Lilien und ihre Magier sind unglaublich mächtig, und in diesem Moment arbeiten sie mit Daishiro Nemea zusammen. Er will ganz Magnolia Bay unterwerfen, aber allen voran den Klauenclan. Isobelya, ich verspreche Euch, Daishiro und die Lilien werden zuallererst hier angreifen.«
Karis letzte Worte lösten einen Tumult unter den Katzen aus. Einige der Raubtiere hatten begonnen, unruhig auf und ab zu laufen, zwei Tiger steckten ihre Köpfe zusammen und unterhielten sich mit zischenden und knurrenden Lauten. Erst auf ein Brüllen des weißen Tigers hin hielten sie inne.
»Wenn es stimmt, was du sagst, was willst du dann von mir?«, fragte Isobelya.
»Wir müssen uns gegen Daishiro stellen, solange wir noch eine Chance haben«, antwortete Kari.
»Wir? Ihr wollt, dass wir an eurer Seite kämpfen?« Isobelya legte den Kopf schief. »Warum sollten wir das tun? Selbst wenn du die Wahrheit erzählst, was hätten wir davon, uns mit euch zusammenzuschließen? Wir sind viele, wir sind mächtig, ihr seid wenige und ihr seid schwach. Und wenn ich eure Geschichte richtig deute, dann seid ihr gerade das, was der Don am meisten möchte. Euch auszuliefern erscheint mir eine weitaus bessere Idee, als euch Schutz in meinen Vierteln zu bieten.«
Das konnte doch nicht ihr Ernst sein! Kari ballte die Hände zu Fäusten und bohrte ihre Fingernägel tief in die Haut. Der Schmerz lenkte sie genug ab, um Isobelya nicht anzuschreien.
»Ihr müsst euch nicht mit uns zusammenschließen«, sagte sie dann. »Solange Ihr bereit seid, Euch und Eure Leute zu verteidigen, wenn der Don angreift, war Fayolas und meine Mission erfolgreich.«
Sie warf Fayola einen Seitenblick zu, darauf hoffend, dass diese endlich ihre Stimme wiederfinden würde, doch sie blieb stumm.
»Eure Geschichte entbehrt nicht eines gewissen Ernstes«, stellte Isobelya fest, »und einer beachtlichen Fantasie. Woher weiß ich, dass Daishiro Nemea euch nicht geschickt hat? Oder dass ihr euch diese haarsträubende Erzählung nicht bloß ausgedacht habt, damit ich euch Schutz vor eurem Meister gewähre, vor dem ihr geflohen seid? Ihr habt euren Don betrogen, die Frage liegt also nahe, warum ihr nicht auch mich betrügen solltet?« Ihre Augen fixierten Fayola, als sie weitersprach: »Sag mir, warum sollte ich Daishiro Nemeas Huren glauben?«
Ein Beben ging durch Fayola. Sie atmete tief ein, wieder aus, wieder ein. Die Zeit wurde klebrig, Sekunden zogen sich wie Kleister in die Länge, während Kari darauf wartete, dass Fayola antwortete, und betete, dass sie die richtigen Worte finden würde. Das hier durfte nicht schiefgehen! Sie würden keine weitere Audienz und damit auch keine Chance bekommen, Isobelya und die Katzenkrieger zu überzeugen.
»Isobelya, Schwestern, ihr wisst, warum ich mich damals bereit erklärt habe, Daishiro zu heiraten«, begann Fayola. »Es war niemals mein Wunsch, den Klauenclan zu verlassen, und noch weniger, ihn zu verraten. Ich mag Daishiros Frau gewesen sein, aber ich bin noch immer eine Katze, und ich schwöre auf mein Leben und das aller Jaguare dieser Welt, dass wir die Wahrheit sprechen.«
Isobelyas Augen verengten sich. »Du wagst es, uns Schwestern zu nennen?«
»Alle Katzen sind Familie …«, begann Fayola. Ein feines Zittern lag in ihrer Stimme.
»Und doch hast du dich, seit du hier bist, weder nach deinen sogenannten Schwestern erkundigt noch nach deinem Bruder Kiano«, zischte Isobelya. Ihre Finger krallten sich in die Lehne ihres Throns. »Denkst du, wir wissen nicht, was du getan hast? Wie du dich von deinem geliebten Ehemann hast streicheln lassen wie ein Hauskätzchen? Wie du dich vor ihm gerekelt, sein Bett gewärmt, seine Drecksarbeit für ihn erledigt hast? Du bist eine Schande für alle Katzen, Fayola. Du verdienst es nicht, dich unsere Schwester zu nennen.«
Fayola zuckte zusammen, als hätte Isobelya ihr einen Schlag versetzt. »Wenn Ihr eine Ahnung hättet, was er mir angetan hat …«
Das durchdringende Brüllen des Tigers ließ sie stocken. Gleich zwei Leoparden erhoben sich und schlichen mit gefletschten Zähnen auf Kari und Fayola zu. Isobelya lehnte sich derweil seufzend in ihrem Thron zurück.
»Ich bin gelangweilt. Ich hatte mir bessere Unterhaltung von Daishiros Huren erwartet, aber sie sind außerordentlich fade.« Sie fuchtelte mit ihrer Hand, als wollte sie damit lästige Fliegen vertreiben, was wohl das Zeichen dafür war, dass Kari und Fayola zu gehen hatten.
Sollte es das wirklich gewesen sein? Kari hatte all ihre Hoffnung in die Anführerin der Katzen gelegt, nur damit diese sie nun hinauswarf, ohne überhaupt darüber nachgedacht zu haben, was Karis Worte für ihren eigenen Clan bedeuteten. Nein! So schnell würde sie nicht aufgeben. Sie durfte nicht! Das war sie sich selbst, ihren Freunden und all jenen, die ihr Leben bereits an Daishiro und die Lilien verloren hatten, schuldig.
»Ihr seid naiv, wenn Ihr nicht erkennt, wie ernst die Lage ist!«, rief sie. »Ihr müsst uns zuhören! Ihr müsst …«
»Schweig!«, donnerte Isobelya.
Einer der Leoparden brachte seine Schnauze so nah an Kari heran, dass seine Schnurrhaare ihre Wange streiften. Isobelya erhob sich von ihrem Thron. Rund um sie herum schoben sich die Raubkatzen auf ihre Beine.
»Du und deine Verräter-Freunde genießt seit Tagen die Gastfreundschaft des Klauenclans. Ich hätte euch sofort ausliefern oder meinen Kriegerinnen zum Fraß vorwerfen können. Bestimmt hätten sie den Geschmack eures Fleischs genossen. Stattdessen ließ ich euch in eurem Versteck in meinen Vierteln in Ruhe und habe euch heute sogar in meinen Palast eingeladen. Und wofür?«
Langsam schritt sie auf Kari und Fayola zu. Die Katzen wichen instinktiv zur Seite aus. Isobelyas Schritte waren so bestimmt, so kraftvoll, dass Kari meinte, sie müsste den Boden zum Vibrieren bringen. Doch das tat sie nicht. Sie glitt lautlos wie alle anderen Katzen.
»Ihr kommt hierher und erzählt uns ein Märchen. Ihr stellt Forderungen, ohne eine Gegenleistung anzubieten. Ihr beleidigt mich und meine Kriegerinnen in unseren eigenen Hallen. Ihr wagt es, eine Hure der Nemeas als unsere Schwester zu bezeichnen. Und nun wollt ihr mir vorschreiben, was ich, Isobelya Zalaro, Anführerin der Katzen, zu tun habe?«
Im Zentrum des Saals blieb sie stehen. Das Licht, das sich in den unzähligen Scheiben brach, zeichnete bunte Muster auf ihre Haut. Sie war eine Erscheinung, eine Kriegerin, eine Rachegöttin, und Kari begriff in diesem Moment, dass es nichts gab, das sie sagen oder tun konnte – ja, dass es nie etwas gegeben hätte –, das Isobelya überzeugen würde.
»Ich erweise euch ein letztes Zeichen meiner Gastfreundschaft. Dreht euch um und verlasst meinen Palast, so schnell euch eure Füße tragen. Und beeilt euch, ehe ich meine Geduld verliere und mich dazu entscheide, Daishiro Nemea seine Huren in Fetzen zum Geschenk zu machen.«
»Da ist jemand.«
Lycien
Der dünne Holzsteg knirschte unter Lyciens Füßen. Bis vor wenigen Wochen hätte er dieses Geräusch nicht wahrgenommen, doch mit seinen geschärften Drachensinnen hörte er alles. Das Gurgeln von Salzwasser rund um die Holzbalken, das ferne Platschen von Rudern im Wasser, das Gelächter der Fischer und die Musik aus dem Radio, die in angrenzenden Hütten tüdelte. Ein Geruch nach Fisch und Salz hing in der Luft, vermischte sich mit den Düften der Gewürze und den scharfen Chilidämpfen aus Woks und brachte Lyciens Magen zum Grummeln.
Zora und er hatten sich nach Sol-Wave aufgemacht, ein Fischerdorf am südlichen Rand Citrin Islands. Auf Magnolia Islands kleinerer Schwesterninsel konnte man allzu leicht vergessen, wie nah man den Hochhäusern im Zentrum war. Schon bei seiner Oma hatte Lycien sich stets gefühlt, als hätte er den Schatten der Metropole weit hinter sich gelassen, und auch Sol-Wave vermittelte den Eindruck, die Zeit wäre hier vor hundert Jahren stehen geblieben. Die Menschen lebten in kleinen Holzhütten, die auf Stelzen über dem sumpfigen Grund schwebten und mit wackligen Stegen verbunden waren. Im Süden grenzte Sol-Wave an das Meer. Von dort aus fuhren viele Fischer aus, die noch heute auf traditionelle Weise – mit selbst gebundenen Netzen oder mithilfe von Wassermagie – auf Fischfang gingen.
Es war der letzte Ort, an dem irgendjemand Lycien vermuten würde. Das hoffte er zumindest. Denn seit er sich vor zwei Wochen während des Anschlags auf die Walled City in einen Drachen verwandelt hatte, suchte die ganze Stadt nach ihm – oder besser gesagt nach dem Biest, das Magnolia Bay während des Sternenfests den Atem hatte anhalten lassen.
Vor einer Hütte, durch deren milchige Fenster er einen Blick auf einen Fernseher erhaschen konnte, blieb er stehen. Auch jetzt flackerte das Bild seines schlangenartigen Drachenkörpers, der über die höchsten Skyscraper glitt, über den Bildschirm. Lycien konnte selbst kaum glauben, dass das wirklich er sein sollte. Seit dem Sternenfest hatte er sich nicht mehr verwandelt. Das Risiko, entdeckt zu werden, war einfach zu hoch. Ganz abgesehen davon, dass er keine Ahnung hatte, wie genau er die Verwandlung das erste Mal angestellt hatte.
Durch die dünne Scheibe hörte er die Stimme des Nachrichtensprechers: »… Spuren verlaufen sich auf Citrin Island. Und so hält das Rätsel des letzten Drachen Magnolia Bays Bürger weiter in Atem.«
»Sie gehen immer noch davon aus, dass ich auf Citrin Island bin«, sagte er.
»Keine große Überraschung«, gab Zora zurück.
Denn die Sicherheitskräfte durchstreiften Citrin Island seit zwei Wochen, weswegen Lycien und Zora gezwungen waren, in ständiger Bewegung zu bleiben. Das Haus seiner Oma hatten sie schon am Morgen nach dem Sternenfest verlassen, immerhin war davon auszugehen, dass irgendjemand den Drachen gesehen hatte, der dort gelandet war. Seitdem wechselten sie nächtlich ihre Unterkunft, schliefen mal in heruntergekommenen Pensionen, mal in kleinen Zimmern, die Privatleute vermieteten.
Nun hob sie ihre Hand und zog Lycien die Kapuze tiefer ins Gesicht. »Umso wichtiger, dass niemand dich sieht.«
»Sie wissen ja nicht, dass sie mich suchen«, entgegnete er. Momentan deutete nichts darauf hin, dass irgendjemand herausgefunden hatte, wer der Drache war, über den die gesamte Stadt sich den Kopf zerbrach.
»Die offiziellen Truppen vielleicht nicht«, murmelte Zora.
Aber die Brennende Lilie und der Skarabäusclan womöglich schon. Sofort verkrampfte sich Lyciens Magen. Kurz nach ihrer Flucht hatte Zora ihm eröffnet, was es mit der Brennenden Lilie auf sich hatte, mit dem Seelenhandel, mit Talent Solutions. Er hatte gelernt, dass die Talentagentur, die seit einem Jahr zum Imperium seiner Eltern gehörte, in Wahrheit eine Sammelquelle für verlorene Seelen war. Was Zora ihm eröffnete, hatte sich verrückt angehört. Wie ein Traum. Ein Albtraum, um genau zu sein.
Was ist der Preis eines Lebens? Das waren die ersten Worte gewesen, die Zora an ihn gerichtet hatte. Damals hatte Lycien sie nicht verstanden, nun tat er es und wusste, dass er selbst unwissend Hunderte an die Brennende Lilie ausgeliefert hatte. Hunderte Träumer, die in Magnolia Bay nach einer zweiten Chance suchten und wegen ihm ihre Seelen verloren hatten.
Der Gedanke daran trieb ihm die Galle hoch. Was er getan hatte, wieder und wieder und wieder, all die leeren Versprechungen, all die Verkaufssprüche, all die falschen Hoffnungen … Bei den Göttinnen, wenn er dafür nicht in den tiefsten Schlünden des Totenreichs brennen würde, dann gab es in dieser Welt keine Gerechtigkeit.
»Komm schon, wir müssen weiter«, flüsterte Zora.
Zwei viel zu kurze Sekunden lagen ihre Finger auf seiner Wange, und sofort pulsierte ein Prickeln über seine Haut. In Zoras Augen las Lycien dieselbe Sehnsucht, die auch er empfand. Von Anfang an hatten ihre Berührungen etwas tief in ihm geweckt, als ob seine Magie die ihre instinktiv erkennen und darauf reagieren würde. Er vermisste Zoras Küsse, das Zusammenspiel ihrer Magie und seines Feuers, die Nähe, die sich bis kurz vor dem Sternenfest zwischen ihnen aufgebaut hatte. Und wenn er den Funken in ihren Augen richtig deutete, so ging es Zora ähnlich. Trotzdem zog sie die Finger so schnell zurück, als hätte sie sich an ihm verbrannt.
Nicht wegen des Silbers, das einen Großteil seines Körpers und auch seine Wangen bedeckte und das die meisten Leute beängstigend, wenn nicht sogar abstoßend finden würden, das wusste Lycien. Nein, das Silber hatte Zora nie gestört. Es waren die winzigen Buchstaben, die sich über seinen Körper zogen, die Zora auf Abstand hielten. Die Erinnerung an ihren Bruder Nael, die sie auf seine Haut gebannt hatte. Sie hatte es nie laut ausgesprochen, und doch war klar, dass sich etwas zwischen ihnen verändert hatte. Wenn Zora ihn ansah, sah sie nicht länger Lycien, sondern ein Mahnmal an das verlorene Leben ihres Bruders. Sie sah die Schuld, die sie glaubte, auf sich geladen zu haben. Weil sie ihren Bruder nicht gerettet hatte. Weil sie ihn überhaupt erst dazu getrieben hatte, sich auf einen Seelenhandel einzulassen.
Nicht, dass sie sich an irgendetwas davon wirklich erinnern könnte. Aber Lyciens Haut erzählte die Geschichte.
An manchen Tagen fragte er sich, ob es besser gewesen wäre, wenn Zora es nicht rechtzeitig geschafft hätte, Naels Erinnerung auf ihn zu bannen. Denn die Worte, die sich über seine linke Körperhälfte zogen, bargen zwar Wissen darüber, wer ihr Bruder gewesen war, aber keine echte Erinnerung. Vor allem enthielten sie die Gewissheit darüber, dass Zora einen geliebten Menschen für immer verloren hatte, und Lycien kam nicht umhin, sich zu fragen, ob die Bewahrung von Naels Lebensgeschichte Zoras Schmerz wirklich wert war. Wäre es nicht für alle leichter, wenn sie gar keine Ahnung hätten, dass es ihn jemals gegeben hatte?
Seufzend wandte Lycien sich von dem Fenster ab, hinter dem der Bildschirm nun das Gesicht von YI-Shen Cai zeigte, der zum wohl hundertsten Mal in den letzten zwei Wochen versichern musste, dass auch er nicht wusste, woher der Drache gekommen war und dass es sich dabei um keine Verschwörung der Regierung Magnolia Bays handelte. Dann folgte Lycien Zora tiefer zwischen die engen Fischerhäuschen.
Seine Haut kribbelte und spannte unangenehm. Bis vor zwei Wochen hatte er die Silfurvenen zwar sehen, aber nicht wirklich spüren können – etwas, von dem er nun wusste, dass er es seiner Großmutter zu verdanken hatte, die die Krankheit mithilfe eines Heilsteins auf sich gezogen hatte. Doch seit ihrem Tod fühlte er das Silber wie einen flüssigen Fremdkörper, der ihn nicht vergessen ließ, wie nah der Tod ihm war. Zora hatte er davon nichts erzählt. Sie hatte auch so genug Sorgen.
Plötzlich nahm Lycien ein Knarzen hinter sich wahr, gefolgt vom Huschen eines Schattens. Sofort fuhr er herum, konnte jedoch keinen Verfolger erkennen.
»Alles in Ordnung?«, wollte Zora wissen.
»Da ist jemand.«
»Natürlich ist da jemand. Wir sind in einem Dorf, in dem man das Meer vor lauter Fischern nicht sieht.«
Lycien schnaubte zur Antwort und starrte weiter in die Dunkelheit. Zora wusste ganz genau, dass er das nicht gemeint hatte.
»Sicher, dass du es dir nicht bloß eingebildet hast?«, fragte sie skeptisch.
Lycien hatte ihr zwar von seinen geschärften Sinnen erzählt, ganz ernst zu nehmen schien sie ihn allerdings nicht. Einen Augenblick lang fragte er sich selbst, ob er bloß paranoid war. Gut möglich. Da machte er den Hauch einer Bewegung in der Dunkelheit aus und schoss darauf zu. Es platschte.
»Warte!«, rief Lycien, doch wer auch immer ihm und Zora nachgestellt hatte, war verschwunden.
Neben dem Steg, auf dem er seinen Verfolger vermutet hatte, warf das Wasser Wellen. Lycien ging auf die Knie und streckte seine Hand aus, deren Finger die aufgewühlte Oberfläche streiften. Das Wasser war an dieser Stelle nur knöcheltief. Kein Mensch könnte sich darin verstecken oder geräuschlos fortbewegen, und trotzdem war da keine Spur einer Person. Nichts, bis auf die feinen Wellen, die sich rund um seine Fingerspitzen kringelten, und das Stück Stoff, das auf der Oberfläche trieb und sich bei näherer Betrachtung als Leinenhose herausstellte.
Zora trat langsam hinter ihn und schaute sich ebenfalls um. »Siehst du jemanden?«, fragte sie.
Lycien schüttelte den Kopf. Vielleicht war er wirklich paranoid. Es ergab mehr Sinn als die Alternative, nämlich die, dass ihr Verfolger sich in Wasser aufgelöst hatte.
Auch wenn die letzten Wochen ihn gelehrt hatten, keine Erklärung auszuschließen, so fantastisch sie auch wirken mochte.
»Gehen wir weiter«, murmelte er und wandte sich um.
Wenig später erreichten sie ihr Ziel – eine unscheinbare Hütte am Rand der Fischersiedlung, um die herum Boote im Wasser dümpelten. Zora klopfte an die Holztür, wartete jedoch nicht auf eine Reaktion, sondern öffnete sofort. Als sie eintraten, umfing sie leises Stimmengewirr und eine süßliche Duftnote. Lycien brauchte einen Moment, bis seine Augen sich an das schummrige Licht gewöhnt hatten, doch dann sah er die Menschen, die sich in den viel zu kleinen Wartebereich drängten. Viele saßen am Boden, da nicht genügend Stühle für alle Wartenden vorhanden waren, und sie alle hatten Tiere mitgebracht.
Lycien entdeckte Käfige, in denen Vögel flatterten, Kätzchen, Schweine und unzählige Nagetiere. Opfertiere.
Eine Frau hatte sogar eine Schlange um ihre Schultern liegen. Er war froh, dass er und Zora sich dazu entschieden hatten, Schwein in ihrem derzeitigen Hostelzimmer zurückzulassen.
Zora ging ihm voraus auf die Tür am anderen Ende des Raums zu, hinter der sich die schwarzmagische Heilerin befinden musste, deretwegen all diese Menschen gekommen waren. Offensichtlich hatte sie nicht vor zu warten.
Eine junge Frau in einem schwarzen Umhang verstellte ihnen jedoch den Weg.
»Bevor ihr Chun Hua sehen könnt, müsst ihr euch bei mir anmelden«, sagte sie und hob ein Klemmbrett an, auf dem sie händisch eine Liste aller Patienten notiert hatte. »Ich brauche Informationen darüber, wer von euch beiden eine Behandlung wünscht und wegen welcher Krankheit oder Verletzung ihr hier seid.« Ihre Augen wurden zu schmalen Schlitzen, als sie Lycien und Zora genauer musterte. »Wie ich sehe, habt ihr kein Opfertier dabei. Das wird extra kosten.«
»Wir sind nicht hier, um Heilung zu erbitten. Wir müssen mit Chun reden«, stellte Zora klar.
Sie waren nicht wegen Lyciens Silfurvenen gekommen. Keine Magierin wäre dazu in der Lage, diese erfolgreich zu behandeln, auch diese Chun Hua nicht, die sich allem Anschein nach kaum vor Patienten retten konnte. Was sie brauchten, war keine Heilung, sondern Information.
Während Lycien vor zwei Wochen in Silber und Schmerz versunken war, hatten die Stimmen – die drei Frauen –, die ihn in seinen Träumen begleiteten, seit Zora seine Magie geweckt hatte, ihm einen Ort gezeigt, an dem er Heilung finden konnte. Wo dieser Ort sein sollte, wusste Lycien jedoch nicht. Ganz im Gegensatz zu seiner Großmutter. Eine Tatsache, die er noch immer nicht begreifen konnte. Wenn seine Oma wirklich eine Ahnung gehabt hatte, dass und vor allem wo oder wie er geheilt werden konnte, wieso hatte sie ihn mit einem Galgen über seinem Kopf leben lassen? Wieso ihn glauben lassen, dass er sterben musste? Wieso hatte sie die Krankheit auf sich gezogen und zugelassen, dass man sie als unheilbar krank einstufte und für die Energiesammlung freigab?
Bei den Göttinnen, sie hatte ihr Leben für ihn geopfert – und nun sollte er glauben, dass sie die ganze Zeit von einer möglichen Heilung gewusst hatte?
Doch was sonst sollte das Bild bedeuten, das Zora in ihrer Hütte gefunden hatte? Vor ihrem Aufbruch – oder besser gesagt, vor ihrer Flucht – hatte sie dort nämlich magische Utensilien sowie Erinnerungsstücke zusammengesammelt, während Lycien lethargisch im Garten gesessen und es nicht über sich gebracht hatte, das Haus zu betreten, das auf einmal so leer wirkte und nun bloß noch seinen Erinnerungen ein Zuhause bot.
Neben Kräutern und Heiltinkturen waren Zora zwei alte Notizbücher seiner Großmutter in die Hände gefallen, die Anleitungen zu diversen Zaubern beinhalteten. Und ein Fotoalbum.
Darin hatte sie ein Bild entdeckt, das ebenden Tempel zeigte, den Lycien in seiner Vision gesehen hatte. Den Ort, an dem er Heilung finden würde.
Allerdings ohne Hinweise darauf, wo dieser Ort sein sollte. Das Bild war aufgenommen worden, als seine Großmutter als junge Frau im Jadetempel auf Citrin Island in Magie ausgebildet worden war. Lycien wusste kaum etwas über diese Zeit, da seine Oma nie darüber gesprochen hatte. Lange hatte er sogar bezweifelt, dass sie überhaupt eine Magierin war, so kategorisch hatte sie diesen Teil ihrer Vergangenheit totgeschwiegen.
Die Fotos in dem Album bewiesen jedoch etwas anderes. Sie zeigten seine Großmutter vor und im Jadetempel zusammen mit anderen angehenden Magierinnen. Eine davon war Chun Hua.
Der Jadetempel selbst war mittlerweile zu einer Touristenattraktion verkommen. Zora und Lycien hatten schnell eingesehen, dass sie dort weder Spuren noch echte Magierinnen finden würden. Doch mithilfe ihrer Kontakte in die magische Unterwelt Magnolia Bays war Zora zu Ohren gekommen, dass Chun Hua mittlerweile ihre Dienste als schwarzmagische Heilerin in Sol-Wave anbot.
Chun hatten sie also gefunden – und so hofften sie nun auf tatsächliche Hinweise auf den Tempel aus Lyciens Vision.
»Wir sind so etwas wie alte Freunde. Chun wird sich freuen, uns zu sehen«, meinte Zora nun mit ihrem süßesten Lächeln.
Die Assistentin blies die Wangen auf, als hätte Zora etwas besonders Dummes gesagt. »Wie ihr seht, hat Chun Hua viele Patienten. Was auch immer ihr wollt, ihr werdet warten müssen, bis ihr an der Reihe seid.«
»Wir haben es eilig«, gab Zora gepresst zurück.
»Seht euch um«, entgegnete ihr Gegenüber. »Alle hier haben es eilig, vor dem Tod wegzulaufen.«
Wie auf Kommando stieß eine der Patientinnen ein kehliges Husten aus. Ein Junge mit Zementhaut auf den Unterarmen schaute sie aus großen Augen an. Zora zog die Augenbrauen hoch und warf Lycien einen fragenden Blick zu. Dieser seufzte. Es war ein Risiko, sein Gesicht in der Öffentlichkeit zu zeigen. Hier waren zu viele Leute. Was, wenn einer der Kranken für die Brennende Lilie oder seine Eltern arbeitete? Oder für einen der Clans? Trotzdem schob er sich die Kapuze vom Kopf und entblößte damit sein von Silber gezeichnetes Gesicht.
Der selbstgefällige Ausdruck verschwand schlagartig vom Gesicht der Assistentin. Sie wich zurück. Das Flüstern, das eben noch durch den Raum geflattert war, erstarb.
»Danke«, sagte Zora bloß, schob sich an ihr vorbei und öffnete die Tür zur Magierkammer.
Darin saß ein Mann, dessen nackter Oberkörper von Blutergüssen gezeichnet war, vor einem Opferaltar. Ihm gegenüber stand die Magierin, das zeremonielle Messer auf ein Kaninchen gerichtet. Sie trug einen dunkelblauen Voliar und eine weiße Perücke, ähnlich der von Zora. Ihr Gesicht war von einer Maske bedeckt, die nur die Augen freiließ.
»Es tut mir leid«, sagte die Assistentin, die hinter Lycien und Zora in den Raum gehuscht war. »Die beiden sind einfach an mir vorbeigestürmt.«
»Wir haben es eilig«, meinte Zora.
Die Magierin legte ihren Kopf schief. Ihre Augen glitten über Lyciens Gesicht bis zu seinem Kragen, unter dem das Silber verschwand.
»Alle Eile der Welt wird euch nicht helfen«, antwortete sie. In ihren Augen erkannte Lycien so etwas wie Mitleid. »Ich kann deine Schmerzen lindern, das ist aber auch alles. Was ich dir raten würde, biete ich nicht als Service an.«
Es war allgemein bekannt, dass Silfurvenen nicht heilbar waren. Die meisten Kranken nahmen die Dinge selbst in die Hände und beendeten ihr Leben, bevor die Krankheit sie endgültig in den Wahnsinn trieb.
»Ich glaube doch, dass du uns helfen kannst«, sagte er und zog das Foto aus der Tasche, das Chun Hua als junge Frau zusammen mit seiner Oma zeigte.
Die Augen der Magierin zuckten vom Foto zu Lycien und wieder zurück und weiteten sich schließlich, als sie die Ähnlichkeit erkannte.
Chun deutete auf eine Tür hinter sich. »Wartet dort«, sagte sie. »Ich bin sofort bei euch.«
»Es gab eine Zeit, in der wir hätten Freundinnen werden können.«
Kari
War es ein Fehler gewesen, die Zalaros zu warnen? Was, wenn Isobelya ihre Drohung wahr machte und sie an Daishiro verriet? Hatten die Jahre in der Obhut des Dons Kari nicht gelehrt, niemals einem Clanführer zu vertrauen?
Die Gedanken zerrten an ihr, während sie und Fayola sich durch die belebten Gassen des Klauenviertels schoben, und ließen sie in ihrem Umfeld tausend mögliche Gefahren vermuten. Die alten Frauen, die auf Plastikstühlen neben ihren Häusern saßen, wurden in Karis Fantasie zu Spionen der Zalaro-Anführerin, die tanzenden Schatten der Lampions, die sich farbenprächtig über die Gassen zogen, erinnerten sie an die Tupfen auf den Fellen der Jaguare und Geparden im Katzenpalast, und hinter offenen Türen oder wehenden Vorhängen vermutete sie verborgene Augen, die jeden ihrer Schritte beobachteten. Selbst das Lachen der Kinder, die einen Ball zwischen sich hin und her kickten, wirkte bedrohlich. Bei den Göttinnen, sie musste sich zusammenreißen! Sie mochte den Namen Nemea von sich gestreift haben, doch sie war immer noch Kari, und wenn es eines gab, das sie nicht war, dann schwach!
Fayola humpelte leicht. Bei ihrer Flucht aus Daishiros Villa war sie angeschossen worden. Saikas Zauber hatte sie damals nicht nur gerettet, sondern auch Fayolas Wunde geheilt, wenn auch nicht vollständig. Eine Narbe über ihrer rechten Hüfte und der Schmerz, der über Fayolas Gesicht zuckte, wann immer sie zu fest auftrat, blieben.
»Wieso hat Isobelya uns gehen lassen?«, fragte Kari.
Fayola antwortete: »Ihre Augen und Ohren sind überall. Alle Männer, Frauen, Kinder und Katzen des Viertels erstatten Isobelya Bericht. Es heißt, selbst die Schatten unterstehen ihrem Befehl. Wir können nirgendwo hingehen, ohne dass sie davon erfährt.«
Also war Karis Paranoia begründet. Sie seufzte. Die Augen und Ohren des Zalaro-Viertels … genauso wie Mama Laquar die Augen und Ohren der Walled City gewesen war … und ihr schlagendes Herz. Bevor Kari sie ausgeliefert hatte. Natürlich wanderten ihre Gedanken zur Magierin – schon wieder. Kari war nie sentimental gewesen, doch ihr Aufenthalt in der Walled City, so kurz er auch gewesen sein mochte, hatte sie verändert. Der Anblick von Mama Laquar, die in Ketten und mit einer marmornen Maske über den Kopf in einen Käfig gesteckt wurde, verfolgte Kari, ebenso wie die Frage, was nun aus der Mauernstadt werden würde. Konnte sie sich vom Anschlag der Nemeas erholen? Und noch wichtiger, konnte das bunte, dicht gedrängte Leben hinter den Mauern ohne Mama Laquar weitergehen?
Kari hatte gelernt, ohne ein Herz zu leben. Aber würde den Bewohnern der Walled City dasselbe gelingen?
Seit der Flucht aus Daishiros Villa versteckten Kari, Fayola, Haruo und Izumi sich in einer verlassenen Wohnung in den Zalaro-Vierteln. Kari hatte die Mauernstadt weder betreten noch in den Nachrichten oder im geflüsterten Gerüchtestrom der Leute etwas über sie gehört. Es war, als hätte es die Attacke auf die Walled City niemals gegeben. Nur ein Detail dieses Tages füllte die Köpfe und Gespräche aller: der Drache, der aus der Mauernstadt aufgestiegen und über den Ozean geflogen war. Der erste seit über hundert Jahren.
»Wahrscheinlich hat Isobelya uns gehen lassen, damit wir sie zu unserem Versteck führen«, fuhr Fayola fort und riss Kari damit aus ihren Gedanken.
»Vermutlich«, bestätigte sie, was der Grund dafür war, dass sie noch lange nicht dorthin zurückkehren konnten.
Sie erreichten einen Marktplatz, auf dem sich ebenso viele Menschen drängten wie im Central District auf der Hauptinsel. Marktschreier krächzten sich in dem Versuch, einander zu übertönen, die Kehlen aus den Leibern, auf kleinen Holzständen oder Decken am Boden türmten sich exotische Früchte und Gemüse, Fisch und Fleisch, Elektroprodukte und Juwelen, die beinahe ebenso bunt waren wie die Kleider und Hemden der Marktbesucher. Und über allem baumelten regenbogenbunte Lampions.
»Das hier ist der Katzenmarkt«, erklärte Fayola und bedeutete Kari, sich dichter in das Gewirr der Marktstände vorzuwagen, wo die Gerüche stechender und die Luft schwerer, beinahe erdrückend wurden.
Hier gab es statt Obst und Gemüse Körbe voller Schlangen, exotische Fische in mit Wasser gefüllten Plastiksäcken, die in Bündeln über den Köpfen der Marktschreier schaukelten, und Käfige, in denen sich die unterschiedlichsten Tiere drängten. Kaninchen und Meerschweinchen, Hunde und Krokodile, Springböcke und Echsen, vor allem jedoch Katzen in allen Größen und Schattierungen, die sie mit aufmerksamen Blicken musterten. Der Katzenmarkt hatte seinen Namen nicht ohne Grund.
Gerüchten zufolge wurden hier nicht nur normale Tiere, sondern auch Gestaltwandler verkauft. Und obwohl Kari wusste, dass diese mittlerweile zu selten und vor allem zu wertvoll waren, um sie in enge Käfige wie diese zu stecken, ertappte sie sich dabei, wie sie in den leuchtenden Katzenaugen nach Spuren von Menschlichkeit suchte.
»Wir müssen uns einen Plan zurechtlegen, falls Isobelya sich doch entscheidet, uns auszuliefern«, sagte Kari, als sie einen Stand passierte, der Tigerzähne und -krallen als magische Heilmittel darbot. »Isobelya wird uns nicht so einfach aus den Zalaro-Vierteln entwischen lassen.«
Noch hatte Kari die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Anführerin des Klauenclans ihre Meinung ändern und sich mit ihnen gegen Don Nemea stellen würde. Daishiro hätte sie für ihre Naivität ausgelacht. Ein Grund mehr, an der Hoffnung festzuhalten. Kari war sich bewusst, wie sehr der Don und seine Weisheiten sie in den letzten Jahren geformt hatten. Umso mehr wollte sie diese nun von sich streifen, wollte von Daishiros Paradiesvögelchen zu … nun ja, sich selbst werden. Wer auch immer das sein mochte.
»Wir können die Leute hier nicht im Stich lassen«, stellte Fayola bestimmt fest.
»Was, wenn sie unsere Hilfe nicht wollen?«, gab Kari zurück. Denn das hatten Isobelya und ihre Kriegerkatzen klargemacht.
»Was sollte dann sein? Willst du die Klauenviertel im Stich lassen, nur weil Isobelya zu stolz ist, uns zuzuhören? Die Leute hier sind ebenso wenig für ihren Hochmut verantwortlich wie wir für Daishiros Taten«, sagte Fayola. In ihrer Stimme lag eine Stärke, die Kari ihr in all den Jahren nicht zugetraut hatte. Die ganze Zeit hatte sie Fayola für ein oberflächliches, machtgieriges Luxuspüppchen gehalten. Es war beschämend, wie falsch sie Fayola eingeschätzt hatte. »Dieser Ort ist etwas Besonderes. Wir können nicht zulassen, dass er zu einem zweiten Skarabäusviertel wird.«
Sie hatte ja recht. Die wenigen Tage, die Kari in den Zalaro-Gebieten verbracht hatte, ließen sie feststellen, dass sie mit den Nemea-Vierteln in etwa so viele Gemeinsamkeiten hatten wie Magnolia Island mit dem Mond. Die Straßen waren bunter, lauter, so voller Leben, während die Skarabäusstraßen stets mit dem ängstlichen Flüstern seiner Bewohner erfüllt waren. Die Zalaros erlaubten ihren Leuten eine Freiheit, von der Kari und alle anderen Bewohner der Nemea-Gebiete nur träumen konnten. Doch das hieß nicht, dass dieser Ort ohne Schattenseiten war, was das Fauchen der Katzen rund um Kari herum allzu deutlich bestätigte, und auch der Anblick, der sich nun vor ihnen auftat. Sie hatten das Zentrum des Katzenmarkts erreicht. Hier knieten Kinder, Frauen und Männer. Um sie herum schritten Marktbesucher und musterten sie genau.
»Immerhin hat Daishiro keine Sklaven verkauft«, murmelte Kari.
Fayola stieß ein bitteres Lachen aus. »Was warst du im Hause Nemea? Was waren ich und Haruo? Was war irgendjemand von uns, wenn nicht Daishiros Sklave? Du sagtest vorhin doch noch selbst, dass wir Daishiros Besitztümer waren, oder war das bloß Heuchelei, um Isobelya zu beeindrucken?«
Sie fasste Kari am Ellenbogen und zog sie weg von den Menschenhändlern in eine Gasse, in der Hüllen verkauft wurden. Die Reihe der stimm- und willenlosen Wesen, die völlig gleichgültig dastanden, sandte einen kalten Schauer Karis Rücken hinab. Die Hüllen hatten sie stets mit Unbehagen erfüllt, doch seit sie wusste, was sie wirklich waren – Menschen, denen die Seele geraubt worden war, genauso wie Karis Vater –, ertrug sie ihre Präsenz kaum noch. Fayola wirkte zu wütend, um die Hüllen überhaupt zu bemerken.
»Ich will die Leute hier auch nicht im Stich lassen«, flüsterte Kari beschwichtigend. »Aber ich kann nicht zulassen, dass wir Izumis Sicherheit gefährden.«
Selbst wenn sie das gesamte Katzenviertel dafür opfern mussten, Daishiro durfte Izumi auf keinen Fall in seine Finger bekommen. Denn wenn er es täte, wäre jegliche Chance, gegen ihn anzukommen, verloren. Das hatte Kari gelernt, kurz bevor die Skarabäuskrieger in der Walled City einfielen. Izumi mochte wie ein gewöhnliches Mädchen wirken, doch in ihr schlummerte die Seele von Feo, einer der drei Göttinnen, welche die Welt mit ihrer Magie vor vielen Tausend Jahren erschaffen hatten. Kari war mit den Geschichten rund um den ersten Gott, seine drei Töchter und ihre sieben Krieger aufgewachsen. Ihre Mutter hatte sie ihr vor dem Schlafengehen vorgelesen, als sie noch ein kleines Mädchen war, und das so oft, dass Kari die Erzählungen auch heute noch auswendig aufsagen konnte.
Feo, die Göttin des Lichts und der Wärme, hatte mit ihrer Magie das Leben selbst erschaffen. Alle Menschen, Gestaltwandler und Magier, aber auch solche, die keinerlei Magie in sich trugen, alle Tiere und Pflanzen waren aus ihrem Licht geboren worden. Izumi hatte keine Ahnung, welche Magie in ihr ruhte, doch das hieß nicht, dass die Magie nicht da war. Kari wollte sich nicht einmal vorstellen, was Daishiro tun würde, sollte er sie beherrschen.
»Wieso willst du die Zalaros überhaupt so dringend beschützen?«, fragte Kari, während Fayola sie weiter zwischen Marktbesuchern hindurchzog, bis sie eine etwas ruhigere Gasse jenseits der Marktstände erreichten. »Isobelya hat dich eine Hure und Verräterin genannt. Sie verachtet dich dafür, Daishiro geheiratet zu haben, dabei hat sie selbst dich an ihn verkauft. Du schuldest ihr nichts. Niemandem von ihnen.«
Kari hatte nicht wirklich mit einer Antwort gerechnet. Es hatte einmal eine Zeit gegeben, in der Fayola und sie hätten Freundinnen werden können, doch der Funke der Zuneigung, den sie kurz nach Fayolas Ankunft in der Nemea-Villa verspürt hatte, war schnell zu Misstrauen und später zu regelrechter Verachtung geworden. Fayola und Kari standen sich nicht nahe. Das Einzige, was sie verband, war ihr geteilter Hass auf Daishiro. Doch das reichte nicht aus, um echtes Vertrauen zu schaffen. Kari hatte ihre Frage mehr als Provokation gestellt denn aus einem echten Verlangen nach Antworten.
Doch zu ihrer Überraschung antwortete Fayola: »Meine Eltern wurden von Katzenjägern – so nennen die Sklavenhändler sich – getötet, als mein Zwillingsbruder und ich sechs Jahre alt waren. Sein Name war Kiano.«
War. Die Vergangenheitsform entging Kari nicht, ebenso wenig wie die Bitterkeit, die in diesem einen Wort mitschwang, das viel zu kurz war, um die Schwere eines unwiederbringlichen Verlusts zu tragen.
»Wir wären selbst als Sklaven geendet, hätte Isobelya uns nicht gefunden und … gerettet.« Was vermutlich so viel hieß wie, sie hatte die Sklavenhändler in Katzenfutter verwandelt. »Die Krieger des Zalaro-Clans haben uns aufgezogen und uns alles beigebracht – wie man sich verwandelt, wie man kämpft. Ich schulde ihnen viel. Darum habe ich mich auch freiwillig dazu bereit erklärt, Daishiro zu heiraten.«
Freiwillig? Kari war überzeugt davon gewesen, Fayola hätte keine Wahl gehabt – genauso wie sie selbst. Doch im Klauenclan herrschten anscheinend tatsächlich andere Gesetze.
»Die Kämpfe zwischen den Katzen und Skarabäuskriegern forderten viele Opfer, vor allem auf unserer Seite.« Fayola betonte es auf eine Art, die klarmachte, dass ihre Seite nicht Daishiros war. »Isobelya ließ mich damals in den Katzenpalast rufen, um mir ihre Idee zu unterbreiten. Sie erklärte mir, eine arrangierte Ehe sei die beste Möglichkeit, die Kämpfe zu beenden. Sie wusste von dir und nahm an, dass Daishiro Interesse an einer weiteren Gestaltwandlerin haben könnte. Wir mögen der Clan der Katzen sein, doch schon damals gab es kaum neue Wandler. Im gesamten Clan waren wir nur drei junge Frauen, die sich verwandeln konnten und noch nicht verheiratet waren. Ich kannte die anderen beiden. Sheyella ist eine der sanftesten Frauen, die ich jemals erlebt habe. Sie wäre unter Daishiro eingegangen wie eine vertrocknende Blume, und Meyelin, sie war fast noch ein Kind. Ich war die einzig mögliche Braut.«
Auch wenn Fayola mit ihren siebzehn Jahren selbst fast noch ein Kind gewesen war. Kari schluckte diesen Gedanken hinunter.
»Isobelya erklärte mir all das und ließ mich entscheiden, ob ich dieses Opfer bringen wollte. Mein Bruder war dagegen. Erst versuchte er, mich mit Argumenten zu überzeugen, dann wollte er Isobelya direkt konfrontieren, schließlich brüllte er und schrie. Ich habe Kiano niemals flehen sehen, nicht mal, als unsere Eltern vor unseren Augen getötet wurden. Aber an diesem Tag, da flehte er mich an, nicht zu gehen. Ich hätte auf ihn hören müssen. Ich wollte das Blutvergießen beenden, und noch mehr …«
Sie stockte kurz, sah sich um, als hätte sie Angst, unsichtbare Ohren könnten ihrer Erzählung lauschen.
»Du wolltest für den Klauenclan spionieren«, schlussfolgerte Kari.
Fayola nickte kurz.
»Was ist passiert?« Denn irgendetwas musste geschehen sein, das Fayola von einer Kämpferin und Spionin der Zalaros zu Daishiros Schoßkätzchen gemacht hatte.
»Zwei Tage nach unserer Hochzeit machte Daishiro mir ein Geschenk«, fuhr sie gepresst fort. »Ein Jaguarfell. Er sagte, er hätte es speziell für mich anfertigen lassen, weil er mir einen Teil meiner Heimat schenken wollte. Er schlug vor, dass ich es als Teppich benutzen und vor mein Bett legen sollte, damit ich beim Aufstehen jeden Tag etwas Weiches und Warmes unter den Sohlen fühle, wenn mein Heimweh zu groß wird. Das Fell sollte mich täglich an seine Liebe zu mir erinnern und an das neue Leben, das er mir geschenkt hatte.«
Bei den Göttinnen, ein Jaguarfell?
»War es …?«, begann Kari.
»Kiano, mein Bruder.« Fayola schluckte schwer. »Das Fell liegt noch heute vor meinem Bett. Erst weigerte ich mich daraufzutreten, doch Daishiros Dienerinnen beobachteten mich jeden Morgen und erstatteten ihm Bericht, wenn ich es nicht tat. Er ließ mich dann zu sich kommen, sagte, er sei enttäuscht, dass ich sein Geschenk nicht wertschätzte, sagte auch, es ließe ihn an meiner Liebe zu ihm zweifeln und an meiner Loyalität. Er fragte, ob ich weitere Geschenke bräuchte, um mich an das Versprechen zu erinnern, das wir einander bei unserer Heirat gegeben hatten. Er bestrafte mich.« Noch einmal schluckte sie, wieder und wieder, als könnte sie die Erinnerung gleich mitverschlucken. »Ich war schwach. Ich hätte Daishiro für das, was er meinem Bruder angetan hat, das Herz aus der Brust reißen müssen, aber ich tat es nicht. Ich hatte zu viel Angst.«
Sie hielt inne, streckte ihre Schultern durch, die bis eben tief gehangen hatten, und reckte ihr Kinn in die Höhe. Dann verkündete sie: »Isobelya hat Recht, mich eine Hure zu nennen, denn ich habe mich von Daishiro genau dazu machen lassen. Ich habe viel zu lange nicht gekämpft, aber das ändert sich jetzt.«
Sie sah Kari nicht an und sprach mit einer Inbrunst, als würde sie ihre Worte an jemand ganz Bestimmten richten. Jemanden, vor dem sie sich die längste Zeit hatte erklären wollen. Und im nächsten Moment begriff Kari, dass sie genau das wirklich getan hatte. Denn das Knurren eines Tigers drang an ihre Ohren.
Sie waren nicht allein.
Kari fuhr herum. Ein muskulöser weißer Tiger schritt mit gespitzten Ohren auf sie zu. Lautlos glitten seine Pratzen über den Asphalt. Seine Zähne waren gefletscht, die grünen Augen auf sie gerichtet. Instinktiv hob Kari die Arme in einer Kampfposition. Die Schnurrhaare des Tigers zuckten, als würde er lachen – und vielleicht tat er das auch. Denn nichts anderes war Karis pathetischer Versuch, sich mit bloßen Händen gegen eine riesige Raubkatze zu verteidigen: lachhaft.
Schnell schaute sie sich um. Fayola und sie befanden sich in einer verlassenen Gasse, die sich viele Meter weit zog. Bis auf den Tiger waren sie vollkommen allein. Hier war niemand, der sie verteidigen oder Zeuge ihres Kampfs – ihres Todes? – werden würde, keine Fluchtmöglichkeit, keine Gegenstände, die sie als Waffe benutzen konnte. Sie waren dem Tier vollkommen ausgeliefert.
»Was hast du getan?«, flüsterte sie Fayola zu. Denn sie musste die ganze Zeit gewusst haben, dass der Tiger sie verfolgte.
Vermutlich hatte Fayola sie absichtlich in diese einsame Gasse gelockt, während Kari zu versunken in ihre Geschichte gewesen war, um sich auf ihre Umgebung zu konzentrieren. Was für ein Anfängerfehler! Sie hatte nicht damit gerechnet, dass Fayola sie verraten würde.
Fayola machte einen Schritt nach vorn und hob den Arm, sodass sie Kari hinter sich abschirmte. »Hier geht es nicht um dich«, wisperte sie.
Nicht um Kari, sondern um den Tiger, der lautlos näher glitt und dessen Knurren Karis Eingeweide Purzelbäume schlagen ließ.
»Ich muss mit dir reden«, sagte Fayola nun lauter und an den Wandler gewandt. »Und ich weiß, du würdest mich am liebsten in Stücke reißen, aber hör dir wenigstens an, was ich zu sagen habe, bevor du deine Klauen in mein Fleisch gräbst.«
Das Knurren des Tigers verwandelte sich in ein tiefes Grollen, als Fayola ihre Hand langsam sinken ließ.
»Bitte«, sagte sie.
Der Tiger legte seine Ohren an. Kurz hoffte Kari, er würde sich in seine menschliche Gestalt zurückverwandeln und Fayola tatsächlich eine Chance geben, sich zu erklären – was auch immer sie erklären wollte. Doch dann setzte er zum Sprung an. Der Tiger wollte nicht reden, wollte nicht zuhören, er wollte den Tod, der in seinen Augen stand, wollte Rache und Fleisch. Schon erhob sich sein schwerer Körper und er sprang mit gezückten Krallen auf sie zu.
Fayola stieß einen Schrei aus, Kari taumelte zurück. Sie waren zu langsam, viel zu langsam, für dieses mächtige Tier, das wie ein Rachegott durch die Luft flog. Doch plötzlich verwandelte sich das Knurren in ein hohes Brüllen. Der Tiger warf sich zur Seite und landete zwei Handbreit vor Fayola auf dem Boden. Seine Ohren zuckten, ebenso wie sein Schweif – und in seiner Flanke steckte eine Klinge.
»Wieso hat er nichts gesagt?«
Zora
Zora nutzte die Wartezeit, um sich in Chun Huas Kammer umzusehen. Ein Regal bedeckte eine komplette Wand. Darin reihten sich Gläschen und Dosen voller Kräuter, Steine und Tinkturen. Auf der anderen Seite des Raums stand eine Behandlungsliege. Zora vermutete, dass diese für die Kunden war, die sich mit traditionellen Tinkturen und Medizinen anstatt durch Blutmagie Heilung verschaffen wollten. Daneben befand sich eine nackte Schaufensterpuppe, die vermutlich der Aufbewahrung des Voliars diente. Der Raum erinnerte Zora in vielerlei Hinsicht an die Behandlungsräumlichkeiten in der Walled City. Es war schon merkwürdig: Erst vor drei Wochen hatte sie dort selbst noch Heilzauber ausgeführt, nun fühlte es sich an, als läge dieser Teil ihres Lebens ganze Jahrzehnte zurück.
Chun Hua trat ein und schloss die Tür hinter sich. Sie wischte sich die blutigen Hände notdürftig ab, ehe sie die Maske abnahm. Dahinter kam ein überraschend junges Gesicht zum Vorschein. Obwohl sie genauso alt wie Lyciens Großmutter sein musste, wirkte sie keinen Tag älter als dreißig. Zora vermutete, dass Chun Lebensenergie zur eigenen Verjüngung einsetzte, wie es auch Mama Laquar getan hatte.
»Du bist also ihr Enkel«, murmelte Chun, den Blick auf Lycien gerichtet. »Ich hätte nicht gedacht, dich jemals kennenzulernen, nachdem Celine unseren Tempel so überstürzt verlassen hat.« Celine. Erst jetzt fiel Zora auf, dass sie Lycien nie nach dem Namen seiner Großmutter gefragt hatte. Für ihn war sie einfach Oma gewesen. Und für Zora irgendwie auch.
»Zieh dich aus«, wies Chun Lycien an, ohne ihn anzusehen, drapierte erst ihre Maske, dann ihre Perücke auf der Schaufensterpuppe. Ihr hochgestecktes Haar war schwarz und ohne jegliche graue Strähne. Ein weiteres Zeichen ihrer erzauberten Jugend.
Als sie Lyciens Zögern bemerkte, drehte sie sich zu ihm und sagte: »Wenn du schon hier bist, kann ich dich auch behandeln. Ich werde dich nicht heilen können, aber zumindest die Schmerzen lindern.«
»Das ist nicht nötig«, sagte Zora.
Chun lächelte. »Ich vermute, du bist die Heilerin, die dafür verantwortlich ist, dass er noch atmet. Schau nicht so überrascht, wir Hexen erkennen unseresgleichen. Das weißt du doch.« Dabei hob sie herausfordernd eine Augenbraue. »Ich muss eingestehen, es ist beeindruckend, was du mit ihm gemacht hast. Nichtsdestotrotz würde ich mich besser fühlen, die Schmerzen deines Freundes wenigstens ein bisschen zu lindern. Dann kann ich zumindest so tun, als würde ich meine echten Patienten nicht warten lassen, nur um meine Neugierde zu befriedigen.«
»Er hat keine Schmerzen«, grummelte Zora.
»Glaubst du das wirklich oder möchtest du es nur glauben?«, fragte Chun und hob erneut eine Augenbraue.
Zora öffnete den Mund zu einer Erwiderung, schloss ihn jedoch wieder, als ihr Blick auf Lyciens schuldbewusste Miene fiel. Bei den Göttinnen, war das sein Ernst? Lycien zögerte abermals, schälte sich aber schließlich aus seinem Hoodie. Das hieß, er hatte wirklich Schmerzen und … natürlich … natürlich hatte er Schmerzen! Die Silfurvenen mussten sich bis tief in seine Organe gefressen haben, das Silber bedeckte beinahe seinen gesamten Körper. Es war vollkommen unmöglich, dass er keinerlei Schmerz verspürte. Zora hätte es wissen müssen, aber sie hatte nicht mitgedacht. Und Lycien, dieser Vollidiot, hatte stumm vor sich hin gelitten. Wieso hatte er nichts gesagt? Wieso hatte sie nicht gefragt?
Konzentriert legte Chun ihre Hand auf Lyciens Brust und schloss die Augen, während sie seinen Herzschlag fühlte. »Ein normales Herz hätte unter dem Einfluss von so viel Silber aufhören müssen zu schlagen, aber deines ist stark«, stellte sie fest, ließ ihre Finger dann langsam über seine Schlüsselbeine und Schultern wandern, wo sie die feinen Linien nachzog, welche Naels Lebensgeschichte erzählten.
Chuns Finger auf Lyciens Haut zu sehen, brachte Zoras Magen zum Brodeln. Sie musste die Lippen aufeinanderpressen, um sich davon abzuhalten, Chun zurechtzuweisen. Die Heilerin tat nur ihre Arbeit … das wusste Zora, aber der Anblick behagte ihr trotzdem nicht. Weil ihre Finger auf Naels Erinnerungen lagen – und die gehörten einzig Zora. Sie schluckte schwer. Zora war nie eifersüchtig gewesen und sie würde jetzt nicht damit anfangen.
»Wir haben gehofft, du könntest uns sagen, wo dieser Ort ist«, sagte Zora und hielt das Bild hoch, das Lyciens Großmutter vor dem Tempel aus seiner Vision zeigte.
»Ich kenne den Ort nicht«, antwortete Chun, wobei sie kaum aufschaute. »Die Magie, die dich am Leben hält, ist stark«, fuhr sie an Lycien gewandt fort. Sie zog die Hand zurück und ging zum Regal, aus dem sie nun einen Tiegel mit rötlichem Inhalt holte. »Ich wusste schon immer, dass er anders war.«
»Er?«, fragte Zora, als Chun zurück zu Lycien ging und ihm bedeutete, sich auf die Behandlungsliege zu setzen.
»Der Mann, wegen dem Celine den Jadetempel verlassen hat. Ich vermute, dein Großvater. Du siehst ihm ähnlich«, erklärte sie und öffnete das Gefäß. »Das hier sollte deinen Schmerz dämpfen«, sagte sie zu Lycien.
Der zog die Nase kraus. »Was ist das? Es riecht nach …«
»Blut«, bestätigte Chun. Zora hatte nichts gerochen. Lyciens scharfe Sinne waren wirklich beeindruckend. »Ein Gemisch aus Blut, Knochenstaub und einigen Kräutern, durchtränkt mit heilender Magie«, erklärte Chun weiter. »Die Paste ist meine eigene Rezeptur und hat sich als erfolgreich zur Schmerzunterdrückung erwiesen.«