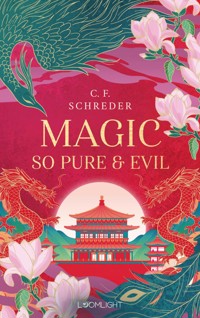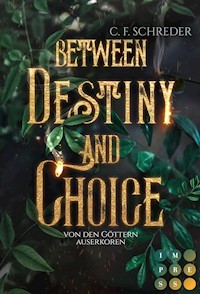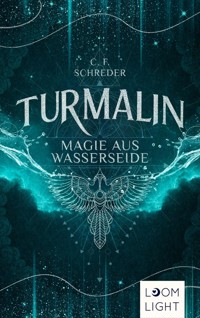
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Deine Hörner sind pure Magie. Du musst sie nur richtig einsetzen.« – Mitreißende Romantasy in einer magischen Welt
Seit Lyra als kleines Mädchen beobachtet hat, wie ein Fae-Magier echte Vögel aus Nektarfasern webte und ihnen mit Kristalllicht Leben einhauchte, träumt sie davon, selbst eine Vogelweberin zu werden. Doch als ihr zwei Hörner aus der Stirn wachsen, steht ihr Leben plötzlich auf dem Spiel: Sie ist eine Helya – eine gehörnte Fae, eine Geächtete. Denn nur diese sind in der Lage, schwarze Magie heraufzubeschwören. Lyras einziger Ausweg ist die Flucht mit dem Schmuggler Nicolai, der ihr schon bald eine gefährliche wie faszinierende neue Welt eröffnet!
Ein Textauszug voller Zauber!
»Nein danke. Ich habe genug Schwierigkeiten mit normaler Naturmagie, da werde ich nicht anfangen, irgendwelche verbotene Emotionsmagie zu üben«, sagte Lyra.
»Wer spricht denn von Emotionsmagie?«, erwiderte Nicolai. »Deine Hörner sind pure Magie. Sie sind wie die Lupen oder die Pulver oder all die anderen Artefakte, die wir für Fae-Magie benutzen, nur dass sie mit deinem Körper verbunden sind. Sie sind ein Teil von dir, und das heißt, dass es dir mit ihnen eigentlich leichter fallen sollte, Magie zu kanalisieren, als mit jedem anderen Artefakt. Du musst die Hörner nur richtig einsetzen, und ich weiß, dass du es kannst. Ob du es nun willst oder nicht, du wurdest dazu geboren, auf diese Art zu zaubern.«
//Dies ist der erste Band der »Turmalin«-Reihe. Alle Romane der fantastischen Liebesgeschichte im Loomlight-Verlag:
-- Band 1: Magie aus Wasserseide
-- Band 2: Kuss aus Sternenstaub (September 2021)//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
»Deine Hörner sind pure Magie. Du musst sie nur richtig einsetzen.« – Mitreißende Romantasy in einer magischen Welt
Seit Lyra als kleines Mädchen beobachtet hat, wie ein Fae-Magier echte Vögel aus Nektarfasern webte und ihnen mit Kristalllicht Leben einhauchte, träumt sie davon, selbst eine Vogelweberin zu werden. Doch als ihr zwei Hörner aus der Stirn wachsen, steht ihr Leben plötzlich auf dem Spiel: Sie ist eine Helya – eine gehörnte Fae, eine Geächtete. Denn nur diese sind in der Lage, schwarze Magie heraufzubeschwören. Lyras einziger Ausweg ist die Flucht mit dem Schmuggler Nicolai, der ihr schon bald eine gefährliche wie faszinierende neue Welt eröffnet!
Die Autorin
© Christoph Ascher
C. F. Schreder ist das Pseudonym von Christina Fuchs. Sie wurde 1992 in einem kleinen Tiroler Städtchen geboren, studierte Psychologie und Wirtschaftswissenschaften, lebte ein Jahr lang in Hong Kong und arbeitete anschließend als Personalmanagerin in Österreich und in den USA. Vor allem während ihrer Reisen und Auslandsaufenthalte sammelte sie Inspirationen für ihre Geschichten. Heute lebt und schreibt sie in Salzburg.
C. F. Schreder auf Instagram: www.instagram.com/christina.schreibt/
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Loomlight auch!
Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autoren und Übersetzern, gestalten sie gemeinsam mit Illustratoren und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher und Autor*innen auf: www.loomlight-books.de
Loomlight auf Instagram: www.instagram.com/loomlight_books/
Viel Spaß beim Lesen!
C. F. Schreder
TurmalinMagie aus Wasserseide
Für Elias und Luisa
1. Traumzeichnen
Das Kratzen Dutzender Federn auf Papier erfüllte die Luft. Vorsichtig tauchte Lyra die Federspitze in das Tintenfass und ließ sie in der durchscheinenden Flüssigkeit kreisen. Sie senkte den Kopf, bis ihre Nasenspitze fast die Tischplatte berührte, und setzte die Feder an. Mit zusammengekniffenen Augen zeichnete sie einen Halbkreis, von dem sie hoffte, dass er an der richtigen Stelle sein würde.
Nur ein feines Glitzern auf dem Papier wies darauf hin, wo sie die Linien gezogen hatte, denn Sternentinte, gewonnen aus dem Licht der Nacht, war für das bloße Auge unsichtbar.
Warum musste Traumzeichnen nur so schwierig sein?
Neben ihr tanzte Yivies Feder übers Papier, als gäbe es nichts Einfacheres. Ihre Finger lagen leicht am Federschaft, im Gegensatz zu Lyras, die den Holzstiel verkrampft umklammerten. Yivies Gesichtsausdruck wirkte verträumt und sie hatte sogar noch die Zeit, mit der linken Hand eine widerspenstige Strähne zurück in ihren Zopf zu stecken.
Yivie war die talentierteste Traumzeichnerin der Klasse, und weil sie und Lyra Freundinnen waren, hatte sie sich am Anfang des Schuljahres dazu bereit erklärt, in ihrer Freizeit mit Lyra zu üben. Doch ihre flinken Bewegungen und die Feinheit, mit der sie die unsichtbaren Linien zeichnete, konnte Lyra auch nach noch so vielen Übungsstunden nicht nachvollziehen. Es war ihr ein Rätsel, wie etwas, das ihr selbst dermaßen viel Kopfzerbrechen bereitete, für Yivie so einfach sein konnte.
Lyra blickte durch den Raum, der mehr nach Gewächshaus als nach einem typischen Klassenzimmer aussah. Mannshohe Fenster säumten die Wände und einen Teil der Dachschräge und öffneten sich zum Garten hin, in dem das ganze Jahr über Kirsch- und Apfelbäume, Hollundersträuche, Malvenbüsche und Sonnenblumen blühten. Die einzige fensterlose Wand bedeckten Regalreihen, die vor Pflanzen überquollen, und selbst das Lehrerpult war mit so vielen Blumentöpfen verstellt, dass Lyra sich wunderte, wie ihre Professorin Miss Elsgeroth dort Platz zum Schreiben fand.
Alle Lehrräume für Fae-Magie sahen so aus, denn um Träume zu zeichnen, Musik zu weben oder Leben in verdorrte Pflanzen zu hauchen, brauchte es Licht, genauso wie Luft und die Natur. Oder, um die Professorin, Miss Elsgeroth, zu zitieren: »Wie wollt ihr Naturmagie wirken ohne die Natur?«
Miss Elsgeroth war eine beeindruckende Erscheinung. Sie war fast zwei Meter groß, was selbst für eine Menschenfrau ungewöhnlich gewesen wäre, für eine Fae aber noch mehr. Ihr hüftlanges hellrotes Haar wurde mittlerweile von grauen Strähnen durchzogen. Trotzdem war ihre Haut glatt. Kaum eine Falte hatte sich auf ihr Gesicht geschlichen. Ihre Augen waren mandelförmig und von einer graublauen Farbe, und wenn sie einen anschaute, kam es einem so vor, als sähe sie bis unter die Schädeldecke. Als könnte sie die Gedanken ihrer Schüler lesen und auf den Grund ihrer tiefsten Geheimnisse schauen.
Vielleicht konnte sie das wirklich. Es war zwar verboten, so wie jegliche Emotionsmagie, doch Lyra hatte von Magiermeistern gehört, die solche Fähigkeiten im Geheimen besaßen. Und sollte es stimmen, was ihre Eltern erzählt hatten, war Miss Elsgeroth eine der fähigsten Fae-Zauberinnen des Landes und Mitglied der Magier-Gilde, die von Akademie-Leitern und sogar der Regierung Turmalins als Berater herangezogen wurde. Warum eine Magierin ihres Kalibers freiwillig ihre Zeit dafür verschwendete, jungen Fae die Grundkenntnisse der Naturmagie beizubringen, das war Lyra allerdings ein Rätsel. Vor allem, wenn diese Fae so untalentiert waren wie sie selbst.
Sie unterdrückte ein Seufzen, während sie mit zusammengekniffenen Augen auf ihr Papier starrte und zu erkennen versuchte, ob ihr die Zeichnung gelungen war oder ob sie noch weitere Linien brauchte. Die Sternentinte glitzerte zwar, aber was genau sie gemalt hatte, konnte sie nicht erkennen. So ein Mist! Dabei hatte sie sich ein denkbar einfaches Traumtier ausgesucht: einen Schmetterling. Etwas, das selbst Kleinkinder zeichnen könnten.
Warum musste sie bloß eine solche Niete sein?
»Wie ich sehe, seid ihr mit euren Zeichnungen fertig«, sagte Miss Elsgeroth.
Wie der Rest ihrer Erscheinung war auch ihre Stimme besonders, gleichzeitig rauchig und sanft. Sie sprach leise, trotzdem war es unmöglich, sie nicht zu hören.
Es klapperte, als die Schüler ihre Federn niederlegten. Lyra schaute sich nach beiden Seiten um. War sie wirklich die Einzige, die noch Zeit brauchte? Offenbar ja. Insgesamt waren sie fünfzehn Fae-Schüler, elf Mädchen, vier Jungen, alle um die siebzehn Jahre alt, die in einem Kreis aus hölzernen Tischchen um ihre Lehrerin herumsaßen. Zwei ihrer Mitschülerinnen machten ein beunruhigtes Gesicht, einer der Jungs studierte seine unsichtbare Zeichnung mit gerunzelter Stirn, doch auch er hatte die Feder nicht mehr in der Hand.
»Lyra, brauchst du noch Zeit?«, fragte die Professorin.
»Nein, ich äh ... ich bin fertig.«
Sie rang sich ein Lächeln ab und legte ihren Federkiel neben sich. Fertig war definitiv eine Übertreibung, doch wenn sie ehrlich war, würde auch zusätzliche Zeit ihre Zeichnung nicht besser machen.
»Wunderbar.« Miss Elsgeroth bedachte die Schüler einen nach dem anderen mit einem Lächeln. »Das Handwerk habt ihr geschafft, nun kommt die Magie. Als ich so alt war wie ihr, war das mein liebster Moment: die Träume, die ich erdacht und gemalt habe, auferstehen zu lassen.«
Neben Lyra schmunzelte Yivie glücklich, und auch die meisten ihrer Mitschüler machten erwartungsvolle Gesichter, während Lyras Magen grummelte, als hätte sie etwas Falsches gegessen. Sie bezweifelte stark, dass der Schmetterling, den sie gezeichnet hatte, große Ähnlichkeit mit dem aus ihrer Vorstellung hatte, und noch mehr, dass sie es schaffen würde, ihn vom Papier zu lösen.
»Nehmt eure Lupen«, forderte Miss Elsgeroth alle auf.
Die Lupen waren etwa so groß wie eine Handfläche und aus dünnem Kristall hergestellt. Die Oberfläche war so geschliffen, dass sie das Licht einfing und zu einem glitzernden Strahl bündelte. Richtete man diesen auf die Traumzeichnung, während man sich auf sein Traumbild konzentrierte, löste sich die Sternentinte vom Papier und verwandelte sich in einen wahr gewordenen Traum, am Leben erhalten durch die Kraft der Gedanken. Durch die Magie der Fae.
Zumindest sollte das theoretisch passieren. Praktisch hatte Lyra es bis heute kein einziges Mal geschafft, mehr als einen undefinierbaren Klecks mit Flügeln vom Papier zu lösen, der mit viel Fantasie eine Hummel hätte sein können.
Yivie streckte ihre Hand nach Lyra aus. »Du schaffst das«, flüsterte sie und drückte ihre Finger.
War Lyras Nervosität so offensichtlich?
»Danke.« Sie atmete tief ein und ergriff die Lupe. Wenn sie ihre Zweifel beiseiteschob und fest genug an ihre Fähigkeiten glaubte, vielleicht würde es dann endlich gelingen.
»Achtet auf die Haltung eurer Lupen. Das Licht muss in einem schiefen Winkel auf das Kristallzentrum treffen. Wenn es sich bricht und ihr an den Rändern winzige Punkte seht, wie die Miniaturabbildung eines Regenbogens, dann habt ihr es richtig gemacht«, wies Miss Elsgeroth ihre Schüler an.
Lyra bemühte sich, die Lupe in der idealen Höhe, etwa zwei Handbreit über der Tischplatte, und in dem von Miss Elsgeroth beschriebenen Winkel zu halten. Als die ersten Regenbogenpunkte wie Ameisen vom Zentrum der Kristallluppe zu den Rändern krochen, presste sie die Lippen aufeinander. Gebündeltes Licht strahlte vom Kristallglas auf ihr Blatt und brachte die Sternentinte dazu, stärker zu funkeln.
»Bitte«, murmelte sie so leise, dass niemand außer ihr selbst es hören konnte.
Mit zusammengezogenen Augenbrauen starrte sie auf das Licht und die glitzernde Tinte. Die Naturmagie der Fae war wie die Luft. Sie hüllte einen ein, und wenn man sich ihr öffnete, würde man sie fühlen. Wie das Streicheln eines Windhauchs. Oder Gischt, die um Fußknöchel schwappt. Wie der Tanz von Schatten und Sonnenlicht auf der Haut. Man musste sich von der Magie lenken lassen – nicht umgekehrt.
Sie wollte sich öffnen, ja wirklich, aber je mehr sie versuchte, offen und frei zu sein, desto stärker verkrampften sich ihre Finger um den Griff der Lupe. Erst als ihre Zähne knirschten, merkte sie, wie fest sie diese aufeinandergepresst hatte.
Als es neben ihr raschelte, schaute sie zu Yivies Platz. Dort löste sich eine Gestalt vom Papier. Filigrane Linien glitzerten in der Luft und formten die Silhouette eines Vogels, der einige Zentimeter in die Höhe schwebte und dort seine Flügel spannte. Yivies Traumvogel war ein kleines Kunstwerk mit so vielen Details, wie Lyra sie noch nie bei einer Traumzeichnung in ihrer Klasse gesehen hatte. Sie erkannte einzelne Federn genauso wie die feingliedrigen Krallen, die der Vogel krümmte, als wollte er die Beweglichkeit seiner Glieder testen. Seine Schwanzfedern mündeten in fühlerartigen Ausläufen, an deren Enden Blüten baumelten. Das durchscheinende Tier war wunderschön.
»Toll, Yivie«, lobte die Lehrerin. »Nun, wo du dein Traumwesen heraufbeschworen hast, halt es fest. Lass es tanzen, lass es sich verwandeln. Hauch ihm Leben ein.«
Und Yivie tat wie ihr geheißen. Der Vogel flatterte höher und drehte eine Runde um Lyras Kopf, bevor er sich auf Miss Elsgeroths Schulter niederließ.
Kichern und aufgeregtes Flüstern drangen von der gegenüberliegenden Seite des Klassenzimmers. Bestimmt waren ihre Mitschüler genauso fasziniert wie Lyra von Yivies Kreation. Doch als sie aufschaute, bemerkte sie, dass dort drüben zwei weitere Mädchen es geschafft hatten, ihre Traumwesen vom Papier zu lösen. Über den Tisch von Meinel, einer sommersprossigen Mitschülerin mit kurzen rötlich-braunen Haaren, lief eine durchscheinende Maus. Vor ihrer Sitznachbarin flatterten glitzernde Libellen.
Na, wunderbar. Lyra wusste, dass sie sich für die anderen freuen sollte, doch in Wahrheit führte deren Können ihr umso mehr vor Augen, wie wenig Talent sie selbst hatte. Auf gar keinen Fall wollte sie – wieder einmal – die Einzige sein, die ihr Traumwesen nicht vom Papier bekam.
Sie schloss die Augen und versuchte, die Geräusche um sich herum so gut wie möglich auszublenden. In einer ihrer Übungsstunden hatte Yivie Lyra ihren persönlichen Trick erklärt: Sie hüllte sich mit Erinnerungen an Momente ein, in denen sie frei und glücklich gewesen war, um die Fae-Magie zu kanalisieren. Also wollte Lyra dasselbe probieren. Sie dachte an den Geruch von frischem Apfelkuchen, der im Herbst durch ihre Küche wehte. An das Rascheln von Blättern, wenn der Wind durch die Krone des Heilrath-Baums fuhr, während sie auf einem der höchsten Äste saß. Sie stellte sich vor, wie sie sich rücklings ins kalte Wasser der Rothsee-Ache hinter ihrem Elternhaus fallen ließ, wie ihre Glieder erst eiskalt und dann heiß wurden und wie ihre Haare unter Wasser um ihr Gesicht tanzten.
Ein sanftes Kribbeln breitete sich von ihrem Nacken aus und wanderte über ihren Hals bis in die Wangen. Es fühlte sich wie ein warmes Streicheln an, wie federleichte Küsse auf Lyras Haut. Das war es, das unverwechselbare Gefühl der Fae-Magie!
Vorsichtig lugte sie unter ihren halb geschlossenen Augenlidern hervor. Die Sternentinte glitzerte stärker als zuvor. Zwei, nein, drei Linien lösten sich vom Papier und schwebten langsam im Schein des Kristalllichts. Innerlich jubelte sie auf – es klappte!
Das Kribbeln in Lyras Wangen wurde stärker und wanderte in ihre Schläfe. Wärme breitete sich in ihrem Kopf aus, während immer mehr Linien aufstiegen. Zwar verschwommen und wackelig, doch die Umrisse der Schmetterlingsflügel waren deutlich zu erkennen – zumindest deutlicher als das undefinierbare Hummel-Traumtier bei Lyras letztem Versuch.
Plötzlich fuhr heißer Schmerz in ihre Stirn. Die Wärme, die bis eben hinter ihrer Stirn geprickelt hatte, explodierte, als hätte jemand ihr ein glühendes Messer in den Schädel gerammt. Sie stieß die Luft aus und ließ die Luppe fallen, die mit einem lauten Klock auf ihrer Tischplatte landete. Stöhnend lehnte Lyra sich nach vorne und drückte die Finger auf ihre Stirn. Aber es half nichts. In ihrem Kopf pochte die Hitze so heftig, als stünde ihr Schädel kurz davor zu explodieren.
»Lyra? Was ist los mit dir?«
Sie spürte eine Berührung an ihrer Schulter, als Yivie sich neben ihr niederkniete. Ihre Freundin wollte Lyras Kopf hochziehen, doch die drückte ihre Stirn auf die Tischplatte.
»Sag doch was«, flehte Yivie.
Lyra presste die Zähne zusammen, denn nur so konnte sie sich daran hindern, laut loszuschreien.
»Was ist passiert?«, hörte sie Miss Elsgeroths Stimme. Kurz darauf nahm sie auch deren Hand auf ihrem Rücken wahr. »Atme tief und ruhig, Lyra«, sagte die Lehrerin.
Wärme ging von ihrer Handfläche aus. Sie murmelte etwas. Einen Heilungszauber? Die Schmerzen waren zu groß, als dass Lyra einen klaren Gedanken fassen könnte. Langsam ebbte die Hitze ab, das Pochen hinter ihrer Stirn wurde leichter. Nach einigen Atemzügen schaffte sie es, die Augen zu öffnen und sich mit Yivies Hilfe aufzusetzen.
Ihre Lehrerin bedachte sie mit einer besorgten Miene, die Lyra eine Gänsehaut verursachte. Instinktiv zog sie den Kopf ein. Da lag etwas in Miss Elsgeroths Augen – Vorwurf? Oder Angst? Lyra konnte es nicht zuordnen, wusste nur, dass sie sich unter dem Blick ihrer Lehrerin am liebsten selbst in ein durchscheinendes Traumwesen verwandelt hätte.
»Das ist genug für heute«, sagte Miss Elsgeroth schließlich, löste sich von Lyra und wandte sich an die Klasse. »Packt eure Sachen. Wir alle haben uns eine Pause verdient. Ihr habt das gut gemacht. Ihr werdet sehen, bald schon werdet ihr ganze Träume erschaffen.«
»Soll ich mit Lyra zur Krankenstation gehen?«, fragte Yivie.
»Nein!« Miss Elsgeroths Antwort klang scharf. Ihre Lippen bildeten eine schmale Linie, als sie langsam den Kopf schüttelte, und wieder überkam Lyra das dringende Bedürfnis, sich unsichtbar zu machen.
»Bring Lyra nach draußen. Die frische Luft und die Nähe zur Natur sollten helfen. Wenn so etwas wieder passiert, Lyra, dann komm zu mir.«
Sie nickte den Mädchen entschieden zu, bevor sie sich umdrehte und zu ihrem Pult schritt. Langsam löste sich die Beklemmung von Lyra. Ein paar Herzschläge lang beobachtete sie den Rücken ihrer Professorin, dann atmete sie durch. Yivie zuckte die Schultern. Sie schien über Miss Elsgeroths Anweisung ebenso verwirrt zu sein wie Lyra. Ihre Lehrerin sah nicht auf, als die Mädchen den Klassenraum verließen.
Lyra saß im Schatten eines Kirschbaums, einen Stapel feinen Seidenpapiers auf den Oberschenkeln. Ihre Kopfschmerzen hatten mittlerweile nachgelassen. Geblieben war ein dumpfer Druck hinter der Stirn.
Glücklicherweise war der Magie-Unterricht für heute überstanden. Die Fae-Schüler saßen nun im Garten der Akademie, verstreut unter mehreren Bäumen, die an diesem heißen Tag wohltuenden Schatten spendeten. Sie verbrachten die letzten beiden Stunden damit, Papierblumen für das bevorstehende Fest der Einigkeit zu falten. An diesem Tag tanzten die Fae- und Menschenmädchen, geschmückt mit Blumenkränzen, Seite an Seite, um den Beginn der warmen Jahreshälfte und gleichzeitig das hundertjährige Jubiläum des Kriegsendes zu zelebrieren.
Mehr als drei Jahrzehnte lang hatten sich die Menschen und Fae im sogenannten Purpurnen Krieg bekämpft. Tausende waren ums Leben gekommen und der gesamte Kontinent hatte gebrannt. Seit dem Kriegsende lebten Menschen und Fae friedlich nebeneinander – und wenn das keinen Anlass zu einer Feier bot, was dann?
Weil die Fae aus Prinzip keine lebenden Pflanzen abschnitten, mussten die Schüler Blumen aus buntem Seidenpapier falten. Eine Aufgabe, die es Lyra erlaubte, ihre Gedanken schweifen zu lassen – auch wenn diese immer wieder zu ihren Kopfschmerzen wanderten, ganz egal wie sehr sie an etwas Erfreulicheres denken wollte.
Seufzend legte sie den Kopf in den Nacken und schloss für ein paar Sekunden die Augen. Sie horchte auf das Rascheln des dünnen Papiers, auf das feine Flattern von Vogelflügeln und auf den Wind, der mit den Blättern des Kirschbaums spielte. Magie, dachte sie. Alles Leben, jedes Geräusch, selbst die Luft war erfüllt von der unsichtbaren Fae-Magie. Umso ärgerlicher war es, dass Lyra nicht in der Lage war, diese magischen Partikel zu kanalisieren. Warum, wenn sie doch überall waren?
Und schon wieder keimte dieser unangenehme Gedanke auf: Vielleicht stimmt irgendetwas nicht mit mir. Was, wenn ihr Kopf einfach nicht für Fae-Magie gemacht war und der Versuch, ebendiese zu wirken, ihre Stirn auch in Zukunft zum Explodieren bringen würde? Wie sollte sie da jemals eine Vogelweberin werden?
Lyra ballte ihre Hände zu Fäusten und die Papierblume in ihrer Hand knisterte. Schnaubend öffnete sie die Augen. Es hatte ja doch keinen Sinn, sich den Sorgen hinzugeben. Als sie die Finger öffnete, rieselten die Fetzen der zerstörten Papierblume zu Boden.
»Gut gemacht, Lyra. Jetzt schaffst du es nicht einmal mehr, Papier zu falten«, schalt sie sich selbst. Sie schnappte sich ein neues Blatt Seidenpapier und legte die Ecken vorsichtig aneinander. Ganze fünf Sekunden konnte sie ihre Konzentration bündeln, dann flatterte ein Vogel, gerade Mal so lang wie ihr Daumen und in allen Farben des Regenbogens schillernd, an ihr vorbei. Eine Fae-Kreatur, geschaffen durch die Magie der Vogelweber. Lyra folgte dem winzigen Tier mit dem Blick. Es glitt in einem Halbkreis über die Schüler und ließ sich schließlich vom Wind bis über die Dächer der Akademie tragen.
Die reinweiße Fassade der Akademie für Fae-Magie glänzte im Sonnenlicht, ihre Türme reckten sich wie ausgestreckte Arme in den Himmel und waren miteinander durch ein Netz aus Brücken und Ringbögen verbunden. Alle Fae-Akademien waren so konstruiert, dass sie Naturmagie begünstigten, indem sie die Elemente – Luft, Wasser, Erde und Licht – in ihre Architektur integrierten.
So zogen sich zahlreiche mannshohe Fenster über die Fassade, viele davon geöffnet, um Licht und Luft ins Innere zu lassen. Am südwestlichen Rand des Gebäudes, gleich neben dem Eingangstor, befand sich ein See, dessen Wasser so klar war, dass man bis zum Grund und in die unterirdischen Klassenräume schauen konnte, die zur Seeseite hin eine Fensterfront hatten.
An ihrer Rückseite grenzte die Akademie an den Wald, dessen Bäume in die Gemäuer hineinzuwachsen schienen. Diese Art der Architektur war für alle Fae-Gebäude üblich. Anstatt Bäume zu fällen oder Säulen zu errichten, nutzte man die Kraft von lebenden Stämmen, um Wände oder sogar Decken zu halten, und die Fae-Bauten wuchsen, atmeten und formten sich mit den Bäumen. Stein und Äste gingen ineinander über, an manchen Stellen wanden sich neue Zweige aus dem Gemäuer heraus.
Von der Akademie ließ Lyra ihren Blick zu der Gruppe Schüler wandern, die in Verkleidung auf dem Vorplatz standen und ihr Schauspiel für das Fest der Einigkeit probten. Eine davon war Yivie, die einen langen Umhang trug und einen Schild in der Hand hielt. Sie spielte eine Fae-Kämpferin. Eine Rolle, die ihr unfreiwillig in den Schoß gefallen war. Ihre Leidensmiene, wann immer sie an der Reihe war, ihren Text aufzusagen, war ziemlich komisch. Aus Solidarität gab Lyra sich Mühe, nicht allzu offensichtlich zu lachen, was ihr mehr schlecht als recht gelang.
Theatralisch riss Yivie beide Arme in die Höhe und verkündete: »Drei Jahrzehnte! So lange schon brennt ihr unsere Wälder nieder, so lange schon tötet ihr Bäume und zerstört unsere Häuser.«
Eigentlich sollte sie dabei vor Wut sprühen, doch ihr Gesichtsausdruck war eine Mischung aus Scham und Selbstmitleid. Kayla, eine zwei Jahre jüngere Mitschülerin in der nachgemachten Rüstung der Menschen, stellte sich ihr gegenüber, richtete ihr hölzernes Schwert auf Yivie und tönte: »Und ihr?! Ihr wähnt euch in Unschuld, dabei verwüstet ihr unsere Siedlungen seit ebenso langer Zeit! Ihr verflucht unsere Ernten und lasst das Saatgut verfaulen!« Ihre Stimme bebte vor Zorn. Die letzten Worte spuckte sie beinahe aus. Kein Zweifel, Kayla blühte in der Schauspielgruppe regelrecht auf. Ein Zittern ging durch ihren Arm, als sie hinzufügte: »Ihr sagt, eure Magie stamme aus der Natur. Aber in Wirklichkeit ist sie pure Dunkelheit!«
Auf sein Stichwort hin schlich ein junger Fae in einem dunklen Umhang heran. Den Kragen hatte er so hoch geschlagen, dass er seinen Mund und seine Nase verdeckte. Auf dem Kopf trug er künstliche Hörner wie die einer Kuh. Er stellte einen Helya dar. Die gehörnten Fae hatten die Kämpfe damals maßgeblich angeführt und waren für ihre Magie gefürchtet.
»Hah«, stieß er aus. »Ihr Menschen habt Angst vor der läppischen Naturmagie? Seht, was meine Hörner mit euch anrichten, und zittert!«
Lyra musste schmunzeln. Der gehörnte Schauspieler war einen halben Kopf kleiner als Yivie und Kayla, schmächtig und mitten im Stimmbruch. Er hätte kaum weniger furchteinflößend sein können, dabei sollte er den gefürchtetsten Kämpfer darstellen. Denn die gehörnten Fae schlugen damals dort zu, wo so die tiefsten und nachhaltigsten Wunden hinterließen. Bei den Gefühlen ihrer Gegner. Sie allein waren in der Lage, Emotionsmagie zu wirken und ihre Gegner in den Wahnsinn zu treiben, indem sie diese Angst oder Zweifel fühlen ließen, ihren Schlaf mit Albträumen füllten, schmerzhafte Erinnerungen hervorholten oder Halluzinationen in ihre Köpfe projizierten.
Der Helya-Schauspieler stellte sich zwischen Yivie und Kayla, reckte den Hals und sagte: »Wir werden in eure Träume eindringen und sie mit Bildern von Schmerz und Tod füllen. Wir werden euch eine nie gekannte Angst spüren lassen, bis ihr zitternd zu unseren Füßen liegt. Euren Verstand werden wir auseinanderbrechen und falsch wieder zusammensetzen, bis ihr nicht mehr wisst, wer ihr seid und gegen wen ihr kämpft. Ihr werdet eure Brüder und Schwestern angreifen, werdet eure eigenen Häuser niederbrennen, den Feind in euren Freunden sehen. Ihr werdet euch selbst zerstören – und ihr werdet es nicht einmal wissen.«
Der Junge warf Miss Rovenigh, der Leiterin der Schauspieltruppe, einen Hilfe suchenden Blick zu. Diese wedelte mit den Händen, um ihn zum Weitermachen zu ermutigen. Lyra sah den Helya-Schauspieler seufzen, bevor er den rechten Arm in die Luft streckte und einen Zornesschrei ausstieß, der mehr nach dem Quietschen einer rostigen Tür klang.
Daraufhin liefen drei weitere Schüler heran. Alle ganz in Schwarz gekleidet und mit langen schwarzen Stoffbahnen in der Hand. Sie rannten um Yivie, Kayla und den Helya-Jungen herum, die eigentlich in Panik geraten und angsterfüllt wirken sollten, mit Ausnahme von Kayla aber vor allem erleichtert zu sein schienen, dass die Probe zu Ende ging. Nach mehreren Runden hatten die schwarzen Wirbelwinde die Schauspieler mit ihren Stoffbahnen eingehüllt und knieten sich mit gesenkten Köpfen nieder.
Nun trat die Schauspielleiterin, Miss Rovenigh, selbst vor die Truppe und schlug das Geschichtsbuch auf, aus dem sie rezitierte: »Die Magie der Helya wurde so übermächtig, dass sie sich von der Kontrolle der Helya loslöste, von der Kontrolle aller Wesen, um als eigenständige Macht das Land heimzusuchen. Die Menschen nannten diese schwarze Magie den ,Aether‘, die Fae nannten sie den ,Helyedith‘. Den Hass der Helya.«
Die letzten Worte flüsterte sie bloß, während sie die Schüler im Garten der Akademie, die Blumen falteten oder Zauberei übten, einen nach dem anderen mit einer ernsten Miene bedachte. Lyra wandte ihre Aufmerksamkeit wieder dem Seidenpapier zu und zog die Faltlinie mit den Fingern nach. Obwohl Miss Rovenighs Stimme jedes Wort in einen Vorboten des Unheils verwandelte, berührte Lyra ihr Text nicht. Die Geschichte rund um den Hass der Helya hatte sie schon zu viele Male gehört, um sich von ihr noch Angst einjagen zu lassen. Um ehrlich zu sein – und auch wenn sie es niemandem gegenüber zugeben würde – fand Lyra eine gewisse Schönheit in den Legenden rund um diese dunkle Ausprägung von Magie.
Sie hatte von monströsen Gestalten gehört, die sich aus den Wolken lösten und Menschen sowie Fae angriffen. Von Seen und Flüssen, die besessen vom Aether Schiffe auf den Grund rissen. Von Vögeln, die sich von Blutdurst getrieben auf alles Lebende stürzten, und von Bäumen, die ein Eigenleben entwickelten und mit ihren Wurzeln Menschen erdrosselten.
Es waren Geschichten voller Grausamkeit. Voller Tod und Angst und Gefahr. Aber auch Geschichten von einer Magie, so groß und andersartig, dass sie Lyra mit Faszination erfüllten.
»Das rote Blut der Menschen und das blaue Blut der Fae tränkte alle Flüsse des Landes und färbte sie purpurn«, fuhr Miss Rovenigh fort. In einer ausholenden Armbewegung zog sie einen Kreis in der Luft. »Es hätte das Ende sein können. Das Ende der Fae. Das Ende der Menschen. Ja, selbst das Ende der Helya, die keine Kontrolle mehr über den Helyedith hatten. Der Untergang unseres Landes Turmalin. Doch es kam anders, denn die Menschen und Fae begriffen, dass sie nur gemeinsam eine Chance gegen den Hass der Helya hatten.«
Langsam trat sie zur Seite und gab den Blick auf Yivie und ihre Schauspiel-Kollegen frei, die sich unter dem schwarzen Stoff herausschälten. Gleich würden sie vorführen, wie sie sich vereint gegen den Aether stellten und ihn in einer Mauer aus magisch aufgeladenem Stahl einschlossen. Den Jungen mit den Kuhhörnern würde sie in den Untergrund verbannen, wie es vor hundert Jahren mit den Helya geschehen war.
Yivie schüttelte gerade ein Stück Stoff ab, das sich hartnäckig um ihre Hüfte gewickelt hatte, als das Eingangstor zum Akademiegelände krachend aufflog. Eine Kutsche preschte hindurch und die Einfahrt entlang. Der Portier lief ihr mit wehenden Händen hinterher, doch der Kutscher trieb die Pferde an, schneller zu laufen. Zwei Schüler schafften es gerade noch, sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit zu bringen, sonst wären sie niedergetrampelt worden. Kurz vor der Akademie blieb die Kutsche ruckelnd stehen.
Miss Rovenigh stellte sich mit ausgestreckten Armen vor ihre Schauspieltruppe. Zwei Mädchen, die neben Lyra im Gras gesessen und Seidenblumen gefaltet hatten, erhoben sich und gingen ein paar Schritte zurück, genauso wie einige andere Fae-Schüler im Garten der Akademie. Instinktiv schienen alle zu wissen, dass die Kutsche und ihre Insassen Ärger bedeuteten.
Lyra rappelte sich hoch und ging vorsichtig auf die Kutsche zu, deren Fenster verhängt waren. Sie war eher von Neugierde als Angst erfüllt. Die Pferde schnauften schwer, ebenso wie der Kutscher, dessen riesenhafte Gestalt in einen schwarzen Mantel gehüllt war und dessen Brustkorb sich sichtbar hob und wieder senkte. Er hatte kakaofarbene Haut und einen kahl geschorenen Schädel in der Form einer Aubergine. Über seine rechte Wange zog sich eine rosafarbene Narbe, wulstig und dick wie eine verfressene Larve.
Er machte die Zügel fest und erhob sich. Im Stehen wirkte er sogar noch mächtiger. Sein Bauch hatte den Umfang eines Weinfasses, und vermutlich hätte er sogar Miss Elsgeroth um eine halbe Kopflänge überragt. Trotz seiner massiven Statur wirkten seine Bewegungen geschmeidig, als er sich nach vorn lehnte und einem der Pferde sanft den Hals tätschelte.
Lyra war so fasziniert von seinem Anblick, dass sie ihn unverhohlen anstarrte. Erst als er vom Kutschbock sprang und sich an ihr vorbeidrückte, wich sie zurück. Er öffnete die Kutschtür, woraufhin ein zweiter Mann, ebenfalls in einem dunklen Mantel, rückwärts ins Freie trat. Seine hellen Haare waren am Hinterkopf unordentlich platt gedrückt und glänzten im Sonnenlicht silbrig mit einem rosafarbenen Schimmer. Eine solche Farbe hatte Lyra noch nie bei jemandem gesehen, weder bei Fae noch bei Menschen. Doch als er sich halb umdrehte, verflog jeder Gedanke an Haarfarben.
In den Armen hielt der Mann ein Fae-Mädchen, dem Aussehen nach höchstens sieben oder acht Jahre alt, dessen Arme und Dekolleté von Schnitten übersät waren. Ihre Bluse war blutdurchtränkt und auch einige Haarsträhnen hatten sich vom Blut blau verfärbt. Die Lippen der Kleinen zitterten. Ihre Augen waren geöffnet, doch ihre Pupillen zuckten ziellos von einer Seite zur nächsten, und ihre Wimpern flatterten, als sei sie völlig weggetreten.
Plötzlich flammte Schmerz in Lyras Kopf auf. Sie krümmte sich zusammen, sog scharf die Luft ein und presste sich beide Handflächen auf die Stirn.
Als der Mann mit dem Silberhaar sie bemerkte, trat ein überraschter Ausdruck auf sein Gesicht, seine Augen weiteten sich – und Lyras Herz setzte einen Atemzug lang aus. Er sah jung aus, kaum älter als zwanzig Jahre, war bartlos und hatte einen geraden Nasenrücken. Ein Schatten lag unter seinen Augen, als hätte er seit langer Zeit nicht mehr geschlafen. Und ebendiese Augen waren es, die Lyras Herzschlag zum Stolpern brachten. Denn sie waren so dunkel wie der Himmel in einer mondlosen Nacht. Pupille und Iris gingen nahtlos ineinander über.
Sie waren schwarz wie Moore.
Dieselbe Farbe wie Lyras Iriden.
Für einen flüchtigen Moment, kaum eine Sekunde lang, kam es ihr so vor, als schaute sie in ihr eigenes Spiegelbild und versinke gleichzeitig in einem Moorsee. Sie fühlte eine eigenartige Ruhe, die sich von ihren Wangen bis in die Stirn ausbreitete, und der Schmerz ebbte ab, ganz ähnlich, wie es unter Miss Elsgeroths Berührung geschehen war.
Der junge Mann öffnete den Mund, als wollte er etwas sagen. Dann schüttelte er jedoch unmerklich den Kopf und presste die Lippen aufeinander.
In diesem Augenblick flog das Eingangstor zur Akademie auf. Miss Elsgeroth und zwei der Heilerinnen rauschten heraus. Sofort wandte der Mann mit den rötlich schimmernden Silberhaaren sich von Lyra ab und lief auf die beiden zu. Zwei weitere Fae, ein Mann und eine Frau, deren Gesichter unter Kapuzen verborgen waren, sprangen ebenfalls aus der Kutsche und eilten hinter ihm her. Miss Elsgeroth legte beide Hände auf die Wangen des blutenden Kindes, sagte irgendetwas, jedoch zu leise, als dass Lyra es verstehen konnte, und dirigierte den Mann mit dem verletzten Mädchen sowie seine zwei Begleiter und die Heilerinnen nach drinnen.
Die Tore der Akademie schlossen sich hinter ihnen, und sofort war es, als erwache Lyra aus einem Traum. Der Schmerz in ihrer Stirn und das merkwürdige Gefühl, das sie beim Blick in die dunklen Augen des Mannes empfunden hatte, hingen noch in der Luft. Ansonsten kehrte alles binnen weniger Herzschläge zur Normalität zurück. Ein paar Fae-Vögel flatterten an der geschlossenen Tür vorbei. Im Teich vor der Akademie streckte eine Ente ihren Hintern in die Luft und fischte nach Futter. Auch die Schüler wagten es wieder, sich zu bewegen.
Wäre da nicht die Kutsche, die wie ein Mahnmal im Vorhof stand, hätte man meinen können, dass die Szenen der letzten Sekunden nicht mehr waren als ein bloßer Albtraum.
Der Kutscher ergriff die Zügel und führte die Pferde in Richtung der Stallungen der Akademie. Sein Gang war gemächlich, als hätte er alle Zeit der Welt.
Lyra schaute ihm nach, bis er hinter einer Reihe von Bäumen verschwunden war.
2. Wasserseide
Normalerweise genoss Lyra die exotischen Gerüche, die sie von Orten fernab von Eilesruth träumen ließen, doch heute wurde ihr mit Ingwer, Cayenne und Kurkuma in der Nase beinahe übel. Das Zaubertraining und der hartnäckige Kopfschmerz hatten sie ausgelaugt.
Yivie und sie befanden sich auf dem Heimweg von der Akademie und gingen gerade durch das Händlerviertel, in dem bunte Tücher und Gewürze dargeboten wurden. Die meisten Händler hatten vor ihren Läden Tische mit Waren aufgebaut oder die Fenster weit geöffnet, manche feilschten bereits mit den ersten Kunden, um möglichst viele Kupferlinge einzunehmen. Obwohl heute das perfekte Wetter für einen Bummel durch die Stadt war – die Sonne stand hoch am strahlend blauen Himmel, trotzdem war es nicht zu heiß, da ein Lüftchen wehte –, war relativ wenig los, sodass die Händler sich Zeit nahmen, um mit ihren Kunden zu plaudern.
Yivie hatte darauf bestanden, Lyras Tasche zu tragen, und warf ihr immer wieder besorgte Seitenblicke zu, die Lyra vehement ignorierte.
»Ich würde zu gerne wissen, was es mit dieser Kutsche auf sich hat«, sagte Yivie zum dritten Mal, seit sie die Akademie verlassen hatten.
Und wie die beiden Male zuvor antwortete Lyra schmunzelnd: »Ich auch.«
»Ja, aber du hast die Reisenden wenigstens gesehen. Den Kutscher, den Kerl mit den rosa Haaren und das Mädchen.« Sie schüttelte mit hochgezogener Nase den Kopf. Die Erinnerung an das blutende Mädchen schien sie mit Grauen zu erfüllen, dabei hatte Yivie höchstens einen blaugetränkten Ärmel erspäht, und Lyra hatte darauf geachtet, ihre Beschreibung des Mädchens nicht allzu sehr auszuschmücken. Schließlich wusste sie, dass ihrer besten Freundin schon beim Anblick eines einzelnen Blutstropfens schwarz vor Augen wurde.
»Denkst du, das waren Verbrecher?«, fragte Yivie.
»Wie kommst du denn darauf?«
»Ich weiß nicht. Es ist merkwürdig, oder? Dass sie ein so schwer verletztes Mädchen in die Akademie bringen und nicht in ein Krankenhaus. Und auch, wie sie sich alle vermummt haben, als müssten sie sich vor irgendwem verstecken.«
Was sie sagte, machte durchaus Sinn. Das harsche Eindringen, die Aggressivität, mit welcher der Kutscher die Pferde über den Hof getrieben hatte, oder auch das wortlose Verschwinden der Fremden sprachen für Yivies Theorie. Dazu ihre Kleidung: lange, dunkle Mäntel und im Falle des Paars aus der Kutsche Kapuzen bis tief in die Stirn gezogen. Lyra wunderte sich, warum ihr dieser Gedanke nicht selbst gekommen war.
»Denkst du denn, dass Miss Elsgeroth ihnen geholfen hätte, wenn sie Verbrecher wären?«, fragte sie.
Zur Antwort zog Yivie eine Augenbraue in die Höhe. »Miss Elsgeroth scheint mir eine Frau mit vielen Geheimnisse zu sein.«
»Schon möglich«, murmelte Lyra.
Obwohl sie den Vorfall in der Akademie nicht mehr aus dem Kopf bekam, sträubte sich etwas in ihr dagegen, mit Yivie über die Kutsche und deren Insassen zu spekulieren. Dieser Moment, als der Mann mit den Silberhaaren sie anschaute, hatte irgendetwas mit ihr angestellt. Etwas verändert – tief in Lyras Innerem. Seine dunklen Mooraugen, die den Schmerz in ihrer Stirn vertrieben und sie eine tiefe Ruhe hatten empfinden lassen. Eine Verbundenheit. Und auch wenn sie wusste, dass es vollkommen widersinnig war, fühlte es sich auf merkwürdige Art so an, als teilte sie ein Geheimnis mit ihm. Eines, von dem sie nicht einmal wusste, was es war. Nur, dass sie es mit niemandem sonst teilen wollte – nicht einmal mit ihrer besten Freundin.
Die beiden warteten, während eine Pferdekutsche mit zwei elegant gekleideten Damen an ihnen vorbeifuhr, ehe sie die Straße überquerten. In diesem Bereich des Händlerviertels wurden keine Gewürze mehr, sondern Haarbänder, Blumen und Porzellan ausgestellt.
»Wie geht es dir?«, fragte Yivie, die Lyras Schweigen als Zeichen interpretiert haben musste, dass diese wieder Schmerzen hatte.
»Schon besser«, log sie.
Dabei spürte sie noch immer einen unangenehmen Druck in der Stirn, und sie war erschöpft, als hätte sie die ganze Nacht auf dem Feld gearbeitet.
»Traumzeichnen ist wohl einfach nichts für mich«, fügte sie hinzu. Von der zweiten Schmerzwelle beim Anblick des verletzten Mädchens hatte sie Yivie nichts erzählt.
»Beim nächsten Mal funktioniert es bestimmt.«
Lyra zuckte die Schultern. Sie hätte zu gerne das Thema gewechselt, doch so leicht gab Yivie keine Ruhe. Natürlich nicht. Sie war eine herzensgute Fae. Eine, die für ihre Freunde nur das Beste wollte und ihnen Mut zusprach – und das so häufig und vehement, dass es Lyra manchmal zu viel wurde.
»Du wirst sehen, das viele Üben zahlt sich bestimmt bald aus.«
»Bestimmt«, murmelte Lyra, womit sie Yivie ein verzweifeltes Seufzen entlockte.
»Du hattest dich doch so darauf gefreut, die Fae-Magie zu lernen!«
Das stimmte. Seit Lyra als kleines Mädchen beobachtet hatte, wie ein Fae-Magier echte Vögel aus Nektarfasern webte und ihnen mit Kristalllicht Leben einhauchte, träumte sie davon, selbst eine Vogelweberin zu werden. Ihrem ersten Schultag hatte sie mit hitziger Ungeduld entgegengefiebert und Yivie überredet, mit ihr Rollenspiele aufzuführen, bei denen Yivie ein Luftgeist und Lyra eine mächtige Fae-Magierin war.
Damals wusste sie allerdings noch nicht, was für eine miserable Schülerin sie sein würde. Obwohl sie doppelt so viel übte wie Yivie, brachte sie nicht einmal das Traumzeichnen zustande, die einfachste Art, etwas Leblosem Atem einzuhauchen, und sei es nur für wenige Sekunden. Wie sollte sie da jemals echtes Leben schaffen?
»Fandest du Miss Elsgeroths Reaktion nicht auch merkwürdig?«, wechselte Yivie das Thema, und plötzlich wünschte Lyra, sie könnten doch noch etwas mehr über ihr fehlendes Talent für Fae-Magie sprechen.
Die Erinnerung an Miss Elsgeroths Miene ließ Lyras Stirn kribbeln und es steigerte sich zu einem schmerzhaften Pochen. Lyra presste die Augen zusammen und sog die Luft ein. Zum Glück war Yivie zu sehr damit beschäftigt, über Miss Elsgeroths Verhalten nachzudenken, um etwas zu bemerken.
»Wieso soll ich nicht mit dir zum Arzt gehen?«, fragte sie. »Und wie sie dich angeschaut hat! Als ob sie Angst davor hätte, dass du es trotzdem machst.«
Oder Angst davor, was der Arzt herausfinden würde.
»Bestimmt bildest du dir das nur ein«, erwiderte Lyra, denn um ehrlich zu sein, war sie sich nicht sicher, ob sie wissen wollte, was Miss Elsgeroths merkwürdiges Verhalten bedeutete.
»Erst das und dann behandelt sie ein verletztes Mädchen in der Akademie, anstatt es ins Krankenhaus zu schicken und ...«
Lyra unterbrach sie: »Schau, die Pferdebahn kommt.«
Zwei Hengste in glänzend rotem Zaumzeug zogen im Zentrum der breiten Straße eine Bahn über die Schienen, die Platz für dreißig Passagiere bot. Es waren Ryal-Pferde aus den nördlichen Berglanden, die von den Ryalithen, den Erd-Fae, zum Transportieren von Steingütern oder für Ritte über die Bergkämme verwendet wurden. Die Tiere waren um ein Drittel größer als gewöhnliche Pferde und so kräftig, dass ihre Muskeln deutlich hervortraten. Trotzdem hatten sie vor Anstrengung Schaum vorm Maul und ihr Fell glänzte feucht.
»Sie tun mir leid«, murmelte Lyra.
»Es heißt, die Menschen entwickeln eine Bahn, die ohne Pferde fahren wird.«
Yivie zog beschwörend die Augenbrauen hoch. Dann sprang sie die Stufen in die Pferdebahn hoch und nickte dem Schaffner zu, der für sie seine Mütze lüftete. Alle Sitze waren bereits besetzt, sodass sie sich auf einen Platz am Rand stellte. Lyra folgte ihr.
»Wie soll das funktionieren, ohne Pferde?«
»Mit Elektrizität.«
»Ach so.« Davon hatte ihr Vater bereits erzählt, auch wenn seine Ausführungen weit weniger begeistert gewesen waren als Yivies. Aus seinem Mund hatte die Elektrizität mehr nach einer sinnlosen Erfindung geklungen, mit der die Menschen versuchten, etwas nachzuahmen, das die Fae mit ihrer Magie schon immer hatten bewerkstelligen können.
Yivie nickte jedoch aufgeregt. »Es heißt, damit können sie Licht erzeugen, Wasser erhitzen, Unbewegtes in Bewegung setzen. Mein Vater war vorletzte Woche für seine Geschäfte in Turmalinstadt, und er meinte, dass sie dort Straßenleuchten einsetzen, die ein gelbes Licht ausstrahlen.« Sie pausierte kurz, um sich an zwei breitschultrigen Herren mit Gehrock vorbeizudrängen.
Lyra versuchte derweil, sich die Straßen Turmalinstadts vorzustellen, die im gelben Licht leuchteten. Sie hatte gehört, dass die Hauptstadt voller hoher Backsteingebäude war, die so eng beieinanderstanden, dass manche Gassen selbst untertags im Schatten lagen. Ganz anders als Eilesruth, das sich, wie für Fae-Städte üblich, in die Natur einfügte und wo Häuserfassaden nahtlos in die Stämme der Heilrath-Bäume übergingen.
Ihr eigener Vater hatte die Hauptstadt als grau und beengend beschrieben, obwohl sie doch so riesig war. Kein Wunder, dass die Menschen in Turmalinstadt den Wunsch verspürten, ihre dunklen Straßen mit künstlichem Licht zu beleuchten. Doch das Mond- und Sonnenlicht, das die Fae in Kristallglas einfingen und mit dem sie die Gassen Eilesruths oder auch ihre Häuser und Wohnungen erhellten, war farblos. Gelbes Licht hatte in Lyras Vorstellung etwas Faszinierendes und gleichzeitig Bedrückendes.
Als die Pferdebahn ruckelnd losfuhr, schüttelte Yivie demonstrativ den Kopf. »Die Menschen haben uns schon immer um unsere Magie beneidet. Offenbar haben sie ihre eigene gefunden. Apropos Menschen, es scheint, als hättest du die Aufmerksamkeit von den jungen Männern dort drüben erregt.«
Unauffällig drehte Lyra ihren Kopf, um in die Richtung zu schauen, in die Yivie deutete. Im hinteren Bereich der Bahn saßen drei Jungen, etwa in ihrem Alter, und schielten zu ihnen herüber, während sie sich flüsternd unterhielten. Alle drei hatten Mützen auf dem Kopf und trugen braune Leinenhemden. Sie waren eindeutig Menschen. Das verriet ihre Kleidung, die in gedeckten Farben gehalten und schlicht war, während die Fae sich am liebsten in farbenprächtige Stoffe hüllten.
»Vielleicht meinen sie dich«, flüsterte Lyra.
»Bestimmt nicht.« Yivie grinste breit.
»Das kannst du nicht wissen.«
»Doch«, entgegnete sie. »Weil immer alle dich anschauen.«
»Das stimmt nicht.«
Es stimmte doch. Allerdings nicht, weil Lyra so blendend hübsch war – denn Yivie mit ihren dicken roten Zöpfen, ihrer zarten Milchhaut und ihren großen hellgrünen Augen war Lyra an Schönheit genauso überlegen wie an Magie-Talent. Der Grund dafür, dass Lyra mehr Blicke auf sich zog, war der, dass sie anders aussah.
Anders als die Menschen ihres Landes mit ihrer sonnengebräunten Haut und ihren holzfarbenen Haaren, aber auch anders als die Fae, von denen die meisten rötliche oder schwarze Haare hatten, und deren Augen so hell waren wie Flieder. Lyras Haare waren hellblond, fast weiß, ihre Augen dafür umso dunkler. Ihre Mutter meinte, sie seien braun. Yivie hatte einmal gesagt, sie hätten die Farbe des Nachthimmels. Aber eigentlich waren sie nur schwarz.
So wie bei dem jungen Mann mit den Silberhaaren.
Seit Jahren hielt Lyra Ausschau nach jemandem, der genauso aussah wie sie. Auf den Monatsmärkten von Eilesruth begegneten einem Händler oder Reisende aus anderen Ländern, deren Erscheinung sich ebenfalls von den typischen Turmalinen unterschied. Fae, deren Haut dunkler war, manchmal kaffeefarben, manchmal wie Sand. Ihre Haare waren blond oder braun oder blau oder violett. Sie brachten Geschichten von fernen Orten und von den Wundern, die dort zu finden waren. Von Tieren, denen Lyra noch nie begegnet war. Von Formen der Fae-Magie, die sie sich höchstens vorstellen konnte. Von Geschmäckern und Gesängen, die so anders waren als die Speisen und Klänge ihrer Heimat.
Sie liebte es, ihnen zu lauschen, und noch mehr liebte sie es, eingehakt bei Yivie über den Marktplatz zu laufen und all die Eindrücke in sich aufzusaugen. Doch selbst dort hatte Lyra nie eine Fae entdeckt, die ihr ähnelte. Denn sie alle – selbst die aus den entlegensten Winkeln der Welt – hatten helle Augen. Mal blau wie der Himmel an einem Sommertag. Mal grün wie der Frühling oder violett wie ein Amethyst. Grau oder braun oder gelb oder purpurn waren sie. Aber nie schwarz.
Das hieß, mit einer Ausnahme. Denn heute hatte Lyra zum ersten Mal in Augen wie die ihren geblickt.
»Tut mir leid. Habe ich dich geärgert?«, fragte Yivie, die Lyras Schweigen falsch deutete.
»Nein, gar nicht.«
»Ist es dein Kopf?« Wieder zeigte sie diese besorgte Miene.
Sie machte Anstalten, Lyras Stirn mit der Hand zu berühren, doch diese zuckte zurück. Was war heute nur mit ihr los, dass sie dermaßen empfindlich reagierte? Yivie schürzte überrascht die Lippen.
»Meinem Kopf geht es gut. Keine Sorge.«
»Gut«, murmelte Yivie, doch ihr Gesichtsausdruck verriet, dass sie Lyra keineswegs glaubte.
Zwei Stationen vor Lyras musste Yivie aussteigen. Zum Abschied drückte sie die Hand ihrer Freundin und bedachte diese mit dem gefühlt hundertsten besorgten Blick dieses Tages. Als die Pferdebahn weiterfuhr, winkte Lyra, bis Yivies kleiner werdende Gestalt irgendwann aus ihrem Sichtfeld verschwunden war.
Erst jetzt traute sie sich, auszuatmen und ihre Stirn in die Handfläche zu legen. Obwohl der Schmerz sich gelegt hatte, spürte sie noch immer ein Spannen unter der Haut, als säße dort eine winzige Kreatur, die sich ihren Weg in die Freiheit bahnen wollte.
Lyra presste die Lippen fest aufeinander und schüttelte den Kopf. Das war Blödsinn. Dieser Gedanke, ihre merkwürdige Angst. Die Unruhe, die sie seit Tagen verfolgte. All das war bloß ihre eigene Spinnerei. Sie musste aufhören, so nervös zu sein, musste die Sorgen vertreiben, dann würden auch die Kopfschmerzen weichen. Zumindest hoffte sie das.
Und so zwang sie sich, an nichts zu denken. Schaute nur auf die Fassaden, die an ihr vorbeiglitten, und auf die Passanten, die auf den Gehwegen spazierten, und als die Pferdebahn das Stadtzentrum verließ und in die dünner besiedelten Randgebiete Eilesruths einbog, war der Druck in ihrer Stirn zu einem kaum wahrnehmbaren Ziehen verblasst.
Das Haus von Lyras Familie lag einen zwanzigminütigen Fußmarsch von der letzten Haltestelle der Pferdebahn entfernt in einer ländlichen Gegend. Vereinzelte Häuser lagen zwischen weitläufigen Feldern. Am Horizont sah man Wald, so weit das Auge reichte.
Wie für Fae-Häuser üblich, war das Heim ihrer Familie rund um einen Heilrath-Baum gebaut, dessen starke Äste die Dachbalken trugen. Schon als Kind hatte Lyra es geliebt, zuerst auf das Dach zu steigen und vorsichtig bis ins Zentrum zu balancieren, wo sich die Schindeln um den breiten Baumstamm schlossen. Von dort aus kletterte sie über ein Geflecht an Ästen in die Krone. Es gab keinen besseren Ort, um ein Buch zu lesen, die Gedanken schweifen zu lassen oder um sich in eine Fantasiewelt zu träumen, in der man eine mächtige Fae-Magierin war, eine Händlerin aus einem weit entfernten Kontinent oder eine Piratin auf Kaperfahrt.
Lyra stellte ihre Tasche vor der Eingangstür ab und umrundete das Haus, an dessen Rückseite die Rothsee-Ache floss. Wie sie es erwartet hatte, kniete ihre Mutter knöcheltief im Fluss und fischte nach Wasserfäden. In wellenförmigen Bewegungen ließ sie ihre Hand durch das Wasser gleiten, bis sich hauchzarte Fasern um ihre Finger legten. Sie musste schon eine ganze Weile lang zugange sein, denn in dem Weidenkorb, den sie am Flusslauf abgestellt hatte, glitzerten eine Menge Fäden.
Als Wasserweberin verwob Lyras Mutter die feinen Fäden zu Seide und verkaufte diese an die gutbetuchten Schneider der Reichen. Wasserseide war noch edler und weicher als gewöhnliche Seide. Sie schmiegte sich an den Körper, war jedoch gleichzeitig luftig, und sie reflektierte das Licht, als flossen Wellen über den Stoff.
Manchmal half Lyra ihr, im Fluss nach den Fäden zu fischen. Doch wie für die meisten Arten der Fae-Magie fehlte ihr auch dafür das Talent, sodass sie in etwa fünfmal so lange brauchte wie ihre Mutter. Ganz abgesehen davon, dass Lyras Wasserfäden oft derart dünn waren, dass sie brachen, ehe sie zu Stoff verarbeitet werden konnten.
Als sie Lyra bemerkte, erhob ihre Mutter sich, klemmte den Korb mit den gesammelten Fäden unter ihren Arm und kam auf ihre Tochter zu.
»Ich habe frisches Brot gebacken«, sagte sie zur Begrüßung.
Den Geruch von frischem Brot mochte Lyra fast ebenso gerne wie den von frischem Apfelkuchen.
»Hmmm«, machte sie und brachte ihre Mutter damit zum Schmunzeln.
»Wie war der Unterricht?«
»Es war ... in Ordnung.«
Lyra verschränkte ihre Finger hinter dem Rücken. Ihre Mutter hatte ein Talent dafür, sie zu durchschauen. Selbst die kleinste Lüge konnte sie aus Lyras Blick herauslesen, und auch jetzt runzelte sie die Stirn, während sie ihre Tochter skeptisch von oben bis unten musterte.
»Was erzählst du mir nicht, Lyra?«, fragte sie.
»Gar nichts.«
Daraufhin zog ihre Mutter die Augenbrauen in die Höhe. »Hast du wieder Kopfschmerzen?«
»Nur ein bisschen.«
Den unangenehmen Druck, den sie seit einer Woche in der Stirn verspürte, als säße dort eine Entzündung, hatte sie vor ihrer Mutter nicht verbergen können. Schließlich war diese nicht bloß eine Wasserweberin, sondern auch eine begabte Heilerin.
»Komm mit«, forderte sie und ging an Lyra vorbei in das Haus. Sie folgte ihrer Mutter seufzend.
Es gab keinen Eingangsbereich, dafür war das Haus zu klein. Direkt hinter der Tür lag der Wohnraum, dessen Zentrum der Heilrath-Baumstamm bildete. Rund um ihn herum befanden sich der Esstisch sowie ein Zweisitzer und ein Regal voller Bücher. Dahinter gingen zwei Türen ab, von denen die eine in das Schlafzimmer ihrer Eltern, die andere in Lyras Zimmer führte. Zu ihrer Linken befand sich die Kochnische, die kaum Platz für drei Personen bot. Dort waren in einem Regal Gläschen mit Kräutern und Fae-Heilmitteln aufgereiht und an der Wand baumelten ganze Büschel getrockneter Blumen und Heilpflanzen.
Gezielt zupfte ihre Mutter Blüten und Blätter von ihren Stängeln und warf sie in einen Mörser.
»Kann ich dir zur Hand gehen?«, fragte Lyra.
»Ich brauche Pergamontrauch.«
»Pergamontrauch. Natürlich.«
Lyra trat zum Regal mit den Heilmitteln und ließ ihren Finger von einem Gläschen zum nächsten wandern. Nach einigen Augenblicken fand sie das Glas mit den aschfarbenen Sedimentstückchen in der Größe von Kieselsteinen. Sie zog es heraus und reichte es ihrer Mutter. Diese hatte in der Zwischenzeit ein Häufchen Heilkräuter und Pulver in den Mörser geworfen und zerrieb alles mit einem Stößel. Die Pergamontrauch-Stücke knackten und entließen einen starken Rauchgeruch, der den Duft nach frisch gebackenem Brot überdeckte.
Als sie fertig war, vermischte sie alles mit Wasser, holte den Brotlaib aus dem Ofen und schnitt eine dicke Scheibe ab.
»Iss das und dann trink diese Tinktur. Sie wird den Schmerz für eine Weile vergehen und dich schlafen lassen. Hoffentlich fühlst du dich bis morgen wieder besser.«
»Mir geht es wirklich gut«, entgegnete Lyra, wofür sie sich einen vorwurfsvollen Blick und eine hochgezogene Augenbraue einfing.
»Du jammerst seit einer Woche über Kopfschmerzen, und heute bist du so blass, als hättest du seit Monaten keine Sonne mehr gesehen«, stellte ihre Mutter fest.
Sie hatte ja recht. Ergeben sank Lyra auf einen der Küchenstühle und nahm einen Bissen vom Brot. Die Tinktur beäugte sie skeptisch. Die Mixturen ihrer Mutter wirkten zwar immer, aber sie schmeckten schrecklich.
Doch wenn sie ihre Kopfschmerzen verschwinden ließen, war es das wert.
Nachdem sie die Tinktur getrunken hatte, fiel Lyra in einen tiefen Schlaf, der von merkwürdigen Traumbildern geprägt wurde. Von kreischenden Raben und Riesen aus Wolken, die ihre Finger nach Lyra ausstreckten. Von durscheinenden Traumvögeln und Körpern, die in einem purpurnen Fluss trieben.
Als sie aufwachte, war das Pochen in ihrem Kopf verschwunden, dafür kribbelte ihre Stirn wie von einem Bienenstich. Stöhnend drehte sie sich herum und wischte sich die Haare aus dem Gesicht, als ... Aua! Sie zog die Hand zurück. Auf ihrem Zeigefinger glänzte ein Tropfen Blut.
Vorsichtig betastete sie ihre Stirn. Da, gleich unter ihrem Haaransatz, fühlte sie etwas Hartes, Spitzes. Der Stachel eines Insekts vielleicht? Die Haut rund um ihn herum war warm, als sei sie entzündet, und die Berührung sendete ein Brennen durch Lyras Haut.
Mit zusammengebissenen Zähnen versuchte sie, den Sporn aus ihrer Haut zu ziehen oder wegzudrücken, doch er rührte sich nicht. Stattdessen verstärkte sich das Brennen und sie nahm einen dumpfen Druck bis unter ihre Stirn wahr, als ob der Sporn dort festgewachsen wäre.
Lyras Hals zog sich zusammen, als sie mit den Fingern auch auf der anderen Seite ihrer Stirn einen Stachel ertastete. Was war das bloß?
Da fiel ihr die Tinktur ihrer Mutter ein. Natürlich! Bestimmt träumte sie noch und das hier war eine Nebenwirkung. Das musste es sein! Oder?
Sie presste die Augenlider fest aufeinander und schüttelte mehrmals den Kopf. Ihre Fingernägel grub sie schmerzhaft in die Oberschenkel. Doch weder ließ das den Traum vergehen noch die Stacheln auf ihrer Stirn verschwinden.
Schnell warf Lyra die Decke von sich und rutschte aus dem Bett. Ihre Finger zitterten so sehr, dass sie drei Anläufe brauchte, um die Lichtkugel auf den Lampenaufsatz zu stecken. Mit dem Licht in der Hand trat sie an den Spiegel und lehnte sich vor. Lyra blinzelte mehrmals. Kniff die Augen zusammen und öffnete sie wieder.
Aber es war zwecklos. So fest sie auch blinzelte, sie verschwanden nicht: zwei hellgraue Punkte auf beiden Seiten ihrer Stirn, so klein wie Glassplitter und spitz wie eine Nadel. Lyra trat so nah zum Spiegel, dass ihre Nasenspitze die kühle Oberfläche berührte und das Glas unter ihrem Atem beschlug. Mit spitzen Fingern versuchte sie, eine der Dornen zu fassen. Sie musste die Stachel aus ihrer Stirn reißen. Was auch immer sie waren, sie gehörten dort nicht hin!
Sie mussten weg – und das sofort!
Aber es gelangt ihr nicht. Wie sehr sie auch drückte und zog, die Stacheln saßen fest. Alles, was Lyra bewirkte, war, dass das heiße Brennen rund um die Sporne herum zunahm. Wieso ging es nicht? Es musste funktionieren! Es musste einfach.
Lyras Atem ging immer schneller. Das Zittern wanderte von ihren Fingern in ihre Hände. Dass sie die Lampe fallen ließ, merkte sie erst, als sie klirrend auf dem Boden aufschlug. Die Kristallkugel zersprang und gab Lichtpunkte frei, die über den Boden tanzten, bevor sie sich knisternd auflösten.
Vor Schreck stieß Lyra einen Schrei aus und taumelte zurück. Ein paar Sekunden lang, die ihr wie eine Ewigkeit vorkamen, starrte sie auf die Scherben. Dann hörte sie ein Poltern vor ihrem Zimmer und die Tür wurde aufgerissen.
»Lyra, geht es dir gut?«
Ihre Mutter trug noch ihr Nachthemd und hatte ein buntes Tuch um ihre Haare geschlungen. Als sie die Scherben entdeckte, weiteten sich ihre Augen.
»Was ist passiert?«, fragte sie und kam ins Zimmer.
»Nicht!«, rief Lyra.
Schnell drehte sie sich um und presste ihre Fäuste gegen die Stirn. Ihre Mutter durfte die Stacheln nicht sehen! Niemand sollte das! Sie mussten verschwinden. Dieser Traum musste aufhören!
Aber ihre Mutter rauschte heran und fasste Lyras Unterarme. »Hast du Schmerzen?«
Lyra schüttelte den Kopf, die Fäuste noch immer gegen die Stirn gepresst. Die Stacheln bohrten sich schmerzhaft in ihre Handballen.
»Lyra, sprich mit mir!«
Tränen stiegen in Lyras Augen. Was sollte sie tun? Was sagen? Sie wollte, dass ihre Mutter ging, dass sie die Tür hinter sich zumachte und Lyra allein ließ. Gleichzeitig wünschte sie sich nichts mehr, als in den Arm genommen zu werden. Innerlich flehte sie, dass das alles ein Traum war. Dass sie die Lider aufschlagen und alles wieder normal sein würde. Dabei spürte sie, dass das nur eine lächerliche Hoffnung war. Was auch immer diese Stacheln bedeuteten, sie waren echt.
Mit sanfter Gewalt zog ihre Mutter Lyras Hände von der Stirn und stieß die Luft aus.
»Nein«, flüsterte sie, ließ Lyras Arme los und hob die Hand zu ihren zitternden Lippen. »Nein, das darf nicht sein.«
»Du siehst sie auch?« Lyra hatte gespürt, dass dies kein Traum war, und doch ... Der Anblick ihrer Mutter, ihrer zitternden Lippen und der Tränen, die in ihre Augen traten, machte diesen Irrsinn plötzlich noch realer.
»Lyra, du ... du musst dir etwas anziehen. Wir müssen Hilfe holen«, stotterte ihre Mutter. Ihre Stimme war so dünn wie Wind und trotzdem bestimmt.
»Was ist das auf meiner Stirn?«
»Beeil dich. Schnell!«
»Mama!«
Aber da war sie bereits aus dem Zimmer gerauscht und rief nach Lyras Vater: »Reimar, wach auf! Wir brauchen die Kutsche.«
Die Kutsche? Warum? Wohin wollte ihre Mutter fahren? Lyras Herz schlug so schnell, als wollte es aus ihrer Brust springen, während sie sich ihre Bluse überstreifte und in ihre Pumphose schlüpfte. Mit zitternden Fingern versuchte sie, die Bänder ihrer Hose zu verknoten.
Einatmen. Ausatmen.
Sie musste es sich in Gedanken vorsagen. Musste sich dazu zwingen, weiterzuatmen. Den Anweisungen ihrer Mutter zu folgen und aus ihrem Zimmer zu treten, anstatt auf der Stelle einzufrieren oder laut loszuschreien.
Einatmen. Ausatmen. Bestimmt gab es eine Erklärung für das alles. Ihre Mutter wusste, was diese Stacheln zu bedeuten hatten, und würde Hilfe für Lyra suchen.
Einatmen. Ausatmen.
Als Lyra in die Küche kam, saß ihre Mutter am Tisch und kritzelte eine Nachricht auf ein Stück Papier. Draußen brannte Licht, also war ihr Vater, ein Menschenmann, bereits dabei, die Kutsche zu richten.
»Was passiert mit mir?«, flüsterte sie.
Ihre Mutter schaute auf. »Es wird alles gut, Lyra. Wir fahren in die Akademie. Dort wird man dir helfen.«
»In die Akademie?«
Sie nickte, faltete ihre Nachricht zusammen und hielt sie über eine Kerze. Die Flamme fraß sich durch das Papier und verwandelte es in Rauch. Ascheflöckchen tanzten durch die Luft, dehnten sich erst aus und verdichteten sich wieder. Sie formten eine Gestalt, eine Motte mit filigranen Papierflügeln, die sich flatternd erhob. Die Prozedur dauerte nur wenige Sekunden. Schon flog die Motte durch die geöffnete Haustür nach draußen, um den Empfänger der Nachricht zu finden.
»Komm«, forderte Lyras Mutter und stand auf. »Miss Elsgeroth wird uns erwarten.«
Ihre Lehrerin? Was hatte sie damit zu tun?
Miss Elsgeroths besorgter Blick und ihre Forderung, Lyra solle nicht zum Arzt gehen, fielen ihr wieder ein, und sofort kehrte das Pochen in ihrer Stirn zurück.
»Aber ... ich ...«
Ihre Mutter nahm ein Stück Stoff, das für die Auslieferung bestimmt war, und wickelte es um Lyras Stirn. Edelste Wasserseide, die wie Lapislazuli schimmerte, leicht wie ein Lufthauch und mindestens dreißig Kupferlinge wert.
»Was sind das für Stacheln auf meinem Kopf«, flüsterte Lyra.
Wieso gab ihre Mutter ihr keine Antwort? Wieso diese Geheimniskrämerei? Das ergab doch alles keinen Sinn!
Ihre Mutter schaute sie ein paar Sekunden lang bloß an. Schließlich streichelte sie über Lyras Wange. »Ich bin mir nicht sicher, Schatz.«
»Aber?«
»Ich glaube ...« Sie schluckte. »Ich glaube, es sind Hörner.«
»Nein, das ... das kann nicht sein!«
Hörner? Das war unmöglich! Fae wuchsen keine Hörner, weder denen ausEilesruthnoch den Fremden auf dem Markt. Hörner hatten nur Tiere! Es sei denn ... Sie schüttelte den Kopf, um diesen Gedanken loszuwerden. Es durfte nicht wahr sein, das durfte es einfach nicht!
»Miss Elsgeroth wird uns Antworten geben können. Komm!«
Lyras Mutter ergriff ihre Hand und zog sie hinter sich nach draußen, wo ihr Vater bereits auf dem Kutschbock saß. Seine hellbraunen Haare, die er sonst ordentlich zur Seite kämmte, wrinkelten sich wirr um seinen Kopf. Unter seinem Mantel trug er sein Nachtgewand – er hatte sich nicht einmal die Zeit genommen, sich umzuziehen –, und sein Gesichtsausdruck war voller Sorge.
Lyra wich seinem Blick aus, als sie einstieg. Sie konnte sie nicht ertragen, seine traurigen Augen, die Furchen, die sich über seine Stirn zogen. Ihre Mutter nahm Lyras Hände in ihre und sie fuhren los.