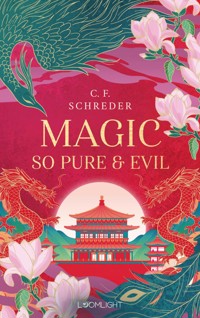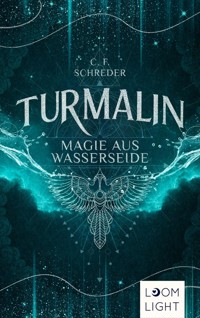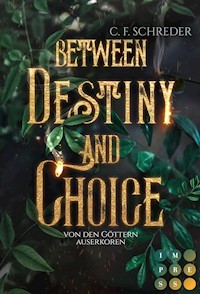
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
**Hast du die Kraft, deine Bestimmung zu ändern?** Die willensstarke Kämpferin Anahí lebt gemeinsam mit ihrer Ziehschwester in Mexico City. Dort weiß niemand, was sich in ihrer Heimat alle elf Jahre zuträgt: Auf der tropischen Insel Surayami wählen die Götter ihre Gefährten und Krieger aus den Reihen der Menschen. Anahí bereitet sich seit Jahren auf diesen Tag vor. Dies trifft auch auf Thiago zu – einen mysteriösen, gut aussehenden Krieger-Anwärter, der von allen gemieden wird. Gemeinsam wappnen sie sich für die nahende Götterprüfung und kommen sich dabei entgegen aller Warnung näher. Ein gefährliches Spiel beginnt für Anahís Herz, denn die Götter haben etwas Unbarmherziges für Thiago vorgesehen. Akzeptierst du dein Schicksal oder folgst du deiner eigenen Bestimmung auf der Insel der Götter? //»Between Destiny and Choice. Von den Göttern auserkoren« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
C. F. Schreder
Between Destiny and Choice. Von den Göttern auserkoren
**Hast du die Kraft, deine Bestimmung zu ändern?**
Die willensstarke Kämpferin Anahí lebt gemeinsam mit ihrer Ziehschwester in Mexico City. Dort weiß niemand, was sich in ihrer Heimat alle elf Jahre zuträgt: Auf der tropischen Insel Surayami wählen die Götter ihre Gefährten und Krieger aus den Reihen der Menschen. Anahí bereitet sich seit Jahren auf diesen Tag vor. Dies trifft auch auf Thiago zu – einen mysteriösen, gut aussehenden Krieger-Anwärter, der von allen gemieden wird. Gemeinsam wappnen sie sich für die nahende Götterprüfung und kommen sich dabei entgegen aller Warnung näher. Ein gefährliches Spiel beginnt für Anahís Herz, denn die Götter haben etwas Unbarmherziges für Thiago vorgesehen.
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Nachtrag und Quellen
Muchas Gracias!
© Christoph Ascher
C. F. Schreder ist das Pseudonym der österreichischen Autorin Christina Fuchs. Sie studierte Psychologie und Wirtschaftswissenschaften, lebte ein Jahr lang in Hongkong und arbeitete anschließend als Personalmanagerin in Österreich und in den USA. Vor allem während ihrer Reisen und Auslandsaufenthalte sammelte sie Inspiration für ihre Geschichten. Derzeit lebt und schreibt Christina wieder in Österreich.
Para Mau
Mátalo – Töte ihn
»Mátalo! Töte ihn! Mátalo!«
Schreie pulsieren durch die Luft und übertönen sogar den lauten Bass aus der Halle über uns. Sie sind wütend, gleichzeitig ekstatisch und sie springen auf die Menschen im Raum über, eine wogende Masse aus schwitzenden Körpern, die Blut fordern.
Ich quetsche mich mit angehaltenem Atem zwischen den vielen Männern hindurch. Endlich erreiche ich den Käfig, einen von Eisenstangen eingerahmten Wrestling-Ring, in dessen Mitte zwei muskelbepackte Männer aufeinander losgehen. Hier vorne ist der Gestank nach Schweiß und Bier etwas weniger stechend und ich kann durchatmen, werde in diesem Moment aber so fest von einem Mann angerempelt, dass ich gegen die Eisenstangen taumle.
Er entschuldigt sich nicht, bemerkt mich nicht einmal, sondern reißt berauscht den Arm in die Höhe. Spuckebläschen landen auf meiner Wange, als er brüllt: »Schlag ihn nieder! Mátalo!«
So läuft das hier im Lucha-Käfig. Niemand nimmt Rücksicht auf den anderen. Das Einzige, was zählt, ist Stärke, und wer nicht groß und stark ist, ist nichts. Der Käfig liegt im Keller einer Diskothek im Norden von Mexico City. Über uns werfen sich die Feierlustigen auf die Tanzfläche und bewegen ihre Körper zum Bass, der so hart durch die Decke und Wände vibriert, dass ich ihn im Bauchraum fühlen kann. Die Partygäste haben keine Ahnung, was sich unter ihnen befindet, dass sie nur durch eine unscheinbare Eisentür am Rand der Tanzfläche treten und eine Treppe hinunterlaufen müssten, um einigen der fähigsten, aber auch brutalsten Kämpfern Mexikos zuzuschauen. Den meisten wäre es vermutlich auch egal.
Meine beste Freundin Remedios gehört zu ihnen. Sie war nur ein einziges Mal im Lucha-Käfig, aus Neugierde darüber, an welchen Ort es mich seit einem halben Jahr einmal im Monat zieht, und sie fand es schrecklich.
»Es ist laut, es ist heiß, es ist eng und es stinkt«, stellte sie mit gerümpfter Nase fest und nannte den Lucha-Käfig einen »Fightclub für Halloween-Clowns.«
»Ehrlich, Anahí, wenn du dir eine gute Show ansehen willst, warum gehst du dann nicht zum Wrestling?«, fragte sie mich damals.
»Weil«, antwortete ich, »eine Show das Gegenteil von dem ist, was ich sehen will.«
Denn die in Mexiko so berühmten Wrestler sind im Grunde nichts anderes als Masken tragende Tänzer. Sie schlagen aufeinander ein, wirbeln sich gegenseitig durch die Luft, vollführen Sprünge und Saltos. Jede ihrer Bewegungen ist einstudiert. Es ist ein Tanz, nichts anderes – hübsch anzusehen, aber ohne jegliche Gefahr. Niemand verletzt sich wirklich. Niemand riskiert, sich einen Knochen zu brechen oder gar zu sterben. Hier ist das anders. Die Zuschauer fordern echtes Blut, echten Schmerz, echte Gefahr – und die Kämpfer, die Luchadores, erfüllen diesen Wunsch.
In diesem Moment geht einer der Kämpfer im Käfig zu Boden. Obwohl er sich nicht mehr rührt, tritt sein Gegner ihm hart in die Rippen, sodass es den muskelbepackten Körper am Betonboden durchschüttelt. Die Menge jubelt. Es scheint unmöglich, aber die Schreie schwellen noch mehr an und bringen die Luft beinahe zum Platzen. Auf meinen Armen breitet sich eine Gänsehaut aus. Bitte, denke ich, bitte, bitte, bring ihn nicht um.
Aber die Zuschauer feuern den Kämpfer an weiterzumachen und der Schiedsrichter steht tatenlos am Rand des Käfigs, während der Sieger weiter auf den Verlierer eintritt. In diesem Moment betritt eine schmächtige Gestalt in einem schwarzen Sweatshirt den Ring. Der Statur nach zu urteilen ein Mann, aber er ist wesentlich schmaler als beide Kämpfer. Sein Gesicht wird von einer Kapuze verdeckt, seine Bewegungen sind ruhig. Gemächlich schlendert er durch den Käfig.
»Verzieh dich aus dem Ring, du Irrer!«, schreit jemand. Unzufriedenes Gemurmel kriecht durch das Stimmengewirr und erfasst den Schiedsrichter, der sich endlich von seinem Platz löst und mit ausgebreiteten Armen auf die Gestalt im schwarzen Sweatshirt zugeht. Offenbar will er den Eindringling aus dem Käfig vertreiben, aber der lässt sich nicht beirren, macht noch einen Schritt auf den Kämpfer zu und redet auf ihn ein. Als der Mann nicht reagiert, legt er ihm eine Hand auf den Oberarm.
Ein großer Fehler, denn sofort fährt der Luchador herum und zielt mit seinem Ellenbogen genau auf den Kopf unter der schwarzen Kapuze. Doch der Eindringling duckt sich blitzschnell unter dem Arm weg, sodass ihn dieser um eine Handbreite verfehlt. Dabei rutscht die Kapuze nach hinten und gibt den Blick auf zusammengeknotete hellbraune Haare und ein braun gebranntes Gesicht frei.
Instinktiv klammere ich mich an den Eisenstangen fest und sauge die Luft ein. Ich kenne diesen jungen Mann. Das heißt, richtig kennen tue ich ihn nicht, ich habe mich nie getraut, ihn anzusprechen, aber ich habe ihn schon zweimal hier im Lucha-Käfig gesehen. Beide Male stand er am Rand und beobachtete die Kämpfe schweigend, die Augenbrauen zusammengezogen und die Lippen fest aufeinandergepresst. Nur das Zucken seiner zimtfarbenen Augen, die den Bewegungen der Kämpfer folgten, verriet, dass ihm das Geschehen nicht völlig gleichgültig war.
Meine Faszination galt allerdings nicht seinem Gesichtsausdruck, sondern der Heiligen Schrift, die seine Arme und das Schlüsselbein bedeckt. Reihe um Reihe ziehen sich die winzigen Glyphen über seine Haut und erzählen Geschichten von den aztekischen Göttern. Diese Zeichen sind eine Abwandlung der traditionellen Nahuatl-Schrift, die in der modernen Welt kaum mehr bekannt ist – mit Ausnahme von Orten wie Surayami, der Insel, auf der ich aufgewachsen bin und gleichzeitig das Tor zur Götterwelt.
Wer ist dieser junge Mann? Wieso habe ich ihn nie zuvor getroffen, wenn er doch die Zeichen meiner Heimat auf der Haut trägt?
Jetzt steht er im Ring, während die Zuschauer brüllend sein Blut fordern. »Mátalo! Schlag ihn nieder! Töte ihn!«
Mein Herz schlägt so fest, als wolle es aus meiner Brust springen. Der muskulöse Kämpfer ist offensichtlich in Rage. Wie ein hungriges Raubtier stürzt er sich auf den Eindringling in seinem Käfig, holt aus und zielt mit der geballten Faust auf den Kopf des Jungen. Sein gesamter Körper bebt, während er sich immer wieder nach vorne wirft.
Aber er trifft den Kerl mit den Tattoos nicht. Blitzschnell weicht der jedem Schlag und Tritt aus. Fast wirkt es, als wüsste er schon im Vorhinein, welche Attacke sein Angreifer geplant hat, sodass er immer eine Sekunde vorher reagieren kann.
Der Luchador wirft seinen Körper nach vorne.
Der Eindringling weicht tänzelnd zurück.
Der Luchador tritt.
Der Eindringling springt in die Luft.
Bei einem besonders harten Vorstoß dreht der junge Mann mit den Glyphen-Tattoos sich zur Seite, sodass die Hand des Luchadors knapp an seinem Körper vorbeisaust. Und die ganze Zeit bewegt sich sein Mund, als redete er mit seinem Gegner, als versuchte er immer noch ihn zu beschwichtigen.
Es ist ein Tanz, so schön und so tödlich, wie er nur im Lucha-Käfig stattfinden kann. Die Ruhe dieses Zweikampfs breitet sich auf der Tribüne aus und die Schreie verwandeln sich in ein summendes Flüstern. Es ist beinahe unheimlich, wie sich die Stille nach und nach über die Halle legt.
Mit der Zeit werden die Bewegungen des größeren Luchadors langsamer und unbeholfener. Er scheint müde zu werden. In einer letzten Kraftanstrengung wirft er sich brüllend nach vorn. Dieses Mal weicht der Kämpfer mit den Götter-Tattoos nicht aus. Blitzschnell zielt er mit dem rechten Arm auf die Kehle seines Gegners, ein einziger Schlag nur, doch der reicht und der Kämpfer kippt vornüber.
Für drei Sekunden bleibt die Zeit im Lucha-Ring stehen. Die Masse der Zuschauer schaut reglos auf den Käfig, in dem nun beide Luchadores am Boden liegen, während der junge Mann mit den Götter-Tattoos sich die Kapuze zurück über den Kopf zieht. Niemand kann wirklich glauben, was eben passiert ist, dass dieser schmale Kerl einen der gefürchtetsten Kämpfer der Stadt mit einem einzigen Schlag niedergestreckt hat. Doch dann explodiert der Saal.
Rund um mich herum springen die Leute frenetisch auf und ab, schreien und jubeln. »Mátalo!«, hallt es in der Halle und wider halte ich die Luft an. Wird der junge Krieger auf den Mann am Boden eintreten, wie dieser es vorhin mit seinem Gegner getan hat?
Es ist das ungeschriebene Gesetz des Lucha-Rings: K. o. zu gehen bedeutet noch lange nicht, dass der Kampf vorbei ist. Wenn die Zuschauer Blut wollen, werden sie Blut bekommen.
Aber er ignoriert die Schreie. Stattdessen lässt er seinen Blick langsam über das Publikum wandern. Als er mich ansieht, fühle ich ein Kribbeln in der Luft, als sei sie elektrisch aufgeladen, und mir läuft ein Schauer den Rücken hinunter. Bilde ich es mir ein oder bleiben seine Augen länger an meinem Gesicht hängen als auf dem aller anderen?
Doch schon ist der Moment vorbei. Er dreht sich um und verlässt den Ring.
»Warte«, flüstere ich.
Ich will unbedingt mit ihm sprechen. Nachdem ich ihn habe kämpfen sehen, bin ich mir sicher: Die Tätowierungen sind kein Zufall. Er muss ein angehender Götter-Krieger sein, genau wie ich.
So schnell ich kann, quetsche ich mich durch die Reihen der Zuschauer, was gar nicht so einfach ist. Immer wieder muss ich mich bücken, um Ellenbogen auszuweichen, und auf halber Strecke stoße ich mit einem Mann zusammen, der aus Versehen seinen Becher Bier über meinem Shirt vergießt. Als ich den Eingang des Käfigs endlich erreicht habe, fehlt von dem Kerl im Kapuzenpullover jede Spur.
»Hey, wo ist der Kämpfer von vorhin hin?«, frage ich den Schiedsrichter. Der ignoriert mich, doch ich bekomme den Zipfel seines Shirts zu fassen und ziehe daran, bis er sich umdreht.
»Was?«, faucht er sichtlich genervt.
»Der Sieger, wo ist er hin?«
Er zuckt die Schultern. »Gegangen.«
»Hast du gesehen, wohin er gegangen ist?«
Schnaubend verdreht er die Augen. »Hör mal, Kleine, ich bin nicht die Auskunft. Wenn du nicht kämpfen willst, verziehst du dich besser.«
Schon wendet er sich von mir ab, um die Männer zu dirigieren, die dabei sind, die zwei ohnmächtigen Luchadores an den Füßen aus dem Käfig zu schleifen. Dort, wo der Verlierer zusammengebrochen ist, leuchtet der Beton rot. Der nächste Kämpfer, ein Hüne von zwei Metern mit einer schwarz-blauen Maske, steht schon bereit und spannt im Käfig seinen Bizeps an, während er auf einen möglichen Gegner wartet. Für den Kampf im Ring ist keine Anmeldung erforderlich. Jeder darf antreten. Das heißt, jeder der stark oder dumm genug ist, sich in den Käfig zu wagen.
»Warte!«, rufe ich und halte den Schiedsrichter am Ärmel zurück.
»Was denn noch?«, fragt er schnaubend.
»Ich …«
»Willst du in den Ring?«
Jetzt grinst er. Die Art, wie er mich von oben herab anschaut, löst etwas in mir aus. Ein Brodeln in meinem Bauch und eine kleine Stimme, die flüstert: Dir werde ich es zeigen.
Ich recke das Kinn hoch. »Ja«, sage ich, wobei ich seine Augen fixiere.
»Wusste ich doch, dass du eine Kämpferin bist«, meint er, aber sein Lachen verrät, wie wenig ernst er mich nimmt.
Ich schiebe meine vor Nervosität zitternden Finger in die Taschen meiner Jeans und trete an ihm vorbei in den Ring. Als ich zum ersten Mal einen Kampf hier unten gesehen habe, nahm ich mir vor anzutreten, um mir selbst und den Göttern zu beweisen, dass ich stark genug für eine Position als Götter-Kriegerin bin. Darum bin ich immer und immer wieder zurückgekommen, auch wenn mir bisher der Mut gefehlt hat, in den Ring zu treten. Heute ist meine letzte Chance und diese werde ich nutzen.
Ich sollte mich gut fühlen: stark, selbstsicher, unbesiegbar. Aber in Wirklichkeit würde ich mich am liebsten übergeben.
Ein Ruck fährt durch meinen Arm, als der Schiedsrichter mich am Handgelenk packt und zurückhält. »Was soll das, Kleine? Du bist doch verrückt.«
In seine Mimik hat sich neben Herablassung etwas anderes gemischt: Sorge. Was sieht er, wenn er mich anschaut? Ein achtzehnjähriges Mädchen mit langen dunklen Haaren und Sommersprossen auf dem Nasenrücken, fast zwei Köpfe kleiner als der Luchador im Ring, schwächlich und wie dafür gemacht, von einem Kämpfer zu Brei geschlagen zu werden?
»Komm raus aus dem Käfig«, fordert er, aber ich schüttle den Kopf.
»Der Kerl dort hat seinen letzten Gegner krankenhausreif geprügelt und auf dich wird er auch keine Rücksicht nehmen. Sei nicht dumm, Mädchen, du bringst dich noch um.«
»Ich weiß, was ich tue.«
Weiß ich das wirklich? Mittlerweile hat das Zittern auch meine Beine erfasst und in meinem Bauch brodelt die Magensäure. Ich versuche die Übelkeit hinunterzuschlucken. Wenn ich weise wäre, würde ich diese letzte Chance zum Rückzug nutzen. Ich würde den Ring verlassen und meine Scham mit einem doppelten Tequila hinunterspülen.
Aber Weisheit gehörte im Gegensatz zu Spontaneität nie zu meinen Stärken. Also schüttle ich die Hand des Schiedsrichters ab und trete ins Zentrum des Rings, wo ich zitternd stehen bleibe. Mein Gegner baut sich wie ein massiver Berg vor mir auf, beide Hände in die Hüften gestemmt.
»Das ist wohl ein Witz!«, ruft er dem Schiedsrichter zu, der hilflos die Arme hebt.
Daraufhin geht er leicht in die Knie und lässt seinen Blick von meinen Füßen bis zu meinem Scheitel wandern.
»Ich gebe dir fünf Sekunden, um den Ring zu verlassen«, sagt er. »Wenn du dann nicht weg bist, zerquetsche ich dich wie eine Ameise. Eins.«
Ich atme tief durch, um meinen Magen zu beruhigen.
»Zwei.«
Mein Gegner macht unmerklich einen Schritt zurück und bringt sich in Angriffsposition.
»Drei.«
Zwischen die Schreie des Publikums mischen sich Buhrufe.
»Vier.«
Ich sehe, dass der Luchador sein rechtes Bein leicht nach innen geneigt hat. Vielleicht wegen einer alten Verletzung? Mein Trainer auf Surayami hat mir beigebracht, immer die Schwachstelle des Gegners zu suchen. Hoffentlich habe ich seine gefunden.
»Fünf.«
Der Hüne macht einen Satz auf mich zu. Ich weiche zur Seite aus, bin aber zu langsam. Seine Faust streift meine Schläfe und sendet ein Klingeln in meine Ohren. Bevor er mich ein zweites Mal erwischt, ducke ich mich. Mit beiden Händen stütze ich mich am Boden ab und reiße meinen einen Fuß hoch. So fest ich kann, kicke ich gegen sein rechtes Knie. Er taumelt leicht, fängt sich aber sofort wieder.
Also doch keine Schwachstelle.
Seinem nächsten Tritt weiche ich aus, indem ich mich nach hinten abrolle. Ich will aufstehen, verliere aber die Balance und muss zur Seite kriechen, ehe ich auf die Beine komme. Mein Gegner stößt ein kehliges Lachen aus und wieder brodelt meine Wut hoch.
Ich mag klein sein, aber das heißt nicht, dass ich mich auslachen lasse!
Mit einem Schrei stürze ich mich nach vorn, ducke mich unter seiner Achsel hindurch und boxe ihm genau in die Magengrube. Keuchend beugt er sich vornüber und stößt mich weg. Ich taumle zurück, bis sich die Eisenstangen des Käfigs in meinen Rücken drücken. Mein Gegner rast nun vor Wut.
Schreiend läuft er auf mich zu. Mein erster Instinkt ist es, wegzulaufen. Jede Faser meines Körpers verlangt nach Flucht, aber ich zwinge mich dazu, stehen zu bleiben.
Er holt zum Schlag aus. Seine Faust saust durch die Luft und ich atme langsam aus. Im letzten Augenblick drehe ich mich zur Seite weg, sodass seine Fingerknöchel auf die Eisenstange treffen. Es kracht laut und ihm entfährt ein Stöhnen. Sicher hat er sich die Hand gebrochen.
»Verdammt, Kleine, du bist gut!«, höre ich den Schiedsrichter rufen.
Ein triumphierendes Lächeln stiehlt sich auf meine Lippen. Ja, ich bin gut. Doch da kommt ein Bild hoch. Das Gesicht des jungen Manns mit den Götter-Tattoos, die Art, wie er mich anschaute, ernst und ruhig, und mit diesem Bild schleicht ein Gedanke in meinen Kopf, derselbe, der mich seit meiner Kindheit verfolgt.
Ich bin gut. Aber nicht gut genug für die Götter.
Dieser kleine Moment der Unachtsamkeit ist zu viel. Mein Gegner holt zum Schlag aus, aber dieses Mal ducke ich mich nicht schnell genug. Schmerz fährt durch meinen Kopf, als seine Faust mich im Gesicht trifft. Ich schmecke Blut, meine Ohren klingeln. Alles dreht sich.
Als ich zurücktaumle, packt der Luchador mich an den Haaren und schleudert mich gegen die Eisenstangen. Meine Stirn knallt gegen das Metall. Heißer Schmerz schießt durch meinen Kopf, als würde dieser entzweibrechen. Ein Wirbel an Farben tanzt vor meinen Augen.
Dann wird alles dunkel.
***
Anahí, 8 Jahre alt
»Die Götter zeigen sich uns in den unterschiedlichsten Gestalten. Nicht immer erkennen wir sie«, erklärte der Priester, dessen bunte Gewänder von glänzenden Goldfäden durchzogen waren. Er deutete auf die Zeichnungen an der Tempelwand, die Männer und Frauen, Monster, Geistergestalten, Bären, Papageien und Jaguare zeigten.
»Jedes Tier, jeder Grashalm, jeder Windhauch könnte von den Göttern gesandt sein. Vergesst das nicht«, fügte er an die Kinder gewandt hinzu.
Insgesamt waren sie zu acht, fünf Mädchen, drei Jungen, und sie saßen in einem Halbkreis am Boden des reich verzierten Raums. Alle Kinder Surayamis mussten regelmäßig in den Tempel kommen, wo ihnen die Priester Geschichten über die Götter und deren Welt der fünf Sonnen erzählten. Während Anahís Ziehschwester Remedios sich jede Woche sträubte, liebte Anahí die Unterrichtsstunden im Tempel.
Wenn sie die steinernen Stufen hochging und die Opferhalle durchquerte, in der sich die Tische voll reifer Früchte und duftender Blumen bogen, fühlte sie sich, als schreite sie direkt in die Welt der fünf Sonnen. Eingehüllt in das Flackern Hunderter Kerzen stellte sie sich vor, wie es sein müsste, an der Seite der Götter zu leben. Sie hing an den Lippen des Priesters, während dieser von den besonderen Fähigkeiten der Götter erzählte. Manche konnten das Wetter beeinflussen, andere Glück schicken, wieder andere konnten Menschen und Tiere krank oder gesund machen. Diese Geschichten kamen Anahí wie Märchen oder wie Träume vor. Nur, dass sie real waren.
»Unsere aztekischen Vorfahren standen in engem Kontakt mit den Göttern: mit Tezcatlipoca, dem Gott der Nacht; mit Xochiquetzal, der Göttin des Mondes und der Blumen; mit Tlaloc, dem Gott des Regens, und mit all den anderen. Doch mittlerweile haben die Menschen diese Verbindung verloren. Allein hier, auf Surayami, besteht der Kontakt zu den Göttern bis heute fort. Nur uns besuchen sie, wenn der Schleier zur Welt der fünf Sonnen sich im elften Jahr lichtet, und nur uns bieten sie die Chance, mit ihnen in die Welt der Götter zu ziehen.«
Dabei schaute er die Kinder der Reihe nach an.
»Wer sich als würdig erweist, erfährt die Ehre, als Gefährte oder Krieger an der Seite der Götter zu leben.«
Anahí schluckte, als der Blick des Priesters sie streifte. Sie wollte etwas Besonderes sein, würdig für die Götter. Sie wollte es so sehr!
Schon lösten sich die Augen des Priesters von ihr und blieben bei seinen nächsten Worten auf Remedios liegen. Die zog den Kopf ein, als wollte sie unter seinem Blick schrumpfen, sich klein machen, damit er sie nicht mehr sah, und sie drückte Anahís Hand.
»Jeder Einzelne von euch könnte erwählt werden.«
Aber er schaute nur Remedios an.
La hija perdida – Die verlorene Tochter
Am nächsten Morgen fühlt mein Körper sich an, als sei ich von einer Herde Wasserbüffel überrannt worden. Mein Kopf ist wie in Watte gehüllt, hinter meiner Stirn pocht es und meine Muskeln ächzen, als ich mich stöhnend aufrichte. Was ist nur passiert?
Kaum, dass ich diese Frage zu Ende gedacht habe, lichtet sich der Nebel um meine Gedanken und ich erinnere mich: der Lucha-Käfig, der Kerl mit den Götter-Tattoos und mein eigener naiver Versuch, einen Kampf zu gewinnen. Alles kommt wieder hoch.
Wie lange hat es gedauert, ehe mein Gegner mich k. o. geschlagen hat? Eine Minute? Weniger? Und was ist danach passiert? Wie bin ich nach Hause gekommen? Mir vorzustellen, wie ich unter dem Gegröle der Zuschauer zu Boden gegangen bin und wie mich irgendjemand an den Füßen aus dem Ring gezogen haben muss, lässt die Hitze in meine Wangen steigen.
Vorsichtig richte ich mich auf und taste an der Wand entlang nach dem Lichtschalter. Es ist Zeit, das Schlachtfeld, das von meinem Gesicht übrig ist, zu begutachten. Der Blick in den Spiegel lässt mich schlucken. Auf meiner Stirn prangt eine dicke Beule, rund um die herum ein Bluterguss blau leuchtet, ein zweiter, etwas hellerer, bedeckt meine Wange. Meine Augen sind blutunterlaufen, ein Riss zieht sich über meinen Nasenrücken und zwischen Nasenflügel und Lippe klebt trockenes Blut. Als ich mein Shirt hochziehe, sehe ich, dass zahlreiche blaue Flecken und Schrammen sich über meine Taille, den Bauch und Rücken ziehen.
Vorsichtig taste ich an meinen Rippen entlang. Es tut zwar weh, aber es scheint nichts gebrochen zu sein. Das ist allerdings auch schon der einzige Erfolg meines gestrigen Kampfversuchs.
Wie konnte ich so dumm sein und mich während eines Zweikampfs ablenken lassen? Habe ich im Training nicht gelernt, dass Konzentration das A und O eines guten Kriegers ist?
»Blendet eure Umgebung aus, lasst alle Gedanken an euch abgleiten wie Wassertropfen. Angst, Schmerz und Zweifel müssen sich in Rauch auflösen«, hallt die Stimme meines Trainers, Don Allende, in meinen Ohren. Er war einer der wenigen, die immer an mich geglaubt haben. Er traute mir zu, dass ich eine fähige Kriegerin sein könnte, sogar talentiert genug für die Götter – auch wenn ich vermute, dass er all seinen Schülern auf dieselbe Weise Mut gemacht hat. Gut, dass er meinen gestrigen Auftritt nicht mit ansehen musste.
Am liebsten würde ich mich unter meiner Bettdecke verkriechen und erst wieder herauskommen, wenn meine Wunden verheilt sind. Aber ich habe Remedios versprochen, mit ihr in die Innenstadt zu fahren, um den Abschluss des Schuljahres auf ihre ganz persönliche Weise zu feiern. Durch die Tür meines Zimmers dringen leise Stimmen und Reggaeton, Remis Lieblingsmusik. Sie muss also schon wach sein.
Wir beiden sind so etwas wie Schwestern, obwohl wir eigentlich gar nicht verwandt sind. Wir wurden im selben Monat auf Surayami, einer kleinen Insel abseits der Küste von Yucatán, geboren und spielten schon als Kleinkinder zusammen in einer Krippe. Als Remedios sieben Jahre alt war, wurde ihre Mutter als Gefährtin für die Götter ausgewählt. Sie verließ daraufhin die Familie, um mit den Göttern zu leben. Von Anfang an half meine Mum Remedios und ihrem Vater, kochte für sie oder zähmte Remedios wilde Lockenmähne. Mit den Jahren verbrachte Remi immer weniger Zeit bei ihrem Vater und mehr Zeit bei uns, bis sie irgendwann ein eigenes Zimmer in unserem Haus bekam und es sich so anfühlte, als wären wir schon immer eine Familie gewesen.
Vor zwei Jahren zogen Remi und ich nach Mexico City, um dort die Preparatoria, die höhere Schule, zu besuchen. Obwohl meine Mutter damals vor Sorge fast gestorben wäre und mein Vater über die Mietpreise in der Hauptstadt murrte, ließen sie uns ziehen. Es ist eine der unausgesprochenen Regeln Surayamis, dass die Jugendlichen, sofern sie denn wollen, die Insel verlassen dürfen, um zumindest für eine begrenzte Zeit die Welt fernab der Götter kennenzulernen. Nur wenige wagen diesen Schritt. Lieber verzichten sie auf eine höhere Schulbildung, als Surayami und das Tor zur Götterwelt länger als nötig zu verlassen, und die meisten anderen kehren nach ihrem Schulabschluss zurück. Zumindest gilt das für neunundneunzig Prozent der Surayamesen.
Bei Remi sieht die Sache anders aus. Für sie bedeutet die Stadt Freiheit, während sie in Surayami das Gefühl hat, dass ihr die Luft abgeschnürt wird. Ich selbst bin mir noch nicht sicher. Eigentlich dachte ich immer, ich würde in Surayami alt werden und den Traditionen der Götter folgen, wie es meine Mutter und vor ihr meine Großmutter und vor ihr meine Urgroßmutter getan haben. Aber inzwischen bin ich auch auf den Geschmack der Freiheit gekommen.
Langsam öffne ich die Tür zu meinem Zimmer und luge in den Wohnraum. Ich hoffe, dass ich mich unbemerkt ins Bad schleichen und mir zwanzig Schichten Make-up ins Gesicht schmieren kann, um die Spuren der letzten Nacht zumindest halbwegs zu verdecken, bevor ich Remi unter die Augen treten muss.
Unsere Wohnung ist klein: zwei Zimmer, ein Badezimmer und ein überschaubares Wohnzimmer mit Kochnische. Dort steht Remi mit dem Rücken zu mir, die Arme um ihren Freund Gael geschlungen, der etwas in einer Pfanne brät. Die beiden haben sich in dem Coffeeshop kennengelernt, in dem Remi und ich an den Wochenenden jobben. Gael ist Remis erste große Liebe und das bedeutet einiges, immerhin konnte sie sich auf Surayami vor Verehrern kaum retten. Die meisten Jungen waren irgendwann einmal verliebt in sie, vielleicht wegen ihres strahlenden Lächelns oder ihrer ozeanblauen Augen, die in Kontrast zu ihren dunklen Haaren und Augenbrauen leuchten. Vielleicht auch weil sie instinktiv spürten, dass Remi etwas Besonderes ist. Sie war geküsst vom Schicksal, die Tochter einer Göttergefährtin, die so auch in der Gunst der Götter stand.
Aber Remi gab einem nach dem anderen den Laufpass, als wäre die Liebe ein nerviges Unterfangen, etwas für andere, nicht für sie. Bis sie vor einem halben Jahr Gael kennenlernte.
Auf Zehenspitzen schleiche ich mich an den beiden vorbei oder zumindest versuche ich es, denn kaum, dass ich meine Hand auf die Klinke zur Badezimmertür lege, dreht Remi sich um.
»Du bist also endlich von den Toten auferstanden«, begrüßt sie mich.
Ich lächle schief. »Morgen, Remi.«
»Morgen?« Sie zieht die Nase hoch und wirft einen Seitenblick auf die Wanduhr. Es ist bereits Mittag, dabei hatte ich Remi versprochen, früh aufzustehen, um mit ihr in die Stadt zu fahren.
»Du hättest mich wecken sollen«, murmle ich.
»Und den Schlaf der Halbtoten stören? So wie du aussiehst, bin ich froh, dass du überhaupt aufgewacht bist. Was ist passiert?«
»Ich war im Lucha-Käfig. Ich habe gekämpft oder, na ja, zumindest habe ich es versucht«, gebe ich beschämt zu.
Zum Glück verschont Remedios mich mit weiteren Fragen. »Das sieht man«, sagt sie bloß. »Setz dich, wir haben verspätetes Frühstück gekocht.«
Ich lasse mich von ihr an den Küchentisch dirigieren, wo sich Zettel mit dem Lernmaterial zu unseren letzten Prüfungen stapeln. Remedios wischt die Papiere auf einen Haufen, um Platz zu schaffen. Ein klares Zeichen: Das Lernen ist vorbei, jetzt kommt der Sommer.
»Lass es dir schmecken«, meint Gael und stellt einen Teller dampfender Chilaquiles vor mich. Mein Magen grummelt laut, als der Essensgeruch mir in die Nase steigt.
»Danke«, murmle ich, woraufhin Gael mich anlächelt.
»Ich hoffe, du hast es deinem Gegner so richtig gegeben und er sieht genauso ramponiert aus wie du«, meint er.
»Schön wär’s.« Um nicht mehr sagen zu müssen, schaufle ich mir einen großen Bissen in den Mund.
Offenbar hat Gael mein Unbehagen nicht bemerkt, denn er fährt fort: »Diese Kämpfe sollen ganz schön gefährlich sein. Es ist beeindruckend, dass du es überhaupt lebendig aus dem Ring geschafft hast.«
Remedios schnaubt hörbar. Sie sitzt mit verschränkten Armen und düsterem Blick am Küchentisch und hat noch keinen einzigen Bissen probiert.
»Und mutig ist es auch, so einen Kampf zu wagen. Ich würde mich das nicht trauen«, fügt Gael hinzu, worauf Remi den Kopf schüttelt.
»Es ist nicht mutig. Es ist dämlich.«
Da hat sie recht, aber ich zucke nur die Schultern und senke den Kopf. Jetzt kann sie nur noch meinen Scheitel mit ihren Blicken verurteilen.
»Was wolltest du dir damit beweisen?«, fragt sie.
»Ich wollte wissen, ob ich gut genug bin.«
»Gut genug fürs Wrestling?« Sie lehnt sich über den Tisch. »Oder gut genug für die Götter?«
Sie kennt die Antwort, ohne dass ich etwas sagen muss.
»Hatten wir diese Diskussion nicht schon oft genug?«, frage ich und kann mich gerade mal so davon abhalten, die Augen zu verdrehen.
»Offensichtlich nicht, denn du hast es immer noch nicht kapiert«, gibt sie zurück und schaut mir fest in die Augen, während sie das Mantra wiederholt, das ich mir schon viel zu oft habe anhören müssen. »Du darfst deinen Wert nicht vom Urteil der Götter bestimmen lassen. Es gibt so viele Möglichkeiten auf dieser Welt, die nichts mit den Göttern zu tun haben, und wenn du das endlich begreifen würdest, könntest du deinen eigenen Weg finden. Abseits von Surayami.«
Ich nicke wie schon so oft zuvor. Tief in mir drin weiß ich ja, dass sie recht hat, doch der Wunsch, den Göttern zu gefallen, ist so fest in mir verankert, dass ich ihn trotzdem nicht loswerde.
»Ich verstehe es einfach nicht«, sagt sie.
»Natürlich tust du das nicht«, murmle ich in meinen Teller hinein. Wie sollte sie auch? Immerhin hat sie ihr Leben lang von allen auf der Insel gehört, dass sie etwas Besonderes ist. Die Priester sagten es, unsere Lehrer, unsere Mitschüler. Sogar meine eigene Mutter war der Meinung, dass Remedios, nicht ich oder meine kleine Schwester Sierra, besonders genug war, um von den Göttern erwählt zu werden.
Ich wünschte, wir könnten dieses Gespräch beenden, aber Remi fängt gerade erst an. »Wie kannst du dir ernsthaft wünschen, eine Götterkriegerin zu werden? Dein Leben, deine Familie, deine Ausbildung, alles hinter dir zu lassen, der gesamten Welt den Rücken zu kehren, um was zu tun? Bis in alle Ewigkeit irgendwelchen Götterwesen zu dienen?«, meint sie wild gestikulierend.
Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie Gael ihr eine Hand auf die Schultern legt.
»Ich werde sowieso nicht gewählt«, flüstere ich.
»Und darüber solltest du froh sein.« Ihre Stimme klingt jetzt sanfter, sie lehnt sich nach vorn und ergreift meine Hände, zwingt mich dazu, sie anzusehen. »Du hast doch gesagt, dass du Lehrerin werden möchtest. Das kannst du und ich bin sicher, dass du großartig darin wärst. Du könntest die Welt bereisen. Du könntest deine eigene Schule gründen, oder Künstlerin sein, oder dich verlieben. Oder von mir aus kannst du Profi-Wrestlerin werden und deinen eigenen Todeskampf-Ring eröffnen.« Ihre Lippen verziehen sich zu einem Grinsen. »In dem Moment, wenn du dein Token zurückbekommst und es einer anderen Sache widmest, geht dein Leben erst so richtig los! Du hast so viel Potenzial, ein außergewöhnliches Leben zu führen, und wenn du endlich diese dumme Idee loslassen könntest, dass du die Götter beeindrucken musst, würdest du das vielleicht begreifen.«
Ich verschränke meine Finger mit Remis. Die Berührung ihrer warmen Hände hat etwas Tröstliches. Gael räuspert sich verlegen. Die Situation scheint ihm unangenehm zu sein, vielleicht ist er auch bloß verwirrt. Kein Wunder, dieses ständige Gerede über die Götter muss für jemanden wie ihn, der nicht auf Surayami aufgewachsen ist und zum ersten Mal vor ein paar Monaten von Remedios von der Welt der fünf Sonnen gehört hat, ganz schön verrückt klingen.
»Du hältst uns bestimmt für durchgeknallt«, spreche ich meinen Gedanken aus.
»Ach was«, winkt er ab. »Solange ihr nicht anfangt, euch wie eure Azteken-Vorfahren anzuziehen und Leute zu opfern, komme ich mit euren Göttern ganz gut klar.« Dabei grinst er schief.
»Keine Sorge, mi amor. Noch ein Monat, dann müssen wir nie wieder über die Götter reden«, meint Remedios und drückt ihm einen Kuss auf die Wange. »Weil das Fest der fünf Sonnen dann vorbei sein wird.«
Das Fest der fünf Sonnen ist die größte Feierlichkeit auf unserer Insel: Alle elf Jahre, wenn sich der Schleier zur Götterwelt elf Tage lang lichtet, betreten die Götter unsere Welt. Um sie zu ehren, bereiten die Einwohner Surayamis ein Fest voller Musik und Tanz, bergeweise Essen, Gebete, Rituale und Opfergaben vor. Denn die Götter sollen ihre begrenzte Zeit in der Menschenwelt genießen.
»Und wenn das Fest vorbei ist, ziehen die Götter zurück in ihre Welt und diese Talismane, die ihr ihnen gewidmet habt, bekommt ihr zurück, und das ist aus irgendeinem Grund wichtig?« fragt Gael. Aus seinem Mund klingt unser Ritual wirklich wie ein Märchen.
»Tokens, nicht Talismane«, korrigiere ich ihn, womit ich mir ein Schnauben von Remi einfange.
Jedes neugeborene Kind auf Surayami erhält von den Priestern der Insel ein sogenanntes Token, eine kleine Steinfigur, die unsere Seele repräsentiert. Mit elf Jahren, während eines Rituals, in dem wir in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen werden, widmen wir dieses Token einem Lebensziel. Theoretisch könnte man sich jedes Ziel aussuchen, aber die meisten, ach was, alle Kinder Surayamis widmen ihr Token den Göttern, um eines Tages die Chance auf einen Platz als Krieger oder als Gefährte zu erlangen. Wenn das Götterfest vorbei ist, erhalten alle, die nicht auserwählt wurden, ihre Tokens zurück, um sie einem neuen Ziel zu widmen.
»Ist doch egal, wie dieses Steinding heißt!«, protestiert Remi, dabei weiß ich ganz genau, dass selbst ihr die Tokens wichtig sind, weswegen sie dem Tag entgegenfiebert, an dem sie ihres zurückbekommt.
Nun sagt sie aber: »Was zählt, ist, dass wir uns die nächsten elf Jahre keine Gedanken mehr über die Götter machen müssen.« An mich gewandt fügt sie hinzu: »Und über die Wahl denken wir nie wieder nach.«
»Die Wahl«, wiederholt Gael und zieht dabei jeden einzelnen Buchstaben so lang, als wollte er ihn auf der Zunge kosten. »Und wenn ihr ausgewählt werdet, dann kriegt ihr einen Ehrenplatz in der Zauberwelt der Götter?« In seiner Stimme schwingt mehr als eine Prise Sarkasmus mit.
Ich nehme es ihm nicht übel, immerhin würde ich uns diese Geschichte auch nicht glauben, wenn ich vor elf Jahren nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, wie ein Gott durch das Tor auf dem Sonnentempel unsere Welt betrat.
»Wir werden nicht ausgewählt. Ich zumindest nicht«, stößt Remedios aus.
»Und wenn doch?«, neckt er sie.
»Das werden wir nicht.«
Ihre Lippen sind so fest aufeinandergepresst, dass sie weiß anlaufen. Ich wünschte, Gael könnte verstehen, dass unsere Götter-Geschichten keine Märchen sind und dass Remedios ganze Nächte lang wach gelegen hat, aus Angst, ihrer Mutter in die Welt der fünf Sonnen folgen zu müssen. Den Stimmungsumschwung hat er immerhin bemerkt und zieht Remi in eine Umarmung.
»Ich wusste übrigens gar nicht, dass du mit Thiago befreundet bist«, sagt er schließlich in dem ungeschickten Versuch, das Thema zu wechseln.
»Wer?«, frage ich und ziehe die Augenbrauen hoch. »Der Name sagt mir nichts.«
»Der süße Kerl, der dich gestern nach Hause gebracht hat«, versucht Remedios mir auf die Sprünge zu helfen.
Jetzt bin ich endgültig verwirrt. Schließlich habe ich keine Ahnung, wie ich es vom Lucha-Käfig nach Hause geschafft habe. Ich krame in den Schubladen meiner Erinnerung herum, finde aber nichts Brauchbares. Meine Verwirrung schafft es wenigstens, Remedios aus ihrer düsteren Stimmung zu reißen.
»Ungefähr so groß wie Gael, hellbraune Augen, braune Haare. Er hat so einen Man-Bun«, erklärt sie und formt mit der Hand einen Halbkreis auf ihrem Hinterkopf, als würde sie einen Schneeball halten. »Er hatte einen Hoodie an und seine Kapuze übers Gesicht gezogen. Es sah echt gruselig aus, als er mit dir auf dem Arm vor der Tür stand. Erinnerst du dich wirklich nicht an ihn?«
Mein Herz setzt für eine Millisekunde aus. Hellbraune Augen, dunkler Hoodie – natürlich erinnere ich mich an ihn! Der Junge mit den Götter-Tattoos aus dem Lucha-Käfig. Aber wieso sollte ausgerechnet er mich nach Hause bringen? Woher wusste er überhaupt, wo mein Zuhause ist?
»Hatte er Tattoos?«, frage ich.
Ich will auf Nummer sicher gehen. Bestimmt ist alles nur ein Missverständnis und irgendein anderer Kerl mit ähnlicher Frisur und schwarzem Hoodie hat mich hergebracht.
Remedios meint schulterzuckend: »Keine Ahnung. Sein Outfit war ziemlich hochgeschlossen.«
»Er hat Tattoos, ziemlich viele sogar. Seine ganzen Arme und sein Oberkörper sind voll damit«, unterbricht Gael sie.
»Echt? Was denn für welche?«, will sie wissen.
Jetzt zuckt er die Schultern und auch ich halte mich bedeckt. Wenn Remi erfährt, dass es sich bei seinen Tätowierungen um heilige Glyphen handelt, würde ihre Aufregung sofort Misstrauen weichen.
»Was hat es mit dem Kerl auf sich?«, fragt sie mich.
»Ich habe ihn ein paarmal bei den Lucha-Kämpfen gesehen, aber nie mit ihm gesprochen. Gestern war er auch da.« Dass er selbst angetreten ist, behalte ich lieber für mich. »Er muss gesehen haben, wie ich gekämpft, na ja, verloren habe. Aber ich frage mich, woher er wusste, wo ich wohne.«
»Vermutlich hast du ihm das in deinem halbtoten Zustand gesagt und kannst dich nicht mehr daran erinnern«, wischt Remi meine Bedenken fort. An Gael gewandt fragt sie: »Wie ist er denn so? Du kennst ihn schließlich.«
»Kennen wäre zu viel gesagt. Er studiert auch Architektur, also haben wir ein paar Kurse zusammen, und gerade besuchen wir denselben Sommer-Workshop an der Uni. Ich habe aber nie mehr als zwei Sätze mit ihm gewechselt. Thiago ist eher ein Einzelgänger.«
»Hast du eventuell seine Telefonnummer oder sein Social Media Profil?«, frage ich Gael. »Ich würde mich gerne bei ihm bedanken.«
Außerdem würde ich ihn gerne nach seinen Tätowierungen fragen, nach seinem Training, nach den Göttern. Aber auch das sage ich nicht laut.
Zu meiner Enttäuschung schüttelt Gael den Kopf. »Leider nein. Aber er verbringt viel Zeit in der Uni, im Architekturtrakt. Ich laufe ihm ständig über den Weg, wenn ich da bin. Wenn du magst, kannst du mich mal auf dem Campus besuchen kommen und ich stelle euch vor. So richtig, meine ich, während beide von euch bei Bewusstsein sind.« Er grinst, wofür Remedios ihn in die Seite knufft.
»Zieh sie nicht auf!«
»Tue ich doch gar nicht.«
Es ist süß, die beiden auf diese liebevolle Art miteinander streiten zu sehen. Obwohl sie sich erst seit einem halben Jahr kennen, gehen sie vertraut miteinander um, testen die Grenzen des anderen, aber überschreiten sie niemals, während sie sich die ganze Zeit verliebte Blicke zuwerfen. Ich frage mich, ob ich jemals jemanden finden werde, der mich auf dieselbe Art anschaut wie Gael seine Remedios.
Schließlich löst Remi sich von Gael und meint: »Wir müssen los, Anahí. Ich konnte unseren Termin auf den Nachmittag verschieben, aber wir sind echt spät dran und du solltest dir das Blut vom Gesicht waschen, bevor wir aufbrechen. Nicht, dass die Leute meinen, ich schleppe eine Serienkillerin mit mir herum.«
»Du darfst sie also aufziehen«, grummelt Gael.
»Sie ist ja auch meine beste Freundin.«
»Das ist fair. Soll ich nicht doch mit euch beiden mitkommen?«, fragt er.
Aber Remi winkt ab. »Das ist nur für Anahí und mich. Du darfst das Ergebnis heute Abend bewundern.«
Er gibt sich gespielt enttäuscht, erhebt sich seufzend und macht sich daran, die dreckigen Pfannen abzuspülen. Ich nehme noch schnell ein paar Bissen, bevor ich mich ins Bad verabschiede, um mir unter der Dusche die Erinnerungen an meine schmachvolle Niederlage wegzuwaschen.
***
Wir nehmen die U-Bahn zum Viertel Republicá de Argentina, unweit des historischen Altstadtzentrums von Mexico City. Remedios spielt während der Fahrt mit ihrem Handy. Vermutlich verteilt sie Herzchen an ihre Online-Freunde auf Instagram, während ich nervös mit meinen Fingern spiele.
»Wieso machen wir das noch mal?«, frage ich zum gefühlt zwanzigsten Mal.
Remi schaut nicht einmal von ihrem Handy auf, als sie antwortet: »Als Zeichen. Um den Abschluss eines Abschnitts zu markieren und den Beginn eines neuen. Wir haben endlich den Schulabschluss in der Tasche und können im Herbst unser Studium beginnen!«
Dabei ist der Schulabschluss nur ein Vorwand für Remi. In Wahrheit geht es ihr darum, ein Zeichen zu setzen, damit jeder auf Surayami sieht, dass sie mit den Göttern abgeschlossen hat. Ich möchte auch ein Zeichen setzen. Allerdings dafür, dass ich nicht mehr das schüchterne Mädchen bin, das Surayami vor drei Jahren verlassen hat. Die Götter will ich im Gegensatz zu Remi nicht verärgern und frage mich gerade, ob es nicht klüger wäre, mit unserem Vorhaben bis nach der Feier zu warten.
Als habe sie meine Gedanken gelesen, sagt Remi: »Du musst nicht, wenn du nicht willst.«
Na toll, wenn ich kneife, wird sie mich für einen Feigling halten – und ich selbst mich ebenso.
An der Station Allende steigen wir aus und schlendern eine von Palisandern gesäumte Straße entlang, vorbei an kleinen Läden, in denen aufstrebende Designer ihre Mode verkaufen, an Bars, die zu dieser Tageszeit noch geschlossen sind, und an Coffeeshops.
Wenig später erreichen wir unser Ziel: Ein heruntergekommenes Gebäude im Kolonialstil, vor dessen Eingang ein Straßenschreier die besten und billigsten Tattoos und Piercings der Stadt anpreist. Wir folgen ihm durch ein breites Eingangstor in den etwas heruntergekommenen Innenraum. Der Fahrstuhl funktioniert nicht mehr, sodass wir die Treppe in den zweiten Stock hochlaufen. Dort liegt das Loro Negro, das Tattoo- und Piercing-Studio, wo wir uns schon zweimal haben beraten lassen.
Eine kleine Glocke über der Tür bimmelt, als wir öffnen. Kaum, dass ich einen Fuß über die Schwelle gesetzt habe, schlägt mir ein Schwall klimaanlagengekühlte Luft entgegen. Der Wartebereich besteht aus einer abgewetzten Ledercouch und einem Kaffeetisch, auf dem dicke Mappen mit Tattoo-Inspirationen liegen. Fotos von zufriedenen und anscheinend berühmten Kunden – auch wenn ich keinen davon kenne – bedecken die Wände. Gleich vor uns befindet sich die Empfangstheke, hinter der eine junge Frau mit kurzen silbergrauen Haaren und einem ganzen Haufen Piercings im Gesicht sitzt.
»Hola, Chicas, wie kann ich euch helfen?«
»Wir haben einen Termin«, antwortet Remi für uns beide. »Ich kriege ein Piercing und meine Freundin hier lässt sich ein Tattoo stechen.« Sie schaut zu mir und zwinkert. »Vielleicht«, fügt sie hinzu.
Ganz sicher, würde ich gerne erwidern, aber ich bleibe stumm. Mein Sinn für Humor ist mir beim Eintreten in den Shop vergangen. Als wir das letzte Mal hier waren und ich mich für ein Motiv entschieden habe – einen Kaktus in der Form eines menschlichen Herzens mit einer Blüte an der Stelle der Aorta – haben die Aufregung und das gute Gefühl, die Regeln zu brechen, meine Nervosität überlagert. Damals lagen zwischen mir und der Nadel des Tätowierers allerdings noch ein paar Wochen. Heute bekomme ich kaum ein Wort heraus.
»Ah, das Septum und das Kaktusherz, richtig?«, erkundigt sich die Rezeptionistin. »Tony ist gleich bereit für euch. Setzt euch doch so lange.«
Ich lasse mich neben Remedios auf dem durchgesessenen Sofa nieder. Sie wirkt völlig ruhig, während meine Finger zittern.
»Bist du dir sicher, dass du das durchziehen willst?«, will sie wissen. Dieses Mal höre ich keinen Sarkasmus aus ihrer Stimme. Sie scheint sich aufrichtig Sorgen zu machen.
»Keine Ahnung. Bist du denn sicher?«, frage ich zurück, was sie mit einem bestimmten Nicken beantwortet.
Denn das, was sie vorhat, sich ein Loch durch den Knorpel unterhalb der Nasenscheidewand bohren zu lassen, ist weit drastischer als mein Tattoo, zumindest nach den Regeln von Surayami. Dieses Piercing ist ein kleiner Akt der Rebellion, ein Fuck You an die Götter.
Obwohl viele Surayamesen tätowiert sind, ist es uns nicht erlaubt, unsere Haut für Schmuck durchstechen zu lassen. Selbst harmlose Ohrlöcher sind verboten. Remedios sagt, diese Regel sei Blödsinn, immerhin sticht die Nadel eines Tätowierers auch durch die Haut, und vermutlich hat sie recht. Aber auch wenn eine Regel keinen Sinn ergibt, bleibt sie eine Regel.
Und Remedios bricht die Regeln Surayamis aus Prinzip. Sie spricht abfällig über die Götter, richtet nie einen Opferaltar, nicht einmal an den Feiertagen, raucht, trinkt und isst, worauf sie Lust hat, obwohl sie als potenzielle Gefährtin vor der Götter-Wahl ihren Körper reinhalten und sich so gesund wie möglich ernähren soll. Nun lässt sie sich ein Nasenpiercing stechen, obwohl die Natürlichkeit ihres Gesichts für die Götter wichtig ist.
Alles, damit sie nicht von den Göttern berufen wird. Die Wahl ist das wichtigste Ritual während des Fests der fünf Sonnen, denn dabei suchen die Götter aus den jungen Männern und Frauen ihre zukünftigen Gefährten und Krieger aus. Die Gefährten werden für die Götter sowohl Partner als auch Berater sein, die Krieger werden sie beschützen, und alle werden sie gemeinsam mit den Göttern in der Welt der fünf Sonnen leben.
Die meisten Jugendlichen bereiten sich jahrelang auf dieses Ritual vor, tun alles, um würdig zu sein. Doch nur eine Handvoll wird ausersehen. Als Kind habe ich mein Token gewidmet, um eine Kriegerin zu werden. Remi setzte ihres für eine Rolle als Gefährtin ein: ein Fehler, den sie bis heute aufs Tiefste bereut. Schon damals haben wir eingebläut bekommen, dass nur diejenigen, welche die Götter ehren und deren Regeln strickt befolgen, die Möglichkeit erhalten, in die Welt der fünf Sonnen zu ziehen. Und Remi tut alles, damit ihr diese Chance auf keinen Fall geboten wird. Das Piercing ist nur die Kirsche auf der Spitze der Regelbruch-Torte.
Ich verstehe sie ja. Wenn mir mein Leben lang erzählt worden wäre, dass ich etwas Besonderes bin – besonders genug, um von den Göttern erwählt zu werden – und wenn ich die Götter so wie sie hassen würde, würde ich auch auf Nummer sicher gehen wollen.
Eine Tür hinter der Rezeption öffnet sich und Tony, der Piercer und Tätowierer, tritt heraus.
»Bereit?«, fragt er.
Sofort erhebt Remedios sich. »Und wie!«
Ich folge ihr zögerlich durch die Tür in einen Raum, in dessen Mitte ein Stuhl für die Kunden bereitsteht. Remedios lässt sich fröhlich plaudernd dort nieder, während ich beobachte, wie Tony einen kleinen Rolltisch heranschiebt, auf dem die Nadel, Desinfektionsmittel, Wattebäusche und die Zange, ein scherenartiges Gerät, an dessen Ende zwei Röhrchen befestigt sind, liegen. Während er sich schwarze Gummihandschuhe überstreift, erklärt er Remedios noch einmal die Prozedur. Sie wirkt glücklich, wenn auch etwas aufgeregt, und lächelt die ganze Zeit.
Und ich? Mir wird beim Anblick der Nadel übel. Ich versuche meinen Magen zu beruhigen, atme tief aus und ein. Kein Grund, jetzt schon Panik zu kriegen, immerhin bekomme nicht ich das Piercing, und im Lucha-Käfig habe ich weit brutalere Dinge gesehen. Nur, dass mein Magen mit einem zu Brei geschlagenen Gesicht offenbar besser klarkommt als mit einer Nadel. Als Tony die Zange an Remedios Nase legt, um die genaue Position des Piercings zu bestimmen, ist es mit dem letzten Rest an Ruhe vorbei. Ich spüre, wie der Magensaft meine Speiseröhre hochsteigt. Jeden Moment werde ich mich übergeben.
»Ich … tut mir leid, ich muss weg«, murmele ich und stürme nach draußen.
***
Ich laufe ziellos die Straße entlang und bin wütend auf mich selbst. Erst lasse ich mich im Lucha-Käfig zusammenschlagen und dann flippe ich im Piercingstudio aus. Bestimmt ist Remedios enttäuscht von mir.
Als ich müde werde, bleibe ich stehen und merke, dass mein planloser Spaziergang mich vor das Schaufenster eines Friseursalons geführt hat. Das Innere ist reinweiß, nur die Spiegel sind mit dickem Gold umrahmt. Insgesamt gibt es nur vier Plätze in dem kleinen Laden. Einer davon ist frei. Ob das ein Wink der Götter ist?
Bestimmt nicht, andererseits habe ich mir tatsächlich eine Veränderung gewünscht. Ein Zeichen des Abschlusses, wie Remi es genannt hat, und wenn ich mir schon kein Tattoo stechen lasse, könnte ich wenigstens meinen Haarschnitt verändern.
Ich betrete den Laden und bleibe am Eingang stehen. Nach ein paar Sekunden hat mich eine ältere Friseurin entdeckt und begrüßt mich.
»Ich habe keinen Termin«, sage ich.
»Sie haben Glück, wir haben gerade etwas frei«, meint sie und bedeutet mir, auf dem freien Stuhl Platz zu nehmen. »Was möchten Sie denn machen lassen?«
»Ich würde mir gerne die Haare schneiden lassen.«
»Nur die Spitzen oder etwas mehr?«
Ich deute auf meinen Hals, auf die Höhe des Kehlkopfs.
»Ein Long Bob also?«, hakt die Friseurin nach und betrachtet skeptisch meine taillenlangen Haare.
»Ja, genau.«
»Das wird Ihnen sicher stehen«, meint sie lächelnd.
Das hoffe ich.
»Und färben möchte ich auch«, füge ich hinzu und kann im Spiegel beobachten, wie ihre Augenbrauen sich heben.
»Es gibt wohl eine große Veränderung in Ihrem Leben.«
»Wie bitte?«
»Viele Kundinnen tun das. Wenn sich ihr Leben verändert, verändern sie auch ihren Haarschnitt. Kurze Haare für einen neuen Job, ein Pony für den Schulabschluss, rote Strähnchen vor der Verlobung.« Ach, so meint sie das. »Welche Farbe hätten Sie denn gerne?«
»Ähm.« Ich lasse meinen Blick über die gesichtslosen Puppenköpfe wandern, die auf einem Regalbrett an der Wand aufgereiht sind und Perücken mit den unterschiedlichsten Frisuren tragen. Gold- und platinblond. Schwarz, braun und rot. Mein Blick bleibt an einer Puppe am rechten Rand hängen, die einen blitzblauen Bob trägt.
Warum eigentlich nicht? Wenn schon eine Veränderung, dann drastisch.
»Die Farbe dort. Die möchte ich«, sage ich und deute auf den Puppenkopf mit den blauen Haaren.
***
Anahí, 7 Jahre alt
Auf dem Festplatz standen Hunderte von Leuten, mehr, als Anahí je in ihrem Leben gesehen hatte. Die Frauen hatten Blumen in ihre Haare geflochten, die Männer Goldketten umgehängt und über ihren Köpfen hingen ganze Sträuße saftiger Dahlien.
Anahí klammerte sich an der Hand ihrer Mutter fest, als das Sonnentor ein dumpfes Grollen ausstieß. Licht- und Farbschlieren formten im Zentrum des Tors einen Strudel, aus dem kleine Tropfen wie Regenbogensprenkel spritzten. Anahís Herz pochte so schnell wie die Flügel eines Kolibris. Sie drückte sich gegen den Rock ihrer Mutter, die mit halb offenem Mund zum Tor starrte, und vergrub ihr Gesicht im Stoff.
Wieder donnerte es, lauter dieses Mal, als habe ein Blitz im Tempel eingeschlagen, und mit einem Mal verstummten alle Geräusche. Das aufgeregte Wispern der Menschen, das Schreien der Babys, selbst das Zwitschern der Vögel verklang. Bis eben hatte der Wind die Palmenwedel tanzen lassen, doch nun hingen diese reglos in der Luft.
Vorsichtig löste Anahí ihr Gesicht aus dem Rock ihrer Mutter und schaute zum Tor, das auf der höchsten Plattform des Tempels thronte. Der Farbenwirbel war verschwunden, stattdessen breitete sich im Torbogen eine nie gekannte Schwärze aus, die alles zu verschlucken drohte.
Drei Herzschläge lang passierte nichts, doch dann ging ein Wirbel durch die Schwärze und eine Gestalt löste sich aus ihr heraus. Ein Mensch, ob Mann oder Frau wusste Anahí nicht zu sagen, dessen Gestalt in einen weißen Umhang gehüllt war. Licht strahlte von ihm aus, eine Art elektrische Energie, die alle Umstehenden streifte, auch Anahí. Da begriff sie, dass das dort oben gar kein Mensch war, sondern ein Gott.
Sie fühlte Wärme in sich aufsteigen, die sich von ihrer Brust über die Arme und Beine bis in die Spitzen ihrer Finger und Zehen ausbreitete. Ein prickelndes, nie gekanntes Gefühl, von dem ihre Mutter ihr später erzählen würde, dass es Liebe war.
El velo – Der Schleier
Seit meiner Niederlage im Lucha-Ring ist fast eine Woche vergangen. Meine Blutergüsse verblassen langsam, sodass das einzig Blaue an mir nun meine Haare sind, und obwohl meine Rippen noch immer schmerzen, habe ich mein tägliches Kampftraining wieder aufgenommen, das ich so kurz vor der Kriegerwahl auf keinen Fall vernachlässigen darf. Jeden Morgen gehe ich laufen, um meine Ausdauer zu trainieren, an den Abenden besuche ich einen lokalen Club für Kampfsportarten, wo ich mich von den Trainern unterweisen lasse oder an den Sandsäcken und Fitnessgeräten meine Muskeln stärke, und den ganzen Tag über nutze ich freie Momente für die Atem- und Konzentrationsübungen, die Don Allende mir beigebracht hat.
Was im Gegensatz zu meinen Wunden nicht verblasst, ist die Erinnerung an den Jungen mit den Götter-Tattoos. Ständig schweifen meine Gedanken zu ihm ab. Ich frage mich, wer er ist und warum er mir geholfen hat.
Als ich während des Abendessens wieder einmal in Gedanken versunken bin, stellt Remi fest: »Ich weiß, woran du denkst. Dieser Typ hat dir ordentlich den Kopf verdreht. Mach doch, was Gael vorgeschlagen hat, und besuch ihn an der Uni.«
»Wenn Thiago mich sehen wollte, hätte er mir seine Nummer hinterlassen«, entgegnete ich.
»Vielleicht wollte er sich nicht aufdrängen. Du warst immerhin ohnmächtig. Dass du mit seiner Nummer in der Tasche und ohne Erinnerung aufwachst, hätte einen ganz schön falschen Eindruck hinterlassen können.«
Ich möchte, dass Remi recht hat. Ich hoffe, dass er nur rücksichtsvoll war und mich eigentlich wiedersehen will. So sehr möchte ich das, dass ich am nächsten Tag zum Campus der staatlichen Universität von Mexico City fahre, genauer gesagt in die Fakultät für Architektur.
Gael hat mir erzählt, dass er und Thiago gemeinsam einen Sommerkurs über moderne Architektur belegen, der in einer Viertelstunde enden wird. Also sitze ich vor dem Hörsaal und warte. Schon wieder grummelt mein Magen, wie immer, wenn ich nervös bin. Dabei sind heute weder muskelbepackte Kämpfer noch Nadeln in Sicht. Pünktlich zum Kursende öffnen sich die Türen und spucken eine Lawine an jungen Studierenden aus, die sich plaudernd über den breiten Flur verteilen. Ich stelle mich auf die Zehenspitzen, um Thiago zu finden. Es sind so viele Leute. Wenn ich nicht aufpasse, wird er an mir vorbeilaufen, ohne dass ich ihn bemerke.
Da sehe ich, wie Gael aus dem Vorlesungssaal tritt, einen Rucksack lässig über die Schulter geworfen. Zwei Studentinnen gehen neben ihm und werfen ihm verliebte Blicke zu. Gael ist attraktiv, daran ist nichts zu rütteln. Er ist groß, trägt sein dichtes Haar in einem James-Dean-Schnitt, und unter seinen Augenbrauen liegen wachsame Rehaugen. Außerdem trainiert er, was man seiner Statur deutlich ansieht. Es wundert mich nicht, dass seine Kommilitoninnen ein Auge auf ihn geworfen haben. Pech für die beiden, dass er bis über beide Ohren in Remi verliebt ist.
Als er mich sieht, winkt er und kommt mit breitem Lächeln auf mich zu. Die zwei Studentinnen schauen ihm bedröppelt hinterher.
»Anahí? So eine Überraschung. Kommst du mich besuchen?«