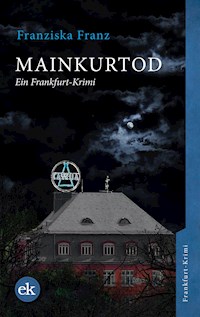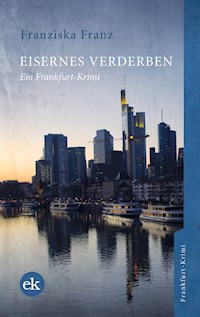Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Privatermittlerin Karla Senkrecht
- Sprache: Deutsch
Ein Notarzt wird nachts zu einem Einsatz im Frankfurter Diplomatenviertel gerufen. Ein Fahrradfahrer soll verunglückt sein. Am nächsten Morgen ist der Arzt tot, eine Joggerin entdeckt seine blutüberströmte Leiche. Von den ebenfalls an den Unfallort bestellten Sanitätern fehlt jede Spur. Wurden auch sie umgebracht? Privatermittlerin Karla Senkrecht greift zu äußerst ungewöhnlichen Ermittlungsmethoden und sieht sich plötzlich mit der Planung ihrer eigenen Bestattung konfrontiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Franziska Franz
Maingrab
Kriminalroman
Zum Buch
Unbändige Wut Im Frankfurter Diplomatenviertel findet eine Joggerin an einem frühen Sommermorgen einen bestialisch zugerichteten Leichnam. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei dem Toten um einen Notarzt, der während eines Einsatzes einem brutalen Verbrechen zum Opfer fiel. Von den beiden Sanitätern, die vor Ort hätten sein müssen, fehlt jede Spur. Sind auch sie dem Täter in die Hände gefallen? Zunächst ist die Kripo ratlos, denn alle Spuren führen ins Nichts. Doch dann taucht die verschwundene Sanitäterin ausgerechnet auf dem Gelände eines Krematoriums auf und bittet um Hilfe, da sie den Notarzt ermordet hat. Aber der Fall wird immer verworrener. Privatermittlerin Karla Senkrecht mischt sich in die Polizeiarbeit ein und bietet ihrem guten Freund Kommissar Herbracht ihre Hilfe an. Und das zu Recht, wie sich bald herausstellt, denn sie hegt einen ungeheuren Verdacht.
Franziska Franz, geboren in Detmold, lebt in Frankfurt am Main. Dank ihrer Schauspielausbildung und ihrer Fernseherfahrung hält sie lebendige Lesungen und hat keinerlei Scheu, auf einer Bühne zu stehen. Ihre Leidenschaft fürs Schreiben entdeckte sie mit Abenteuergeschichten für Kinder im didaktischen Bereich. Später veröffentlichte sie Kurzkrimis in Anthologien und parallel dazu Thriller und Kriminalromane. Seitdem fühlt sie sich im Krimigenre beheimatet. Sie ist Mitglied im Syndikat. 2021 war sie Mitglied der Jury für den Friedrich-Glauser-Preis in der Sparte „Debüt“.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Bilderstoeckchen / stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-7506-1
Zitat
»Ich kann, weil ich will, was ich muss.«
Immanuel Kant
Kapitel 0
Hass keimt im tiefsten Inneren wie auch meine Liebe zu dir. All mein Handeln entspringt dieser Liebe. Niemand kann uns je trennen. Nicht einmal der Tod.
Kapitel 1
Mittwoch, 19. Juni, Diplomatenviertel, 0:30 Uhr
Als der Notarzt Thomas Wacker in der Günther-Groenhoff-Straße eintraf, entdeckte er einen Krankenwagen, der am Ende der Einbahnstraße die Fahrbahn versperrte. Wacker war vor 20 Minuten zum Einsatzort gerufen worden. Seine Kollegen konnten nicht lange vor ihm dagewesen sein. Wacker parkte sein Fahrzeug direkt hinter dem Krankenwagen, dessen Türen offenstanden. Er stellte den Motor ab und stieg aus. Von den Kollegen und vor allem von dem verletzten Fahrradfahrer, der verunglückt war, fehlte jede Spur. Das Fahrrad des angeblichen Opfers war nirgends zu sehen. Er blickte ins Innere des Einsatzfahrzeugs, die Trage befand sich darin. Er ging um den Wagen herum. Vielleicht hatte sich der Unfall vorn abgespielt?
Die enge Anliegerstraße grenzte an die Frauenlobstraße. An der Gabelung war ebenfalls nichts Auffälliges zu erkennen. Kein Mensch weit und breit. Nichts deutete auf einen Unfall hin. Thomas Wacker drehte sich um die eigene Achse. Das war unheimlich. Waren sie in die falsche Straße geschickt worden? Wenn ja, wo waren dann seine Kollegen? Und wieso waren die Türen des Krankenwagens geöffnet worden? Gerade wollte er in der Zentrale nachfragen, da hörte er den Schrei: »Hilfe!«
Er blieb wie angewurzelt stehen. Ein weiterer Hilferuf. Hastig überquerte Wacker die Frauenlobstraße, den Rufen folgend, lief zum Eckhaus, das von einer roten Sandsteinmauer umgeben war und an die Ginnheimer Landstraße grenzte.
»Hilfe!«
Eine Frauenstimme. Die Sanitäterin? Er beschleunigte seine Schritte, an der Mauer entlang, die Ginnheimer Landstraße aufwärts. »Ich komme!«, rief er, als er am Ende des ummauerten Eckgrundstücks angelangt war. Ein düsterer Weg mündete in den kleinen, ebenfalls unbeleuchteten Park. Er kannte den Ausläufer des Grüneburgparks, war mehrfach mit seinem Lebensgefährten Martin dort gewesen. Linker Hand ein Hügel mit Baumgruppe, rechts dichtes Gebüsch. Er durchquerte das Gatter, das verhinderte, dass Fahrzeuge in den Park einfuhren, konnte jedoch kaum etwas sehen.
»Wo sind Sie?«, rief er.
»Helfen Sie mir bitte!«
Wacker versuchte, sich im Dunkeln zu orientieren, während er in der Gesäßtasche nach seinem Handy suchte, um dessen Taschenlampenfunktion zu aktivieren. Da verspürte er einen schmerzhaften Stich zwischen den Schulterblättern. Er stöhnte auf und fiel keuchend bäuchlings zu Boden.
*
Diplomatenviertel, 5:36 Uhr
Der kleine Park war mit Absperrbändern versehen, Polizei und Spurensicherung waren vor Ort. Um den Toten vor den neugierigen Blicken der Schaulustigen zu verbergen, war ein weißes Zelt über dem Leichnam aufgebaut. Spurenkarten markierten Blut- und Fußspuren.
Am frühen Morgen wareine Hundehalterin auf den Mann aufmerksam geworden, der blutüberströmt bäuchlings liegend den Zugang zum Park blockierte. Sie hatte die Polizei alarmiert. Ein von der Polizei hinzugezogener Notarzt hatte nur noch seinen Tod feststellen können.
Der Krankenwagen, der zu diesem Zeitpunkt noch in der Günther-Groenhoff-Straße gestanden hatte, war kurze Zeit später von der Polizei gesichert, auf Spuren untersucht und abgeschleppt worden.
Die am Fundort eingetroffenen Polizisten vom Kriminaldauerdienst hatten sogleich die Spurensicherung und die Staatsanwältin informiert, um eine rechtsmedizinische Untersuchung mit anschließender Obduktion zu erwirken. Erschienen war Frau Dr. Ricarda Jacoby vom rechtsmedizinischen Institut.
Jacoby erkannte schnell, dass der Tod durch scharfe Gewalt eingetreten war. »Etliche Messerstiche, ganz klar erkennbar. Ist er einer der Sanitäter?«
Der Beamte vom Dauerdienst schüttelte den Kopf. »Er war vermutlich der Notarzt. Zumindest den Papieren nach.«
In diesem Moment hielt ein Einsatzfahrzeug auf dem Radweg nahe dem Parkeingang.
Ein Mann und eine Frau stiegen aus, beide trugen weiße Overalls, streiften sich Füßlinge über, zogen drei Lagen Gummihandschuhe übereinander und näherten sich entlang der Absperrbänder dem Tatort. Hauptkommissar Kai Herbracht, 47 Jahre alt und erfolgreicher Ermittler der Frankfurter Mordkommission, und seine Kollegin Mia Dragovic, eine 34 Jahre junge und erfolgversprechende Kriminalpolizistin.
»Würdet ihr bitte aufpassen, wo ihr hintretet? Hier wimmelt es nur so von Fußspuren, da will ich nicht auch noch eure fälschlicherweise sichern«, rief Jens Sailer von der Spurensicherung den beiden zu, während er ein benutztes Papiertaschentuch mit einer Einmal-Pinzette in eine der atmungsaktiven Deba-Breathe-Tüten schob.
Herbracht blickte zu dem Leichnam hinüber, der auf dem Bauch in einer Blutlache lag. »Habt ihr im Blut Fußspuren ausmachen können?«
»Eine Spur. Die hört aber gleich daneben wieder auf.« Sailer deutete auf einen dunklen Abdruck etwa zwei Meter neben der Blutlache. »Wir gießen den aus. Und wir haben noch etwas entdeckt.« Sailer holte eine Tüte aus dem Asservatenbeutel und hielt sie den Polizisten vor die Nase.
Herbracht verengte die Augen. Dragovic stutzte. »Was soll das sein, eine Schlaufe?«
»Ja, eine dunkelblaue Schlaufe aus Gummi mit einem Metallstück daran in derselben Farbe.«
»Das hat im Blut gelegen?«, fragte Herbracht.
»Exakt.«
»Was könnte das sein? Der Schieber eines Reißverschlusses?«
»Vielleicht von einem Rucksack?«, ergänzte Herbracht.
»Vielleicht auch von der Jackentasche eines Gummimantels?«
»Wir werden das Ding genauer unter die Lupe nehmen«, sagte Sailer und steckte die Tüte zurück in den Asservatenbeutel.
»Ah, da hockt ein bekanntes Gesicht am Boden.« Herbracht kannte die Rechtsmedizinerin, die neben der Leiche kniete. »Guten Morgen, Dr. Jacoby.«
Die Ärztin blickte auf. »Guten Morgen, Hauptkommissar Herbracht. Schön, Sie zu treffen, würde in diesem Zusammenhang allzu makaber klingen.«
»Sieht ziemlich schlimm aus«, befand Herbracht. »Das ist meine Kollegin, Kommissarin Mia Dragovic.«
»Hallo, Frau Dragovic. Ich hatte schon oft mit Hauptkommissar Herbracht zu tun. Sind Sie neu im Team?«
»Ja, das bin ich.«
»Dann werden Sie jetzt gleich so richtig ins kalte Wasser geworfen. Das hier muss das Werk eines Wahnsinnigen sein.« Sie deutete auf den Toten, der über und über mit Blut besudelt war. »Meine Arbeit ist beendet. Die Leiche kann ins rechtsmedizinische Institut überführt werden.«
»Können Sie uns vorab schon ein paar Informationen geben? Wie lange der Mann tot ist beispielsweise?«, fragte Herbracht.
»Nur in etwa.« Jacoby richtete ihren Blick auf den Leichnam. »Die Leichenstarre ist bereits ausgeprägt, die Leichenflecken sind deutlich sichtbar. Ich habe seine Temperatur gemessen. Wenn ich von der Normaltemperatur, nämlich von 37 Grad Celsius, ausgehe, dann ist seine Körpertemperatur um 2,5 Grad gesunken. Die Temperatur sinkt nach Eintritt des Todes pro Stunde um 0,5 bis 1,5 Grad Celsius, wie Sie wissen.«
Herbracht stimmte zu. »Die Nacht war allerdings sehr lau.«
»Richtig, deshalb gehe ich von einer geringeren Absenkung aus, da die Außentemperatur heute Nacht bei 17,5 Celsius lag und jetzt schon wieder deutlich höher ist. Mithilfe der Henßge-Tabelle lässt sich also errechnen, dass der Mann wahrscheinlich heute Nacht zwischen 0:30 Uhr und 1 Uhr verstarb.«
Giulio Esposito, ebenfalls Kripobeamter, kam hinzu und reichte Herbracht ein Dokument. »Tag, Kai. Das ist der Ausweis des Toten. Es handelt sich um den Notarzt Thomas Wacker. Er wurde heute Nacht zu einem Fahrradunfall in der Günther-Groenhoff-Straße gerufen. Der Notruf ging um 0:10 Uhr bei der Zentrale ein. Der Anrufer, sein Name war Müller, meldete einen Schwerverletzten in der Günther-Groenhoff-Straße. Die Verbindung war laut Zentrale schlecht. Die Nummer des Anrufers wird von den Kollegen derzeit überprüft. Ich melde mich diesbezüglich bei dir. Laut Zentrale haben sich zwei Sanitäter unmittelbar auf den Weg gemacht, während der Notarzt um 0:20 Uhr aufbrach, also etwa zehn Minuten später. Den Krankenwagen fanden wir verwaist und mit offen stehenden Türen in der Günther-Groenhoff-Straße, Ecke Frauenlobstraße. Von dem angeblichen Unfall keine Spur, kein Blut, kein Fahrrad, nichts. Wir haben die Anwohner mittlerweile alle befragt. Die schlafen anscheinend alle nach hinten raus. Jedenfalls will niemand etwas gehört haben. Nun gut, ist eine Anliegerstraße mit wirklich hohen, dichten Hecken. Man kann kaum die wenigen Häuser dahinter erkennen. Allem Anschein nach scheint es keinen Unfall gegeben zu haben. Echt irre.« Esposito biss sich auf die Unterlippe.
»Wo sind die Sanitäter?«, fragte Herbracht.
Der Beamte zuckte die Schultern. »Die haben sich in Luft aufgelöst. Von ihnen fehlt jede Spur. Selbst unsere Suchhunde sind bisher nicht fündig geworden. Sie haben im vorderen Bereich des Parks angeschlagen, weiter drinnen nicht mehr.«
»Also dort, wo der Leichnam liegt?«
»Ja.«
»Was ist mit der Tatwaffe?«
»Fehlanzeige. Sämtliche Büsche und das kleine Wäldchen dort«, er deutet auf den Hügel, »wurden durchkämmt. Aber ich habe die Namen der beiden Sanitäter. Es waren ein Mann und eine Frau.«
Dragovic nickte zu einer am Rande des Parks stehenden, blass aussehenden Frau im Jogginganzug, die von einem Mann gestützt wurde. Er hielt einen Labrador an der Leine. »Zeugen?«
»Die junge Frau hat den Leichnam gefunden«, sagte der Beamte.
»Okay, lass uns mal hingehen, sie macht nicht den Eindruck, als würde sie das hier noch lange durchhalten«, sagte Herbracht. Gemeinsam mit Mia Dragovic ging er hinüber. »Guten Morgen, mein Name ist Herbracht, Kriminalpolizei. Das ist meine Kollegin, Kommissarin Dragovic.«
»Berger, Sabrina Berger. Das ist mein Mann«, sagte die Frau mit belegter Stimme. »Es ist ein Albtraum.«
»Ich glaube, es wäre besser, wenn wir bald nach Hause gehen könnten«, sagte der Ehemann. »Meiner Frau geht es gar nicht gut.«
»Verständlich, das muss für Sie ein Schock gewesen sein. Nur kurz, Frau Berger. Sie haben den Mann heute Morgen entdeckt?«
»Ich werde nie wieder joggen«, sagte Frau Berger. »Ich dachte erst, er sei betrunken. Doch Sam begann zu bellen«, sie deutete auf den schwarzen Labrador. »Das macht er sonst nie. Und dann bemerkte ich das Blut. Schrecklich viel Blut.« Sie stockte. »Ich wäre beinahe reingetreten.«
»Der Mann hat sich nicht mehr bewegt?«
Berger schüttelte den Kopf und stotterte: »Ich … ich habe ihn mehrfach angesprochen. Er reagierte nicht. Berühren konnte ich ihn nicht. Ich hatte solche Angst. Dabei ist das eine sichere Wohngegend, dachte ich zumindest immer, hier rechnet man nicht mit so was.«
»Sabrina, habe ich dir nicht oft genug gesagt, renn nicht allein am frühen Morgen herum? Wir leben in einer Großstadt, nicht auf dem Dorf«, sagte ihr Mann.
»Das heißt erst einmal nichts. Viele Verbrechen geschehen draußen auf dem Land«, sagte Herbracht und wandte sich erneut an die Frau. »Haben Sie gleich die Polizei gerufen?«
»Nein, nicht sofort. Ich wusste im ersten Moment gar nicht, was ich machen sollte. Es war schrecklich. Vor lauter Zittern konnte ich kaum mein Handy halten. Schließlich habe ich die 112 gewählt. Es heißt, dass man zuerst den Notruf anrufen soll. Ich habe aber gesagt, dass ich glaube, die Polizei werde auch benötigt. Ach Gott, ich werde das nie wieder vergessen, nie, nie wieder.«
»Komm, beruhig dich, ich bin ja bei dir«, sagte der Mann und legte einen Arm um die Schulter seiner Frau.
»Sie haben alles richtig gemacht«, lobte Herbracht. »Sind Sie dortgeblieben, bis ein Einsatzfahrzeug kam?«
»Ich wusste, dass ich bleiben muss, aber es war so gruselig, ich hatte solche Angst. Also rief ich meinen Mann an, dass er kommen soll. Schließlich konnte ich nicht wissen, ob der Mörder noch in der Nähe war. Oh Gott, wie sich das anhört! Ein Mörder – ausgerechnet hier!« Sie krallte sich am Arm ihres Mannes fest.
»Wir können Ihre Reaktion verstehen, Frau Berger. Ist Ihnen noch irgendetwas aufgefallen? Haben Sie ein Auto bemerkt oder einen Spaziergänger, irgendetwas, das Ihnen komisch vorkam?«
»Nein, nein, gar nichts. Ich muss aber gestehen, dass ich an der Ecke zur Frauenlobstraße gewartet habe. Ich habe mich nicht getraut, bei dem … bei dem Mann zu bleiben. Da war überall Blut. Hätte ich …?« Sie stockte.
»Schon gut. Wenn wir Sie fürs Protokoll noch einmal zu uns bitten dürften, ich meine aufs Präsidium, dann würde ich Sie jetzt entlassen. Hat der Kollege«, Herbracht trat zu dem Beamten des Kriminaldauerdienstes, der sich in der Nähe aufhielt, »Ihre Personalien aufgenommen?«
»Hat er.«
»Gehen Sie nach Hause. Haben Sie es weit? Soll Sie jemand fahren?«
Der Ehemann winkte dankend ab. »Wir wohnen in der Frauenlobstraße. Das schaffen wir, nicht wahr, Schatz?«
»Ja. Komm, Sam«, sagte sie und der Labrador, der geduldig neben seinem Herrchen gesessen hatte, stand auf und setzte sich in Bewegung.
Herbracht und Dragovic gingen zurück zu Jacoby, die ihre Sachen zusammenpackte. »Wir bringen ihn ins Institut, zur genaueren Untersuchung. Der Leichenwagen steht schon bereit.« Sie zeigte auf den Parkeingang. »Eins scheint ziemlich sicher zu sein: Der Mann ist an der Stelle, an der er liegt und verstarb, auch niedergestochen worden. Wir nehmen gleich morgen Früh die Obduktion vor. Heute stehen leider noch andere Sektionen an. Sie werden sicher vorbeikommen wollen. Schon wegen des Protokolls.«
»Natürlich!«, antwortete Herbracht.
Gerade bogen weitere Polizisten mit Spürhunden um die Ecke.
»Habt ihr irgendwas für uns?«, wollte Herbracht wissen.
»Rein gar nichts«, antwortete einer der Polizisten. »Weder die Tatwaffe noch Spuren beider vermisster Personen.«
Der Kollege blickte auf einen schmalen Weg, der hügelauf führte. »Oben rechts hinter einem Zaun ist, einem Schild nach zu urteilen, Vogelschutzgehölz. Wir sind durch ein Loch reingekrochen.« Er klopfte sich die Ärmel ab. »Viel Gestrüpp und umgestürzte Bäume. Wenn man da jemanden oder etwas verstecken wollte, könnte man das sicherlich relativ unbemerkt tun. Würde zunächst niemandem auffallen. Aber er hier ist Leichenspürhund.« Der Beamte tätschelte den Kopf seines Schäferhundes. »Er hat mich noch nie im Stich gelassen. Nicht wahr, Jack?« Der Hund sah sein Herrchen ergeben an und winselte. »Nein, da drin liegt niemand.«
»Noch weiter oben befindet sich eine Schrebergartenanlage«, sagte der andere Hundeführer. »Wir fanden nichts Auffälliges. Mein Brutus ist spezialisiert auf Blutspuren. Er riecht Blut meilenweit. Und sehen Sie nach links …«, er wies auf einen höher gelegenen Weg. »Dort kommt man zu einem Radweg. Liegt direkt oberhalb der A66. Entlang der gesamten Strecke gibt es einen seitlich abfallenden Steilhang, der runter zur Autobahn reicht. Da könnte leicht jemand runterstürzen. Wir haben jedenfalls das ganze Gelände durchforstet. Nichts. Die Sanitäter sind wie vom Erdboden verschluckt. Und der Radfahrer auch.«
Ein Hubschrauber näherte sich knatternd und machte eine weitere Unterhaltung unmöglich.
»Vielleicht sieht der da oben ja was«, rief Esposito.
»Was ist denn passiert?« Eine Gruppe Schaulustiger tauchte auf.
»Der Park ist noch mindestens bis morgen gesperrt.«
»Ja, aber was ist denn passiert?«
Herbracht mischte sich ein. »Hier laufen Ermittlungen.«
Ein junger Mann verzog das Gesicht. »Man wird ja wohl noch fragen dürfen.«
Kapitel 2
Polizeipräsidium, 12:30 Uhr
Kaum waren Herbracht und Dragovic ins Büro des Polizeipräsidiums an der Adickesallee zurückgekehrt, übertrug Herbracht die Daten von den Vermissten und dem Notarzt, die er bereits am Tatort als Sprachnotiz im Handy gesichert hatte, in die polizeiliche Datenbank und schrieb den Bericht.
Herbracht las laut: »Thomas Wacker, das Mordopfer: Assistenzarzt der Inneren Medizin, Notarzt in Weiterbildung, 33 Jahre alt, 1,81 Meter groß. Lebte in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft mit einem gewissen Martin Herbst. Sie wohnten gemeinsam in der Schwanthalerstraße. Anja Mischnik, vermisst: Beruf Sanitäterin, 25 Jahre alt, 1,60 Meter groß, kurzes Haar, grüne Augen, Haarfarbe pink, sternförmiges Nasenpiercing am rechten Nasenflügel, Figur vollschlank. Jannick Schmidt, vermisst: Beruf Sanitäter, 26 Jahre alt, 1,79 Meter groß, Augenfarbe hellbraun, Haare braun, schlanke Figur, auffällig starker Aknebefall.«
Dragovic schrieb mit, dann fragte sie: »Kannten die den Notarzt?«
»Ja, ich habe mich in der Zentrale erkundigt. Sie kannten ihn. Thomas Wacker hatte schon einige Einsätze sowohl mit der Mischnik als auch mit Schmidt.«
»Vielleicht wollte der Mörder alle drei aus dem Weg räumen?«
Das Telefon klingelte. »Herbracht? Ah, Giulio, was gibt es Neues? … Mist, war ja klar … Ja, ich bin neugierig, was die sagen, danke für den schnellen Rückruf. Bis dann.« Herbracht beendete das Gespräch.
»Und?«, fragte Dragovic, die am Whiteboard stand.
»Dieser Müller, wenn er denn wirklich so heißt, hat sich ein Handy auf dem Schwarzmarkt besorgt. Die Ortung war erfolglos. Das Ding ist längst ausgeschaltet. Die Tonqualität war verheerend, weshalb die Aufzeichnung an die forensische Sprechererkennung im BKA gegangen ist. Ich bin gespannt, was die Auswertung ergibt. So …« Herbracht schloss das Fenster seines Laptops. »Du weißt, was zu tun ist, Mia?«
Sie nickte. »Der Teil der Arbeit, den ich hasse wie nichts anderes und weswegen ich vermutlich bald graue Haare bekommen werde.«
Herbracht rümpfte die Nase. »Vielleicht solltest du den Beruf wechseln. In Grau sähe deine asymmetrische Frisur vermutlich merkwürdig aus.
»Nichts gegen meinen Haarschnitt, ja? Ich bin jung und nicht so spießig wie du.«
»Ich danke dafür.« Herbracht fuhr sich versonnen durchs lichte Haar. »Los geht’s.« Er stand auf. »Wir statten Martin Herbst einen Besuch ab.«
»Du glaubst, er ist zu Hause?«
»Er hat eine Praxis für Physiotherapie im selben Haus. Außerdem ist heute Mittwoch. Haben die da nachmittags nicht geschlossen?«
»Physiotherapeuten? Keine Ahnung.«
»Komm, damit du lernst, wie man mit solchen Situationen am besten umgeht, ohne grau zu werden.«
Zögerlich erhob sich Dragovic. »Dann zeig, was du kannst, bringen wir’s hinter uns. Aber ich habe einen Bärenhunger. Ist jetzt schon ein verdammt langer Tag. Vielleicht können wir uns in der Pizzeria auf der Schweizer Straße schnell ein Stück Pizza holen, damit ich nicht zusammenklappe?«
*
Nach einer viertelstündigen Mittagspause, in der sie sich eine Pizza geteilt und diese förmlich hinuntergeschlungen hatten, machten sie sich auf den Weg zu Herbst. Sie trafen ihn in seiner Wohnung an. Der Mann weinte wie ein kleines Kind. Dragovic setzte sich neben ihn und legte ihm tröstend die Hand auf den Arm.
»Bitte, können Sie mir ein Glas Wasser holen?«, bat er. »Die Küche ist gleich da vorne«, er deutete mit dem Zeigefinger in die Richtung. »Und ein Adumbran zur Beruhigung. Die Packung liegt auf der Arbeitsplatte.«
Dragovic stand auf, ging raus und kehrte mit einem Glas Wasser und den Tabletten zurück. »Ich habe Leitungswasser genommen, ist das okay? Hier ist die Packung«, sie reichte ihm beides.
Mit zittrigen Fingern drückte Herbst eine Tablette aus dem Blister, schob sie in den Mund, trank einen großen Schluck Wasser, schloss die Augen und lehnte sich in seinem Sessel zurück. »Ich kann es einfach nicht glauben, Thomas kann doch nicht …« Wieder begann er zu schluchzen.
»Wir haben in unserem Team Psychologen, die Ihnen helfen können«, sagte Dragovic sanft.
»Nein, keinen Psychologen. Bitte nicht. Ich habe eine gute Freundin, die mir beistehen wird.«
»Herr Herbst, gibt es noch andere Angehörige von Herrn Wacker? Eltern, Geschwister …?«, fragte Herbracht.
Herbst putzte sich die Nase und legte das Taschentuch achtlos auf den Tisch. »Nur seine Eltern, Gunther und Christel. Sie leben in Rüsselsheim. Wir haben keinen Kontakt zu ihnen. Also nur die Pflichtanrufe zum Geburtstag und zu Weihnachten.«
»Verraten Sie mir den Grund?«
Herbst zog geräuschvoll die Nase hoch. »Der Grund bin ich. Besser gesagt unsere homosexuelle Beziehung. Thomas’ Eltern sind streng katholisch und dulden unsere Partnerschaft nicht.«
»Herr Herbst, wollen Sie die Eltern benachrichtigen oder sollen wir das tun?«
Herbst stand auf, ging an seinen Schreibtisch, riss ein Blatt von einem Abreißkalender, suchte im Handy nach der Adresse und schrieb sie auf. Schließlich reichte er es Herbracht. »Die leben in Rüsselsheim. Telefonnummer und Adresse stehen drauf. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mit Ihnen reden würden. Beschimpfungen würde ich augenblicklich nicht ertragen.«
Herbracht nahm den Zettel entgegen und schob ihn in seine Brusttasche. »Wir sprechen mit ihnen.«
Wieder begann Herbst zu schluchzen. »Bitte sagen Sie mir, wie es passiert ist!«
»Sind Sie sicher, dass Sie das hören wollen? Es war eine äußerst brutale Tat«, antwortete Herbracht. »Wir könnten ein anderes Mal darüber sprechen, wenn es Ihnen etwas besser geht.«
»Nein, ich bitte Sie, ich muss es wissen, jetzt wissen! Ich halte das nicht aus, wenn Sie mich im Unklaren lassen, bitte!« Flüsternd fügte er hinzu: »Habe ich nicht ein Recht darauf?«
»Natürlich. Ihr Partner wurde heute Nacht zu einem Fahrradunfall im Diplomatenviertel gerufen. Man fand ihn in einem kleinen Park, etwa hundert Meter entfernt vom Einsatzort. Er wurde mit einem Messer attackiert, erlitt Stichverletzungen.«
»Stichverletzungen? Eine Messerattacke?«
»Ja.«
»Wie furchtbar! Wer tut so etwas?«
Herbracht schwieg.
»Sprechen Sie von dem Park im Grüngürtel hinter der Frauenlobstraße?«
»Ganz recht.«
»Ach je, da waren wir häufig. Der kleine Park. Wenige Bänke und eine große Wiese. Wir haben dort einige Male Federball gespielt. Und dort wurde er erstochen?« Wieder schluchzte Herbst. »Welcher kranke Mensch ist zu so etwas fähig? Ich kann es nicht glauben. Hat er lange leiden müssen?«
»Laut Ärztin war einer der ersten Messerstiche bereits tödlich. Wie wir erfuhren, ist er an dem Blut, das in seine Lungen lief, ertrunken.«
»Einer der ersten?«
»Es waren mehrere, alle in den Rücken.« Dragovic legte sanft die Hand auf Herbsts Arm. »Wir glauben nicht, dass er lang gelitten hat. Sicher nicht!«
Herbst seufzte schwer. »Was ist mit den Sanitätern, die am Unfallort gewesen sein müssen? Haben sie etwas beobachtet?«
»Wir wissen es nicht. Von ihnen fehlt jede Spur.« Herbracht beschrieb eine hilflose Geste mit den Armen.
Herbsts Augen weiteten sich, was dramatisch wirkte, da in diesem Moment ein Sonnenstrahl ins Zimmer fiel, der diese unnatürlich aufblitzen ließ.
Dragovic lief ein Schauer über den Rücken.
»Sie können nicht einfach verschwunden sein.«
»Wir wissen nicht, wo sie sich derzeit aufhalten.«
»Ich fasse es nicht. Hängen die da etwa mit drin?«
»Wir wissen im Moment nicht viel darüber, werden es aber herausfinden, Herr Herbst, verlassen Sie sich darauf. Könnten Sie sich vorstellen, dass Ihr Partner Feinde hatte?«, fragte Herbracht.
Herbst starrte verzweifelt ins Leere. »Nein, nein, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Er war so ein liebenswerter Mensch.«
»Ist Ihnen in letzter Zeit Ungewöhnliches bei ihm aufgefallen?«
Herbst blickte auf. »Ungewöhnliches, wie meinen Sie das?«
Herbracht suchte nach den passenden Worten. »Sorgen, Ängste, Nervosität?«
»Nein.«
»Sagen Ihnen die Namen Anja Mischnik und Jannick Schmidt etwas?«, fragte Herbracht.
Herbst überlegte. »Nichts, nie gehört. Wer soll das sein, die Sanitäter?«
»Ja. Sie haben des Öfteren mit Herrn Wacker zusammengearbeitet.«
»Nie gehört. Wirklich nicht. Tut mir leid.«
»Wo ist mein …? Ich meine, kann ich ihn noch einmal sehen? Ich muss mich wenigstens von ihm verabschieden.«
»Er befindet sich momentan im rechtsmedizinischen Institut. Das ist so üblich, wenn eine Person auf unnatürliche Weise aus dem Leben geschieden ist. Die Rechtsmediziner können viel zur Aufklärung eines Verbrechens beitragen, was sie später dem Staatsanwalt und Richter vortragen. Wir können Ihnen nicht verbieten, zu ihm zu gehen, ich persönlich würde Ihnen jedoch davon abraten. Behalten Sie ihn lieber so in Erinnerung, wie er war. Es ist kein schöner Anblick für einen Angehörigen, einen geliebten Menschen als Opfer eines Verbrechens zu betrachten«, sagte Herbracht.
Herbst fingerte an dem Tablettenblister herum und nahm sich eine zweite Tablette.
»Vielleicht sollten Sie lieber keine weitere nehmen«, intervenierte Dragovic.
»Ich brauch das jetzt.« Er schob die Tablette in den Mund. »Sonst ertrage ich das alles nicht.«
Herbracht überlegte einen Moment, bevor er die nächste Frage stellte. »Sie sagen, er war ein liebenswerter Mensch. Hatten Sie manchmal Grund zur Eifersucht?«
Herbst wirkte irritiert. »Ich? Was für eine merkwürdige Frage. Wir waren uns treu. Oder glauben Sie etwa …? Oh mein Gott, Sie glauben doch nicht, ich hätte etwas damit zu tun?«
»Wir glauben überhaupt nichts, wir müssen aber allerhand Fragen stellen, um uns ein Bild zu machen«, beeilte sich Dragovic betont sanft zu sagen. Sie hatte längst die muskulösen Arme des schlanken Mannes gemustert, die man als Physiotherapeut zwangsläufig brauchte, wie sie mutmaßte. Ein Job, für den man Kraft benötigte. Ihm würde es nicht schwerfallen, mit einem Messer mehrfach brutal zuzustechen, dachte sie.
Herbst seufzte. »Sie wollen sicher auch wissen, ob ich für die letzte Nacht ein Alibi habe, oder?« Ohne auf eine Antwort zu warten, fuhr er mit einem bitteren Unterton fort: »Nun, ich neige dazu, nachts zu schlafen, da ich einen anstrengenden Job habe. Aber Thomas schrieb mir kurz vor seinem letzten Einsatz eine WhatsApp, dass er bald nach Hause kommen würde. Ich solle mir keine Sorgen machen.« Er sah sich suchend um, bis er das Handy, das er gerade noch benutzt hatte, auf einem kleinen Couchtisch fand. Er griff danach und öffnete die Nachrichten, scrollte und hielt es den beiden Kommissaren hin. »Hier, lesen Sie selbst. Sie dürfen mein Handy gerne mitnehmen und untersuchen. Ich habe die Ortungsdienste stets aktiviert. Da werden Sie sehen, dass ich zu Hause war.«
»Danke für Ihr Entgegenkommen«, entgegnete Herbracht, nahm das Handy entgegen und las die Nachricht, die Herbst geöffnet hatte. Dann gab er Herbst das Telefon zurück. »Vorläufig reicht uns das.«
Herbsts Gesichtsmuskeln zuckten. Auf seiner Stirn hatte sich ein feuchter Film gebildet. »Vorläufig? Das klingt vielversprechend. Muss ich nun nicht nur mit dem Verlust meines geliebten …«, ihm brach die Stimme, »… Partners leben, sondern auch damit, dass ich bis auf Weiteres unschuldig bin? Das klingt verdammt hart!«
Wieder war es Dragovic, die beruhigend auf Herbst einwirkte. »Regen Sie sich bitte nicht auf. Wir tun unser Bestes, um diesen Fall aufzuklären. Damit auch Sie irgendwann zur Ruhe kommen können. Wir können nachvollziehen, wie Sie sich fühlen, und haben Verständnis für Ihre Situation. Es ist unfassbar bitter für Sie.«
Herbst fuhr sich mit zitternden Händen durch die Haare. »Er war mein Leben. Ich … ich wollte mit ihm alt werden. Ich hätte alles für ihn getan. Und nun ist er tot. Fahnden Sie nach den Sanitätern! Bitte! Die stecken dahinter. Warum sonst sind sie verschwunden? Finden Sie die Täter, sonst werde ich wahnsinnig.«
»Wir werden alles daransetzen, die Wahrheit herauszufinden, Herr Herbst.«
Herbst rieb sich die Schläfen. »Wann …? Ich meine, ich muss mich um die Formalitäten kümmern. Wann wird er denn da wieder rauskommen, aus dem Institut?«
»Wann er beerdigt werden kann?«, fragte Herbracht.
»Wie gesagt, es wird eine gerichtliche Leichenöffnung durchgeführt. Das heißt, der Leichnam ist beschlagnahmt und kann nur vom Staatsanwalt zur Bestattung freigegeben werden.«
»Das hört sich so unmenschlich an. Es ist Thomas, nicht irgendein Leichnam. Wir … wir haben darüber gesprochen. Ich will sagen, wir haben darüber gesprochen, was zu tun ist, wenn einer von uns stirbt. Das heißt, Thomas hat das Thema angeschnitten. Ist gar nicht so lange her, höchstens ein paar Wochen. Makaber, was? Jedenfalls sagte er, es sei sein Wunsch, verbrannt zu werden. Ich habe verständnislos reagiert. Er war doch so jung. Ich habe ihm gesagt, das sei nicht das richtige Alter für solche Gespräche. Mein Gott, wie falsch ich doch lag. Er sagte, als Arzt wisse man, wie schnell das Leben enden kann. Als hätte er es geahnt. Ist das nicht entsetzlich? Ich kenne nicht einmal einen Bestatter.«
»Wenn Sie möchten, können wir Ihnen behilflich sein. Das rechtsmedizinische Institut arbeitet häufig mit dem Bestattungsunternehmen Schulz zusammen. Verena Schulz heißt die Inhaberin. Ich kann sie empfehlen. Sie hat einen guten Ruf und gilt als einfühlsam. Ihr Institut ist in der Nähe des Hauptfriedhofs«, sagte Herbracht.
»Dann werde ich mich wohl an sie wenden, danke«, sagte Herbst.
»Herr Herbst, eine letzte Frage. Ihre Freundin – ich meine die, von der sie vorhin sprachen –, war sie auch mit Ihrem Partner befreundet?«, wollte Herbracht wissen.
»Nein, sie ist eine Kollegin von mir, Lara Eschbach. Wir teilen uns die Praxis. Sie ist eine gute und langjährige Freundin.«
»Erreichen wir sie heute in der Praxis?«
Herbst schüttelte den Kopf. »Sie hat frei. Zum Glück. Ich muss mich erst sammeln, bevor ich ihr das erzähle.«
»Kannte sie Ihren Partner?«
»Ja natürlich.«
»Wir werden uns an sie wenden, um ihr aus Routinegründen ein paar Fragen zu stellen.«
»Gott, ist mir das unangenehm. Was soll Lara denken? Ich will sie nicht in die Sache reinziehen.«
»Wie gesagt, reine Routine, nichts weiter, machen Sie sich keine Sorgen. Die Eltern von Herrn Wacker«, Herbracht holte den Zettel aus seiner Brusttasche hervor, »sie leben allein?«
»Sie sind in eine Seniorenwohnanlage nahe dem Hochwasserdamm gezogen. Mit Blick auf den Main. Sehr feudal.«
»Vielen Dank für die Antworten, wir lassen Sie jetzt in Ruhe.«
»Es ist alles so unwirklich, ich muss erst einmal allein sein.«
»Wenn Sie wiederum Fragen haben oder Ihnen etwas einfällt, und sei es in Ihren Augen auch völlig unbedeutend, können Sie uns jederzeit kontaktieren. Hier ist eine Karte mit unserer Telefonnummer. Viel Kraft für Sie.« Herbracht legte eine Visitenkarte auf den Tisch und stand auf. »Ach, eins noch: Wurde Ihr Partner immer im selben Bereich eingesetzt?«
»Immer im Umfeld des Krankenhauses«, erklärte Herbst, »also zwischen Bockenheim und Ginnheim.«
»Wir danken Ihnen. Versuchen Sie, zur Ruhe zu kommen.« Herbracht klopfte dem tieftraurigen Mann auf die Schulter.
»Auf Wiedersehen, Herr Herbst. Unser aufrichtiges Mitgefühl«, sagte Dragovic. »Passen Sie bitte gut auf sich auf.«
»Finden Sie das Monster!«, antwortete Herbst tonlos.
*
»Der Wacker hat über seine Beerdigung gesprochen. Hältst du das für Zufall?«, fragte Dragovic, die es sich auf dem Beifahrersitz mit einer Dose Cola in der Hand gemütlich gemacht hatte.
»Darüber habe ich nachgedacht«, sinnierte Herbracht. »Könnte bedeuten, dass er wusste, dass er sich in Gefahr befand. Andererseits arbeitete er als Notarzt. Er hat bestimmt viele Unfälle mit dramatischem Ausgang gesehen. Da denkt man schon mal ans eigene Ende.«
»Ja, und hätte er geglaubt, dass er in irgendeiner Weise bedroht wird, hätte er sich als kluger Mann doch sicher an die Polizei gewandt, oder?«, überlegte Dragovic.
»Wir fahren jetzt direkt nach Rüsselsheim.« Herbracht aktivierte das Navi und fuhr los. »Was wolltest du gerade wissen?«
»Ich frage mich, warum er nicht die Polizei alarmiert hat, wenn er meinte, sich in einer bedrohlichen Situation befunden zu haben.«
»Weißt du, Mia, ich halte dich für eine kompetente und kluge Kollegin. Die Frage jedoch klingt – wie soll ich sagen? – recht hypothetisch. Wir wissen beide, dass es viele Gründe gibt, weshalb Menschen davon absehen, die Polizei zu kontaktieren, zum Beispiel, wenn sie erpressbar sind. Übrigens gratuliere ich dir. Du bist mit Herbst empathisch umgegangen. Ich gebe zu, von deinem Einfühlungsvermögen kann ich mir eine Scheibe abschneiden. Macht Spaß, eine weibliche Partnerin zu haben. Dein Vorgänger war da eher so ungehobelt wie ich.«
»Danke für die Blumen und ja, das nächste Mal überlege ich mir meine Fragestellung genauer. Glaubst du, dass es schwierig ist, herauszufinden, wann ein Notarzt Dienst hat?«
»Wie meinst du das?«
Sie passierten die Sachsenhäuser Warte und bogen links ab in Richtung Autobahn.
»Ich meine als Außenstehender.«
»Nein, nicht, wenn man sich geschickt anstellt.«
»Wie würdest du das machen?«
»Wenn ich es speziell auf jemanden abgesehen hätte, würde ich ihn wahrscheinlich längere Zeit beobachten. Auch über das Krankenhaus könnte man eventuell etwas in Erfahrung bringen. Da müsste jemand anrufen und nach Wacker fragen, sich vielleicht als Apotheker ausgeben, sagen, dass Wacker ein Medikament bestellt und nicht abgeholt habe beispielsweise. Dann würde man dem vermeintlichen Apotheker sagen, dass er gerade im Dienst und unterwegs im Einsatz sei. Also eine Möglichkeit von vielen natürlich. Ich denke, wenn man es darauf anlegt, findet man in einem so großen Betrieb gewiss jemanden, der arglos Auskunft über den Dienstplan gibt. Hat nichts mit Arztgeheimnis zu tun.«
»Wieso hast du dir Herbsts Handy nicht näher angesehen?«, fragte Dragovic.
»Was soll es beweisen? Wacker hat ihm geschrieben, na und? Was nützen die Ortungsdienste, wenn er rein theoretisch ohne das Ding weggegangen sein könnte? Wobei ich ihm seinen Kummer abgenommen habe. Sollte der nicht echt gewesen sein, ist er ein verdammt guter Schauspieler.«
»Oder er bricht unter der Schwere seiner Schuld gerade zusammen.«
*
Eine Hausdame brachte die Polizisten zum Apartment von Christel und Gunther Wacker, nachdem diese sich ausgewiesen und ihr Anliegen vorgebracht hatten.
»Ich brauche Sie sicher nicht darüber aufzuklären, dass es sich bei den Heimbewohnern um alte Menschen handelt, die nicht mehr so belastbar sind wie Sie und ich. Wenngleich die beiden fit sind und sich weitestgehend selbst versorgen. Sie hätten wohl noch eine Weile in ihrem eigenen Haus wohnen können. Wenn ich ehrlich sein soll, wusste ich nicht einmal, dass Wackers einen Sohn haben. Da ist es.« Behutsam klopfte die Dame an. Nach kurzer Zeit wurde geöffnet, und ein untersetzter, glatzköpfiger Mann um die 80 mit eng stehenden, kleinen Augen stand vor ihnen. »Was gibt’s?«, fragte er barsch.
Herbracht antwortete: »Herr Wacker, dürfen wir hineinkommen? Es handelt sich um Ihren Sohn. Wir sind von der Kriminalpolizei.«
Wacker überlegte wohl, ob er das glauben sollte, denn sein Blick ließ Argwohn erkennen. Hinter Wacker tauchte eine ausgemergelt wirkende Frau auf, die ihren Mann um einige Zentimeter überragte. »Habe ich richtig verstanden? Was ist mit Thomas?«, fragte sie aufgebracht.
»Falls Sie mich brauchen, rufen Sie unten an.« Eiligen Schrittes trat die Hausdame den Rückweg über den Hausflur an.
Der Alte ließ sie hinein. Das Apartment wirkte ungemütlich, aber peinlich aufgeräumt. Ein Wohnzimmer mit in die Jahre gekommenen Sesseln, über deren Sitzflächen Schonbezüge gespannt waren. An der Wand ein Sofa, davor ein Couchtisch mit gehäkeltem Platzdeckchen. Neben dem Sofa befand sich eine verschlossene Tür. Vermutlich der Eingang zum Schlafzimmer. An der gegenüberliegenden Wand stand ein großes Fernsehgerät, daneben hing ein goldenes Kruzifix.
Mit dem Kopf wies Wacker auf die Couch. »Falls Sie nicht stehen wollen«, sagte er.
Dragovic beobachtete Frau Wacker, die unter der Herrschaft des strengen Gatten zu leiden schien, wenn sie die ängstlichen Blicke, die sie ihrem Mann zuwarf, richtig deutete.
»Sie sollten sich besser ebenfalls setzen«, schlug Herbracht vor.
Die Frau wirkte zunehmend nervöser, ihre Beine machten den Eindruck, als würden sie unter ihr gleich nachgeben, gerade als sie den Sessel erreichte. Wacker senior stemmte die Hände in die Hüften. »Wir haben keinen Kontakt zu unserem Sohn.«
Herbracht antwortete: »Das ist uns bekannt. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Sohn einem Mord zum Opfer gefallen ist.«
Christel Wacker seufzte schwer und wurde blass.
»Das kann ich nicht glauben, was ist passiert?«, fragte ihr Mann.
»Er wurde bei einem Arbeitseinsatz überfallen.«
Frau Wacker begann am ganzen Körper zu zittern.
Dragovic sprang auf.
Wacker senior hob abwehrend die Hände. »Lassen Sie sie. Sie schafft das schon.«
Zögerlich setzte sich Dragovic wieder.
»Wer hat das getan?«, fragte Wacker.
»Das werden wir herausfinden.«
»Martin Herbst war sein Untergang. Sie haben Kenntnis davon, dass er in einer schwulen Beziehung lebte?«
»Wir kennen Herrn Herbst und glauben, dass die beiden glücklich miteinander waren.«
Christel Wacker rannen Tränen über die Wangen, doch sie blieb stumm.
»Er war ein ganz normaler Mann. Jedenfalls hatten wir nie den Eindruck, dass er schwul ist. Bis Herbst auftauchte. Das musste ja schiefgehen.« Der Ausdruck auf Wackers Gesicht verdüsterte sich mehr und mehr. »Wir haben ihm gesagt, wenn er sich nicht von dem Mann trennt, wollen wir nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ich habe es nicht verdient, der Vater eines Weicheis zu sein. Er hat sich nicht getrennt. Also haben wir die Konsequenzen gezogen. Ich würde mich nicht wundern, wenn der Herbst selbst mit seiner Eifersucht dahintersteckt. Das ist ein richtiger Waschlappen. Der klebte an Thomas wie eine Klette. Wir waren enttäuscht von Thomas. Wir sind gläubige Christen, gehen regelmäßig in die Kirche und unsere ganze Hoffnung ruhte darauf, einmal Enkelkinder zu haben.«
Herbracht war selten sprachlos. Doch diese Haltung erschütterte ihn zutiefst. Dieses Paar hatte gerade erfahren, dass der Sohn nicht nur verstorben, sondern sogar einem Mord zum Opfer gefallen war, und dennoch war die Antwort darauf ein einziger egoistischer Vorwurf an das verstorbene Kind? Herbracht hatte in seiner Laufbahn schon viel erlebt, doch mit einer solchen Kaltschnäuzigkeit war er selten konfrontiert worden. Er suchte nach den passenden Worten, doch als sich seine und Dragovics Blicke trafen, erkannte er ein unerschütterliches Nein in ihren Augen. Stumm blickte sie zu Frau Wacker hinüber. Herbracht verstand. Die Frau hatte es nicht leicht mit diesem Despoten. Sie litt. Er durfte ihre Lage keinesfalls mit barschen Worten verschlimmern, also sagte er: »Wir wollen Sie mit weiteren Details nicht belasten. Sollten Sie etwas wissen wollen, sind wir jederzeit für Sie zu sprechen.«
Es war das erste Mal, dass Wacker auf seine in sich zusammengesunkene Frau achtete. »Ich glaube, im Moment reicht es. Ich gebe Ihnen einen guten Rat, nehmen Sie den Herbst genauer unter die Lupe.«
Herbracht legte seine Visitenkarte auf das Platzdeckchen. »Unter dieser Nummer können Sie uns jederzeit erreichen. Es tut uns sehr leid, dass wir Ihnen so schlechte Nachrichten übermitteln mussten.« Herbracht stand auf und ging zur Tür.
Dragovic trat zu Christel Wacker. »Bitte wenden Sie sich jederzeit an mich, wenn Sie Hilfe brauchen. Versprechen Sie mir das.«
Dragovic traf die tiefe Trauer, die sich im Blick der Mutter widerspiegelte, wie ein Faustschlag.
*
»Meine Fresse, auf welchem Planeten ist der Mann unterwegs? Ich dachte, solche antiquierten Ansichten gebe es heute nicht mehr. Der lebt wohl im Mittelalter. Was für ein dämliches Arschloch. Ich hätte ihm gern ein paar Worte gesagt, die er so schnell nicht wieder vergessen hätte. Du musstest mich ja ausbremsen.« Herbracht war so wütend, dass Dragovic befürchtete, selbst mit ihm in Konflikt zu geraten.
»Ich bitte dich, Kai, wie sagte die Empfangsdame zu Recht? Das sind alte Menschen. Hättest du riskieren wollen, dass die Mutter einen Herzinfarkt erleidet?«
Sie waren mit dem Aufzug ins Erdgeschoss gefahren und just in diesem Moment kam ihnen die Hausdame entgegen. »Wie haben es die Wackers aufgenommen?«
»Auf unterschiedliche Weise. Ich kann Ihnen versichern, dass wir behutsam vorgegangen sind, dank meiner Kollegin. Ich beglückwünsche Sie jedenfalls nicht zu solchen starrköpfigen Bewohnern. Auf Wiedersehen.« Er ließ die Dame stehen.
Dragovic verharrte einen Moment, ließ Herbracht vorausgehen. »Sie haben doch bestimmt einen Arzt im Haus?«
»Natürlich.«
»Der sollte vielleicht nach Frau Wacker schauen. Sie hat unseren Besuch verständlicherweise nicht gut verkraftet.«
»Ich habe ihn bereits verständigt«, sagte die Hausdame.
»Was für ein Tag«, sagte Dragovic, als sie neben Herbracht im Auto saß. »Ich hätte gern Feierabend.«
»Nee, Mia, keine Chance. Jetzt geht’s zu den Mischniks.«
*
Eschersheimer Landstraße, Ecke Fürstenberger Straße, 16 Uhr
»Fast hätte ich wegen der Apotheke im Erdgeschoss den Eingang nicht gefunden«, sagte Dragovic und schaute auf die Namen an der Klingelleiste. »Ah.«
»Natürlich in der obersten Wohnung und natürlich ohne Aufzug«, stöhnte Herbracht, als er sich die Stufen hinaufquälte.
»Ist halt ein altes Haus«, antwortete Dragovic, die nicht die geringsten Probleme mit dem Treppensteigen zu haben schien.
Die Mischniks bewohnten eine kleine, einfach möblierte Dachgeschosswohnung eines feudalen Altbaus, direkt an der viel befahrenen Eschersheimer Landstraße.
Erwin Mischnik, der Vater der Verschwundenen, war Frührentner, wie Herbracht am Telefon erfahren hatte, als er ihren Besuch angekündigt hatte. Mischnik hatte schütteres Haar, trug eine billige Hose, über der ein ausladender Bauch hing, und wirkte ungepflegt. Er führte sie in ein ungelüftet riechendes Wohnzimmer, in dem den Polizisten seine ebenfalls untersetzte Frau entgegentrat.
»Nehmen Sie Platz«, sagte Helga Mischnik. »Anja und ihr Kollege hatten einen Einsatz und sind seitdem spurlos verschwunden, das wissen wir. Wir können uns das nicht erklären, hatten aber deswegen Ärger mit der Notrufzentrale.« Sie tippte sich mit dem Zeigefinger gegen die Stirn. »Glauben die etwa, das lässt uns kalt? Stattdessen scheinen die zu denken, dass die beiden blaugemacht haben.«
Herbracht übernahm das Wort: »Deswegen wollten wir mit Ihnen sprechen. Ist Ihre Tochter ein zuverlässiger Mensch?«
»Bei der Arbeit schon. Uns lässt sie öfter hängen«, antwortete der Vater und verzog missmutig sein Gesicht.
»Wie meinen Sie das?«
»Ich meine, dass sie uns nicht alles sagt, was sie so treibt.«
»Lass gut sein, Erwin, Anja ist schließlich erwachsen.«
»Ach, deswegen wohnt sie wieder bei uns, was?«
»Sie wohnt bei Ihnen?«, wollte Herbracht wissen.
»Tja, zu Hause zu wohnen ist bequem, wenn man gut bedient wird.«
Helga Mischnik zuckte die Achseln. »Sie ist doch unser einziges Kind.«
»Und ich bin ein armer Rentner.«
»Sie wäre nicht zurückgekommen, wenn sie keinen Liebeskummer gehabt hätte. Sie hat sich da wohl in was verrannt. Der junge Mann war anscheinend nicht interessiert.«
»Jedenfalls musste sie dann wieder auf Mamis Schoß«, brummte Mischnik.
»Dafür sind wir doch da, Erwin, ich bitte dich.«
»Meine Eltern hätten mir was erzählt, wenn ich in dem Alter bei ihnen gewohnt hätte.«
»Sie hatte Liebeskummer?«, fragte Herbracht.
»Ja, aber nichts Ernstes, der junge Mann hat sich in eine andere verliebt. Sie wird schon den Richtigen finden.«
»Haben die zwei Kontakt?«
»Nicht dass ich wüsste. Er lebt gar nicht mehr in Frankfurt. Ist mit seiner neuen Freundin nach München gezogen.«
»Haben Sie ein aktuelles Foto von Ihrer Tochter?«, fragte Herbracht.
Helga Mischnik stand auf und ging zu einem Regal. Dort nahm sie ein eingerahmtes Foto und gab es Herbracht. »Ein neueres gibt es nicht.«
»Auch kein Selfie vom Handy?«
»Wir haben doch ihr Handy nicht bei uns«, sagte Frau Mischnik.
Eine pausbäckige, stark geschminkte junge Frau mit pinkfarbener Kurzhaarfrisur und einem Piercing am rechten Nasenflügel blickte ihnen entgegen.
Dragovic studierte das Foto. »Die Haare sind sehr kurz. Wann wurde das Bild aufgenommen?«
»Vor ein paar Monaten.«
»Dürfen wir es uns als Fahndungsfoto ausleihen? Oder haben Sie ein aktuelleres?«
»Sie lässt sich nicht gern fotografieren, leider. Wenn wir es zurückbekommen, können Sie es haben.«
»Sie können’s von mir aus auch behalten. Es ähnelt unserer Tochter kaum – zumindest nicht dem hübschen Mädchen von damals.«
»Ich bitte dich, Erwin«, wies Frau Mischnik ihren Mann zurecht.
Mischnik redete sich in Rage. »Was heißt ›Ich bitte dich‹, Helga! Sie schmiert sich jeden Tag so viel Zeug ins Gesicht, wie andere Frauen wahrscheinlich nicht in einem Monat verbrauchen. Ich habe sie gefragt, ob sie neuerdings auf den Strich geht. Meine Frau nimmt sie immer in Schutz.«
Frau Mischnik errötete. »Entschuldigen Sie, mein Mann meint das nicht so. Er redet nur manchmal etwas derb.«
»Dein Mann meint es genau so, wie er es sagt. Dazu kommt dieses dämliche Piercing.« Er tippte mit dem Finger auf seinen rechten Nasenflügel.
»Mit 25 hat man komische Einfälle«, beeilte sich Frau Mischnik zu erklären. »Ich möchte nicht wiedergeben, was du mir von dir erzählt hast, als du in ihrem Alter warst.«
»Ich bin ja auch ein Mann!«
Mischnik brummte etwas Unverständliches.
»Gibt es ein Foto, das zeigt, wie Ihre Tochter früher aussah?«, fragte Herbracht.
Frau Mischnik zog ein Fotoalbum aus dem Wandregal und öffnete es. »Hier ist sie etwa zehn Jahre alt.« Sie gab Herbracht das Album. Zu sehen war ein molliges kleines Mädchen mit schulterlangem schwarzem Haar.
»Ich dachte eher an ein Foto jüngeren Datums«, sagte Herbracht.
Helga Mischnik blätterte in dem Fotoalbum. »Schauen Sie selbst, alles leer.« Es war ersichtlich, dass hinter den Klarsichtfolien einmal Fotos gesteckt hatten. »Alles weg, Anja hat die Bilder entfernt. Ich habe es selbst erst kürzlich entdeckt.«
»Sehr schade.«
Dragovic nahm Herbracht das aktuelle Foto aus der Hand und betrachtete es konzentriert. »Leider ist die Aufnahme recht unscharf.«
»Gibt es etwas Außergewöhnliches am Äußeren Ihrer Tochter?«
»Reichen die Haare und das Piercing etwa nicht?«
»Je besser die Beschreibung, desto eher die Chance, dass sich jemand an sie erinnert.«
»Nein, keine sonstigen besonderen Merkmale. Ich habe solche Angst um sie. Was ist geschehen?«, stöhnte die Frau.
Herbracht überlegte, wie er seine Antwort formulieren sollte. »Der Notarzt, der ebenfalls zum Einsatzort kam, ist ermordet aufgefunden worden.«
»Das ist nicht Ihr Ernst!«, rief Erwin Mischnik.
»Leider doch. Allerdings ein Stück entfernt, nicht direkt am verlassenen Krankenwagen.«
»Ich träume das alles, oder? Das kann doch nicht sein!« Frau Mischnik schlug die Hände vors Gesicht. »Mein Gott, Erwin, was jetzt?«
Mischnik fuhr sich mit der Hand durchs schüttere Haar. »Er ist ermordet worden? Dieser Notarzt ist ermordet worden? Wieso denn das?«
»Das müssen wir noch herausfinden.«