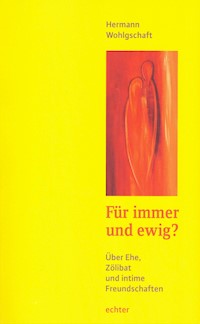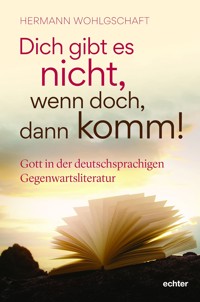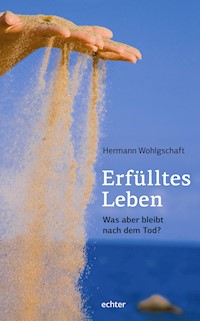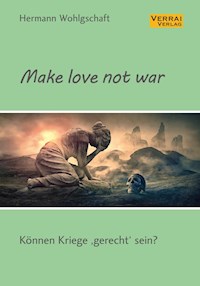
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine meinen viele, die bisher gültige Friedensethik müsse neu überdacht oder sogar grundlegend geändert werden. Bischöfe und Theologen sehen sich vor einem Dilemma: Einerseits sind sie grundsätzlich gegen Gewalt, andererseits fragen sie sich: Darf man den Aggressor gewähren lassen und den Überfallenen den militärischen Beistand verweigern? Im Schatten des Krieges in der Ukraine bedenkt Hermann Wohlgschaft friedensethische Fragen. Den Schwerpunkt seiner Darstellung legt er auf den Missbrauch der Religion zur Rechtfertigung von kriegerischer Gewalt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
DANK
Einführung
1 Heldenkult und Kriegsgeschrei
2Friedensaktivisten
3 Apokalyptische Kunstwerke
4 Der Krieg – von Gott nicht gewollt
Kapitel I
Biblische Grundlagen
1Der kriegerischeGottdesAlten Testaments
2Der leidendeGottesknecht
3 Der Friedensfürst – er reitet auf einem Esel
4 Die Bergpredigt Jesu
5 Der politische Streit
6 Die Opfer von Krieg und Gewalt
KapitelII
Religion undGewalt
1Kriegsführungin der Antike
2 Die›KonstantinischeWende‹undihreFolgen
3 Die Allianz von Thron und Altar
4 Die Kreuzzüge
5 Kontroverse Debatten
6 Die Conquista
7 Der Dreißigjährige Krieg
8 Imperialistische Feldzüge
9 Der Erste Weltkrieg
10 Der ZweiteWeltkrieg
11Der kirchlicheWiderstand
12Kriege–undkein Endein Sicht
13PseudoreligiöseKriegs-Hintergründe
Kapitel III
Die kirchliche Lehrentwicklung
1 DieLehrevom »gerechten Krieg«
2Korrekturen an der christlichen Lehrtradition
3 Das Vaticanum II und der Friedensgedanke
4 Päpstliche Friedens-Enzykliken
5 Die Mahnungen des ›Weltkatechismus‹
6 ›Fratelli tutti‹
7 ›Gerechter Frieden‹
8 Protestantische Stellungnahmen
Kapitel IV
Die Friedensbewegung
1›Sagmir, wodieBlumen sind‹
2›DieFelder von Verdun‹
3 Der religiöse Pazifismus
4 In der Nachfolge Jesu
5 Zur Spiritualität des Friedens
6 Ökumenische Gemeinsamkeiten
KapitelV
Poetisches zu Krieg undGewalt
1›Tränen desVaterlandes‹
2›Kriegslied‹
3 ›Der gute Kamerad‹
4 ›Die Trompete von Gravelotte‹
5 Tolstois ›Rede gegen den Krieg‹
6 ›Et in terra pax‹
7 Ein fiktives Endgericht
8 ›Im Westen nichts Neues‹
9 Gegen Hitlers Krieg
10 Antikriegstönein der Gegenwartsliteratur
11›Geschichten von der Bibel‹
12›DerFallmeister‹
Kapitel VI
Der Ukraine-Krieg
1DasDilemma
2KonträrePositionen
3 Waffen für die Ukraine?
4 Schwierige Fragen
5 Die Rolle des Patriarchen Kyrill
6 Die ›Ohnmachtund Notwendigkeit desReligiösen‹
Anmerkungen
Impressum
Hermann Wohlgschaft
Make love not war!
Können Kriege »gerecht« sein?
VERRAI-VERLAG
STUTTGART
DANK
Mein besonderer Dank gilt der Historikerin und Altphilologin Eva-Maria Kautz, die das Buch von Anfang an kritisch begleitete und mir viele Anregungen gab. Ferner danke ich dem Lektor Stefan Lutterbüse für die aufmerksame Durchsicht der Texte, Marianne Hermann für das Mitlesen der Korrekturen, Anni Eschenbach, Judith Jäger, Werner Kittstein, Sigrid Pflug, Kyrilla Schweitzer, Peter Seidel und Gretl Uhl für wichtige Gesprächsbeiträge, die in das Buch mit eingeflossen sind.
Kaufering,im September2022
Gib uns Frieden jeden Tag!
Lass uns nicht allein.
Du hast uns dein Wort gegeben,
stets bei uns zu sein.
Rüdeger Lüders
Einführung
Kaum hatten sich die Pforten des Paradieses hinter Adam und Eva geschlossen und kaum hatten ihnen die Engel des Herrn – die kriegerischen Cherubim mit der flammenden Schwertklinge – die Rückkehr in den Paradiesesgarten verwehrt, da begannschondasMorden.KainerschlugseinenBruderAbelausMissgunstundNeid.Gott,derHerr,aberwolltenicht, dass Kain nun, im Gegenzug, ebenfalls verfolgt und getötetwerde.
So heißt esin der biblischen Urgeschichte(Gen3,24;4,3-16). Ganz profan, ohne poetischeAusschmückung und ohne mythologisches Bild gesprochen: Die Menschheit,vor allem ihremännliche Hälfte,istvon Naturaus kriegerisch und gewaltbereit.Von einem göttlichenTötungsverbot will sienichts wissen.
Fastimmer wird die Menschheitsgeschichteals Kriegsgeschichte dargestellt. Schon dieältesten bekannten Dichtungen der europäischenZivilisation handelnvom Krieg.Homer erzähltin seinen berühmtenWerken ›Ilias‹ und ›Odyssee‹ vom ›Trojanischen Krieg‹, der sich bereitsim12.Jahrhundert vor Christus ereignet hatte undnoch im 8.vorchristlichen Jahrhundert dasBewusstsein derZeitgenossen Homers prägte.Auch die Mythen undBerichte anderer Kulturkreise– wie Chinas, derÄgypter, derRömer, derWikinger, derAzteken oderPaläoindianer – sindvoll von Schilderungen und Verherrlichungen kriegerischer Grausamkeiten.
Wir feiern gerne dieHelden, die Sieger.Ja, diemeisten Geschichtsbücher sindaus derPerspektive der Sieger, der überlegenen Kriegsherren geschrieben,nicht aus der Sicht derVerlierer, der geschundenen Opfer. Mindestens biszur Mitte des20.Jahrhunderts war Geschichtsschreibung so gut wieidentischmit Militärhistorie1und bewegte sichim einfachen Schemavon ›Gewinnen‹ und ›Verlieren‹. Eine wissenschaftliche Friedens- und Konfliktforschung, dienach denVoraussetzungen für einenanhaltenden Völkerfrieden sucht, hat sich erstin den1960erJahren entwickelt–nach der Gründung eines Forschungsinstitutsin Oslo durch dennorwegischen Soziologen undPolitologen Johan Galtung.2
Obwohlich einen Kriegnie als Beteiligter erlebt habe, brenntmir dasverbrecherische Kriegsgeschehen,auch biographisch bedingt, unter den Nägeln. Meinnach sechzehn Krankheitsjahren frühverstorbener Vater kämpfte bis 1942als Frontoffizierin der Ukraine(die damalszur Sowjetunion gehörte) und wurde dort schwerverwundet –mit lebenslänglichen Folgen.Ich selbst habe,als Wehrpflichtiger und Unteroffizier bei der Feldartillerie derBundeswehr, das Kriegshandwerk ein Stück weit erlernt. Dassich es(abgesehenvon Manövern)nie ausüben musste, verdanke ich einem günstigen Schicksal.Vielen anderen bleibt diese Gunstversagt.
1 Heldenkult und Kriegsgeschrei
Kriege wurden vermutlich seit Beginn der Menschheitsgeschichte organisiert und geführt. Der Krieg sei »aller Dinge Vater, aller Dinge König«, hat der altgriechische Philosoph Heraklit um 500 vor Christus formuliert.3 Der Krieg scheint immer und in nahezu allen Weltgegenden das bevorzugte Mittel der Politik gewesen zu sein – und ist es in vielen Regionen noch heute. Zweifellos gehören Kriege zur Realität dieser Welt. Aber muss man sie einfach so hinnehmen – wie einen Vulkanausbruch oder eineFlutkatastrophe?
Zumindest für die Medien erscheint der Krieg offensichtlich viel attraktiver als der Frieden. Schuldzuweisungen und rein technische Aspekte wie Strategie und Rüstungsmaterial zu thematisieren, erzeugt eben mehr Anschaulichkeit als die Erörterung des komplexen Themas ›Frieden schaffen‹. Ja, in antiken, mittelalterlichen und neuzeitlichen Berichten über die Geschichte von Völkern und Staaten werden Friedenszeiten mit wenigen Worten abgetan, kriegerische Episoden hingegen breit ausgemalt. Auch und gerade in den modernen Medien wird über Friedensgeschichten weit weniger berichtet als über Kriegsgeschichten.
Mit Krieg kommt man in die Schlagzeilen, mit Frieden offenbar nicht. Ist es dieser Effekt, diese öffentliche Aufmerksamkeit, was viele Staatslenker seit jeher getrieben hat, Kriege zu führen – weil sie sich Ruhm versprachen, Denkmäler und Preislieder oder, heutzutage, hohe Einschaltquoten und viele Klicks? Allem Anschein nach hat die Menschheit nichts hinzugelernt. Entsetzliche Gräueltaten hat es – so schrieb die chilenische Dichterin Isabel Allende – »überall auf der Welt und zu allen Zeiten gegeben. Wir lernen nicht, begehen dieselben Sünden wieder und wieder bis ans Ende aller Zeiten.«4
Das »Vaterland«, so behauptet der Nationalismus, sei ein höherer Wert als das einzelne Menschenleben. Ja, »süß und ehrenhaft ist es, für das Vaterland zu sterben«, schrieb der römische Dichter Horaz.5 Der katholische Theologe Thomas Söding indessen beklagte: Jeder Krieg »fordert Opfer, zuerst die schwächsten Glieder einer Gesellschaft: die Frauen und Kinder, die vertrieben, dann die Männer, die zu den Waffen gerufen werden«.6 Nach christlicher Lehre sind Kriege nicht von Gott gewollt. Sie sind Menschenwerk und müssen und können mit menschlicher Kraft beendet werden.7
Heuteaktueller dennje schrieb derTheologe undPsychotherapeut Eugen Drewermannin seinem tiefenpsychologischen Sachbuch ›Der Krieg und das Christentum‹(1982):
Die lange Spur von Greuel und Grauen, die der Krieg in der Geschichte der Menschheit hinterlassen hat, ist so ungeheuerlich, die Not und das Elend, das er verursacht, so entsetzlich, seine Formen bis hin zu dem durchaus möglichen Ruin der Menschheit so zerstörerisch, die Energie, ihn zu führen, derart verschwenderisch, daß es nicht übertrieben scheint, im Krieg die Verkörperung des Bösen an sich zu erblicken. Was immer an Gemeinheit, Grausamkeit, Hinterlist, Lüge und Bosheit Menschen einander zufügen können, im Krieg wird es geplant, organisiert, perfektioniert, verherrlicht, ja belohnt. Alles, was in Friedenszeiten nur Abscheu und Ekel erregen könnte, muß monatelang trainiert werden, ehe Menschen als Soldaten zum Kriegseinsatz fähig werden. Das einfachste Prinzip aller Humanität, die Person eines Menschen stets als Zweck, niemals als Mittel zu betrachten, wird in der blutigen Mathematik des Krieges systematisch mit Füßen getreten. Nirgendwo wird der Mensch so sehr zum Material erniedrigt, in seinen menschlichen Gefühlen verletzt, in seiner Arbeitskraft ausgebeutet, in seiner Existenz geschädigt und in seiner Würde geschändet, wie im Krieg. Wenn es irgend etwas auf dieser Welt zu hassen und zu bekämpfen gibt, so ist es der Krieg.8
Eugen Drewermann ist aus der katholischen Kirche ausgetreten. Theologe und Seelenarzt aber ist er geblieben, seine christlichen Grundüberzeugungen hat er nie aufgegeben, sondern stets aufs Neue bekräftigt. Wie Drewermann und viele andere Theologen oder Philosophen unermüdlich unterstreichen, sind es vor allem Angst, Herrschsucht und Gier (haben wollen, was anderen gehört), die immer mehr perfektionierte Massenvernichtungswaffen erfinden. Als Freunde des Lebens und Botschafter/innen des Friedens sollten sich Christen also (wie auch Anhänger/innen anderer Religionen und alle Menschen guten Willens) der todbringenden Logik der Waffen, dem martialischen Heldenkult und dem Kriegsgeschrei entgegenstellen.
2Friedensaktivisten
Heimliche oder offenkundige Kriegslustzeigt sichinvielerlei Gestalten, sehr oftauch in Denkmälern. Nach wievor bestaunen wir,vielleicht naiv und ohne gleichBöses zu denken, diekriegerischen Monumenteaus vergangenen Zeiten. Die Germania oberhalbvon Rüdesheim am Rhein (aus demJahr 1883)zum Beispiel stemmtnoch immerihr Schwertauf den Boden und schwenkt,majestätisch und drohend, die KaiserkroneinRichtung Frankreich.
Für allzu viele Politiker und Staatsmänner gilt unverändert die alte römische Maxime »Si vis pacem, para bellum« (»Wenn du den Frieden willst, bereite dich für den Krieg«). Der Sozialwissenschaftler und Friedensforscher Dieter Senghaas hingegen formulierte diesen Spruch radikal um: Si vis pacem, para pacem! Wenn du den Frieden willst, bereite dich für den Frieden!9
Wie kann der politische Frieden, derVölkerfrieden, erreicht werden? Der schwedische ChemikerAlfred Nobel(1833–1896), Erfinder des Dynamits und Stifter des Friedens-Nobelpreises, glaubtean Abschreckung, an die Sicherung des Friedens durchmilitärische Stärke.Bis hinzur Gegenwart wird diese Doktrinvon Militärs und ›Realpolitikern‹ weiter verfochten.
Jesus von Nazareth dachte anders, er drohte nicht mit Waffengewalt, er lehrte das Vertrauen auf einen Gott, der die Liebe ist. Doch die Predigt Jesu wird ja nur von wenigen ernst genommen, sie erreicht in ihrer Radikalität nur eine kleine Minderheit. Ja, man kann fragen: Sind Güte und Liebe nicht chancenlos gegen Gewalt und Zynismus? Gibt die Weltgeschichte nicht denen Recht, die Barmherzigkeit und Versöhnung als Märchen verunglimpfen?
Als Humanist undals Christmeine ich:Wir sollten unsan Ausnahmen, an vorbildhaften Idealisten orientieren, an mutigen Menschen wie beispielsweise dem griechischen Musiker MikisTheodorakis (1925–2021), einem der berühmtesten Komponisten und Dirigenten des20.Jahrhunderts. Theodorakis, der einstigeWiderstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, warnicht nur Musiker, er warzugleich ein bedeutenderPolitiker und Schriftsteller. Für seine politischen Überzeugungen saß erjahrelangim Gefängnis und wurdevon der griechischen Militärjunta gefoltert.Bis zuletzt wandte er sich gegenjede Form der Diktatur und setzte sich energisch für denWeltfrieden ein.10
Einanderes Beispiel: Kurt Masur(1927–2015), der weltberühmteLeipziger Dirigent undTräger desInternationalen Preises desWestfälischen Friedens,zählte am 9. Oktober1989, demTag derLeipziger Montagsdemonstrationen,zu den sechs prominentenLeipzigern, die den– überLautsprecher verbreiteten –Aufruf ›Keine Gewalt!‹verfassten. So trug ermaßgeblich beizum friedlichenVerlauf der Kundgebungen undzur friedlichenRevolution (1989/90)in ganz Ostdeutschland.
Menschen wie Mikis Theodorakis oder Kurt Masur sind gewiss, in jeder Hinsicht, seltene Ausnahmeerscheinungen. Aber sie sind nicht die einzigen Friedensstifter in unserer Welt, viele weitere Namen wären zu nennen – etwa Martin Luther King, Edith Stein, Aung San Suu Kyi oder Papst Franziskus.
Manchmal lernt die Menschheit ja doch noch hinzu. Der Umweltwissenschaftler und SPD-Politiker Ernst Ulrich von Weizsäcker (ein Sohn des Physikers und Philosophen Carl Friedrich von Weizsäcker und ein Neffe des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker) erklärteim Frühsommer2022in einemInterview: »Bisins19.Jahrhundert war esvöllig selbstverständlich, dassAußenpolitik hauptsächlich einmilitärisches Kräftemessen war. Folge davon war etwa, dass Frankreich und Deutschland ständigim Kriegmiteinander waren.Vollkommener Wahnsinn. Nach demZweiten Weltkrieg aber kamen die Europäerzusammen, (…) und es gibt echte Freundschaftenzwischen Frankreich und Deutschland.Beiden tut gut,Teile ihrer Souveränitätsrechteabzugeben an eine höhereInstanz. Das sindLerneffekte.«11
3 Apokalyptische Kunstwerke
Im Dienste des Friedens wirkten und wirkenviele Politiker, herausragende Dichter und Denker, große Musiker,indirekt auch bildende Künstler wie der Maler Otto Dix(1891–1969).In der Kunstszene gehört erzu denVertretern der Neuen Sachlichkeit. Er schaffte es, »sich die Grauen des KriegesinBildern von der Seelezu malen, diean die Qualität seiner Vorkriegskunst heranreichen«.12
In der NS-Zeit galt Otto Dix– wie MaxBeckmann, Lovis Corinth, ErnstBarlach, Paul Klee,Pablo Picasso undviele andere –als Repräsentant der »entarteten Kunst«. Eines der bestenWerke von Otto Dixist sein1929 begonnenes und1932 vollendetes Gemälde ›Der Krieg‹.13Es handelt sich um einTriptychon mit Predella, dasimBildaufbau an denIsenheimer Altar von Matthias Grünewald erinnert.
Dargestellt werdenvon Dixmarkante Szenenaus dem ErstenWeltkrieg. Diemittlere Tafel zeigt eineverwüstete Landschaft, über dieLeichen undLeichenteile verstreut sind. Nur ein Soldatmit Gasmaske scheintnoch am Leben zu sein. Die Gestaltung derPredella – diemehrere nebeneinander liegende Soldatenzeigt – orientiert sichan dem Ölgemälde ›Der Leichnam Christiim Grabe‹(1521/22)von HansHolbein demJüngeren.
In den1930erJahren warntenviele Künstlervor deutscher Großmannssucht und einemneuen Krieg. So schuf der Maler MaxBeckmann in seinemTriptychon ›Abfahrt‹(1932/35) eine früheVision über den heraufziehenden Nationalsozialismus.14Dem trügerischen Schein derfaschistischen Gloriole erteilte erin diesemWerk – freilichnicht für jeden erkennbar – eine Abfuhr und ging gleichsam in die innere Emigration.
Eindeutigapokalyptische Motive enthält daskollagenartige, surrealistische Gemälde ›Guernica‹, eines der bekanntesten Bilder Pablo Picassos.15Es entstand1937als Reaktion auf dieZerstörung der spanischen Stadt Guernica durch deutsche unditalienischeLuftstreitkräfte, die während des SpanischenBürgerkriegs auf Seiten des Generals Francisco Franco kämpften.
Seit1900 standPicasso inVerbindung mit antiklerikalen undanarchistischen Künstler- undLiteratenkreisen. Als Anhänger der linksliberalen spanischenVolksfront pflegte erauch mit politisch engagiertenIntellektuellen aus demPariser Surrealistenkreis enge Kontakte.Im teilweise surrealistischen Gemälde ›Guernica‹ übernahmPicasso aber auch zentrale Motive der christlichenIkonographie.16DasBild weistmehrere Anklänge an diePassion Jesu Christiauf. Dieaufschreiende Mutter etwamit dem toten Kindauf der linken Seite des Gemäldes lässtan das christlichePietà-Motiv denken.
Kunstwerke wie ›Der Krieg‹ von Otto Dix oder ›Guernica‹ von Pablo Picasso lassen viele Interpretation zu, ganz sicher auch christliche und mystische Deutungen. Die in der mittelalterlichen Mystik, besonders bei Johannes vom Kreuz, geschilderte Erfahrung des Schweigens Gottes bringen Künstler wie Otto Dix und Pablo Picasso erschütternd zum Ausdruck.
Ja, seitjeherist dieAngst vor dem Krieg und, oftmals damitverwoben, dieAngst vor der Gottesfinsternis einThema auch in der bildenden Kunst–nicht zuletzt imWerk desRenaissance-Malers Albrecht Dürer.In seinem,an einen kryptischen Text derneutestamentlichen Offenbarung(Offb6,9-17)anknüpfenden, Holzschnitt ›Dievier apokalyptischen Reiter‹ (1498) hat Dürer ein erschreckendes,in der Kunstgeschichtevielfach rezipiertes Werk geschaffen.17Archetypisch personifizieren dieReiter den Krieg, die Schlächterei, dieHungersnot und das elende Sterben– den gefräßigenTod, der niedergetrampelte Menschenmit einerHeugabelin denAbgrund schaufelt.
Aktuell ist dieses Bild allemal. Leicht könnte man auf die Idee kommen, die grimmigen Gesichter der apokalyptischen Reiter auf dem Gemälde – frei nach Dürer – mit den Gesichtern von heutigen Politikern und Kriegsherren zu vertauschen.
4 Der Krieg – von Gott nicht gewollt
»Homo homini lupus«, »Der Menschist dem Menschen einWolf«, diesesviel zitierte –von dem englischen Staatstheoretiker undPhilosophen Thomas Hobbesaufgegriffene –Wort desrömischen KomödiendichtersTitus Maccius Plautus (254–184v. Chr.)18scheint sichvor allem inKriegszeiten in übelsterWeisezu bewahrheiten. Den tiefsten Grund und die eigentliche Ursache fürkriegerische Konflikte sieht derPsychologe undTheologe Eugen Drewermannin derPsyche des Menschenverankert:
Der Krieg ist ein Problem, das nicht einer bestimmten Zeit, einem bestimmten Volk, einer bestimmten Kultur, einer bestimmten Gesellschafts- oder Wirtschaftsform angehört, er ist im wahrsten Sinne des Wortes ein menschheitliches Problem. Der Mensch istkriegerisch; –dasist dasProblem des Krieges und dermenschlichen Geschichte.Wer den Kriegvermeiden will,(…)muß den Menschen studieren.(…) Um diemenschliche Geschichtemit ihren Kriegenzu verstehen, muß man die psychischen Gründe verstehen, die den Menschenzum Krieg bestimmen.Dann erst läßt sich überlegen, ob und wie der Kriegvermeidbar ist.19
Ja, man muss versuchen, die psychischen Motive der Kriegstreiber zu verstehen. Doch Kriege sind in jedem Fall Menschenwerk und dürfen, bei allem Verständnis für die Beweggründe der Täter, nicht akzeptiert werden. Der aktuelle Anlass für mein Buch ›Make love not war!‹ ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Dieser Krieg stellt grundsätzlich in Frage, was bisher zu meinen wichtigsten ethischen Prinzipien gehörte und weiterhin gehören wird: dasIdealderGewaltlosigkeit.StefanLanger,derChefredakteurdesWochenjournals›ChristinderGegenwart‹,schrieb überrascht undirritiert: »Dieinneuer Weise von geopolitischen Konflikten–von Krieg!– geprägteWeltlage verlange eine Neubewertung christlicher Friedensethik,meinen derzeitviele. In atemberaubender Geschwindigkeitistja die politische Mehrheitsmeinung umgeschwenkt:Jetzt kann esnicht schnell genug gehenmit derLieferung schwererWaffen an die Ukraine.«20
Auch ich war, und bin, erstaunt über diese plötzlicheWende. Kriege fordern Opfer, sie fordern Menschenleben.Zwar glaubeichals Christan dieAuferstehung derToten und das ewigeLeben in derHerrlichkeit Gottes.Insofern können mich Kriege undihreTodesopfer –imLetzten –nicht aus derBahn werfen. Doch sie erschütternmich imHerzen, sie treiben mich um, sie bewegenmich, kognitiv und emotional,zum Widerspruch. Resignieren werdeichallerdings nicht, ichmöchte tun, wasichkann. Im Hinblickauf dasLeid, das durch Kriegeverursacht wird,können wir– so der bayerische evangelische Landesbischof und ehemaligeTheologieprofessor HeinrichBedford-Strohm – »nur unsere Klagevor Gott bringen.Aber lähmen lassenmüssen wir unsnicht: Wir können helfen.«21
Im vorliegenden Buch schaue ich zurück auf vergangene Zeiten – um daraus Schlüsse zu ziehen für die Gestaltung einer besseren Zukunft. Mein Rückblick auf die Geschichte ist nicht emotionslos, nicht immer »sine ira et studio«
(Tacitus).22Zwar istmir bekannt:Historiker beurteilen Ereignisse derVergangenheit grundsätzlichnicht nach den eigenen Wertvorstellungen, sondernaus derjeweiligenZeit heraus.Ich bin freilichkein unparteiischerHistoriker,kein neutraler Berichterstatter, sondern ein Seelsorger, einTheologe und,ich gestehe es, ein ›Moralist‹. Selbstverständlichnehme ich historische Daten objektivzur Kenntnis,aber ichnehme mir zugleich das subjektiveRecht, sievom Kern derVerkündigung Jesu her– diemeiner persönlichen Überzeugung entspricht–zu bewerten.
In der folgenden Darstellung erörtere ich zunächst, in Kapitel I, die biblischen Grundlagen einer Friedensethik. In einem dokumentierten Streifzug durch die europäische Kriegsgeschichte (Kapitel II) wird sich herausstellen, dass die Gesinnung Jesu in den christlichen Kirchen keineswegs immer zur Geltung kam. Nur allzu oft entgleiste die Welt- und die Christentumsgeschichte und führte zu einer unheiligen Allianz von Religion und Gewalt.
Im Anschluss an diese Geschichte der Kriege skizziere ich in Kapitel III die kirchliche Lehrentwicklung von der überlieferten Doktrin des »gerechten Krieges« bis zu neuesten – katholischen und evangelischen – Erklärungen zu Krieg und Frieden. Ein weiterer Abschnitt, Kapitel IV, ist der internationalen Friedensbewegung gewidmet, insbesondere der christlich motivierten Ablehnung von Waffengewalt. Anhand von formal und inhaltlich ganz verschiedenartigen Texten werde ich in Kapitel V illustrieren: Das Entsetzen vor dem Krieg – oder die Lust an ihm – spiegelt sich in bekannten oder auch weniger bekannten Werken der Dichtkunst, von Dantes ›Divina Commedia‹ über Antikriegslieder der Neuzeit bis hin zu aufwühlenden Kriegsberichten in der Gegenwartsliteratur. Im abschließenden Kapitel VI kommentiere ich den Ukraine- Krieg mit dem Ergebnis: Dieser Krieg ist, wie alle Kriege, ein Verbrechen an der Menschlichkeit und darf nicht fortgesetzt werden.
Die Quintessenzmeiner Darstellungist dasJesuswort »Selig, die Frieden stiften«(Mt 5,9)–in Übereinstimmungauch mit derreligiösen Botschaft desmodernen Oratoriums ›ThePeacemakers‹/›Die Friedensstifter‹(2011) des walisischen Keyboarders und Komponisten KarlJenkins. Diese Chorgesängeimklassisch geprägten Crossover-Stil basierenauf Texten aller Weltreligionen sowie großerPersönlichkeiten wie Franzvon Assisi, Bahá’u’lláh (demBegründer desBahá’í-Glaubens), Anne Frank, Mahatma Gandhi, MartinLuther King, MutterTeresa, Nelson Mandela oder dem DalaiLama. Dem Geist, der Spiritualität solcherPeacemakers und Kämpfer/innen gegen die Unmenschlichkeit sindmeine Ausführungen verpflichtet.
Selig, die keine Gewalt anwenden;
denn sie werden das Land erben.
Selig, die Frieden stiften;
denn sie werden Söhne Gottes genannt werden.
Matthäus 5,5.9
Kapitel I
Biblische Grundlagen
Für eine christliche Ethik ist selbstverständlich die Bibel, vorrangig das Neue Testament, die wichtigste Grundlage – auch im Blick auf Krieg und Frieden. Die biblischen Texte beinhalten allerdings völlig gegensätzliche Aussagen zur Ausübung von Gewalt. Im Alten Testament reicht die Bandbreite von der Kriegsverherrlichung im Namen Gottes bis hin zum Radikalpazifismus. An vielen Stellen des Alten Testaments wird die Anwendung von Gewalt – auch durch Gott und sein erwähltes Volk – einfach als Faktum registriert oder sogar ausdrücklich gutgeheißen und gefeiert. An anderen Stellen jedoch, besonders beim Propheten Deutero-Jesaia, wird der unbedingte Verzicht auf gewaltsames Handeln als erstrebenswertes Ideal dargestellt. Jedenfalls kann man solche Passagen in einem ›pazifistischen‹ Sinne interpretieren.
Besonders anstößig empfindenviele christlicheLeser dasBuch derPsalmen – wegen der häufigenVerwünschungen und mit Gewaltandrohung durchsetztenVerfluchungen der »Feinde«, der »Heiden«, der »Gottlosen«.Andererseits enthält aber gerade derPsalter mit seinen hundertfünfzig Gesängen wunderbare Gebetstexte,vor allem geeignetin existentiellen Situationen desLeidens und der tiefenBetrübnis. Grundsätzlichistzu empfehlen: DiePsalmen sollten »in Empathie und Solidaritätmit denLeidenden gelesen und gebetet« werden.23
Dem ambivalenten, ja kriegerischen Gott in zahlreichen alttestamentlichen Schriften steht der absolut liebende Gott in der Verkündigung Jesu von Nazareth gegenüber. In seiner ›Bergpredigt‹ fordert Jesus den völligen Verzicht auf den Hass und auf jede Art von Gewalt.
Eine andere, eine gerechtere Welt schaffen kann zwar im Letzten nur Gott. Aber in der Nachfolge Jesu und im Geist Jesu Christi am allmählichen Entstehen besserer Lebensbedingungen mitzuwirken, ist – der Predigt Jesu gemäß – eine dem Menschen von Gott selbst gestellte Aufgabe. Nicht die Einbeziehung der irdischen Verhältnisse in den Herrschaftsbereich Gottes, wohl aber das entschiedene Nein zu jeder Form von Gewalt unterscheidet die jesuanische Botschaft vom Fanatismus der religiösen Eiferer, vom Klerikalismus der Hassprediger (etwa in Ländern wie dem Iran, Afghanistan oder auch Russland), von der gottlosen Anmaßung aller Zwangs-Beglücker in vielen Teilen der Welt.
1Der kriegerischeGottdesAlten Testaments
Die Bibel, das Alte wie das Neue Testament, stellt eine Beziehungsgeschichte Gottes mit den Menschen in vielfältigen Formen dar. Dabei geht es oft sehr menschlich zu, verständlicherweise. Denn in der Bibel ›spricht‹ ja nicht einfach Gott selbst, vielmehr bringen Menschen ihre, oft angstbesetzten, Vorstellungen von Gott zur Sprache. Das Alte Testament enthältzwarbedeutsame,theologischhochwichtigePassagen,dieeinetiefespirituelleErfahrungdesMenschenmitder geheimnisvollen, ja abgründigen Gottheit poetisch ins Bild bringen. Es enthält aber auch viele andere Partien, denen ein aus neutestamentlicher Sicht äußerst fragwürdiges Gottesbild zugrunde liegt – das geprägt ist von den politischen Ereignissen in der Lebenswelt der biblischen Autoren: in erster Linie dem Trauma der babylonischen Kriege und der Gefangenschaft des Volkes Israel im 6. Jahrhundert vorChristus.
Als Beleg für ein barmherziges, friedliches, lichtvolles Gottesbildinnerhalb desAlten Testaments werden gerne Stellen aus denPropheten Jesaia und Michazitiert: »Dann schmieden siePflugscharen aus ihren Schwertern undWinzermesser aus ihrenLanzen. Manzieht nicht mehr das Schwert,Volk gegenVolk, und übtnicht mehr für den Krieg.«(Jes2,4) Oder: »DasVolk, dasim Dunkel lebt, sieht ein hellesLicht; über denen, dieimLand der Finsternis wohnen, strahlt einLicht auf. (…)Jeder Stiefel, der dröhnend daherstampft,jeder Mantel, dermit Blut beflecktist, wirdverbrannt, wird ein Fraß des Feuers.«(Jes9,1.4;vgl. Mi4,3) DassPropheten, dass ›Gottesmänner‹ wieJesaia nichts anderes als den Frieden predigten,kann man dennochnicht sagen. Denn unmittelbarnach derverheißenen Beendigung des Krieges erklärtJesaia, wie er sich den Frieden Gottesauf Erdenvorstellt: als gewaltsamen Sieg des Gottes Israels überalle Heidengötzen und derenAnbeter in dennichtjüdischen Völkern (vgl.Jes 2,18-21).24
Der Gott der hebräischenBibel ist weithin einkriegerischer Gott.An vielen Stellen desAlten Testaments wird GottJahwe gelobtals einer, »dermeine Hände den Kampf gelehrt hat,meine Finger den Krieg«(Ps144,1). So berichtet das Erste Buch Samuel genüsslich über diemilitärischen Siege des Königs Saul und diekriegerischen Triumphe seineskünftigen Nachfolgers, des Königs David. Dabei erhält David ganzklar denVorzug gegenüber Saul. Denn: »Saul hatTausende erschlagen. Davidaber Zehntausende.« (1 Sam18,7)25
Im Hintergrundvieler alttestamentlicher Texte stehen dramatische Gewalterfahrungen. Dies geht so weit, dassim Namen Gottes selig gepriesen wird, wer die Kinder der feindlichenBabylonier »packt und sieam Felsenzerschmettert« (Ps137,9). Ja, imPsalm 58 wünscht derBeter den gottlosen Feinden, siemöchten zerfließen wie der Schleim der Schnecke, damit der Gerechte sich seinerRache erfreuen und »seine FüßeimBlut des Frevlers« badenkönne (Ps58,9.11)
DieBefreiung desVolkes Israel aus derägyptischen Knechtschaft war,nach der Darstellung des biblischen Dichters,nur möglich durch das blutige Eingreifen Gottes: »Es war Mitternacht,als derHerralle ErstgeboreneninÄgypten erschlug, vom Erstgeborenen desPharao, derauf demThron saß, biszum Erstgeborenen des Gefangenenim Kerker, undjede Erstgeburt beimVieh.« (Ex12,29)
Zu einer Geschichte purer Gewalt wurde dannauch dieLandnahme in Kanaan durch dasVolk Israel, die eigentlich ein glasklarerimperialistischer Eroberungskrieg war.Alle Völker, die denIsraeliten feindlichimWege standen, solltenauf Anweisung Jahwes ausgelöscht werden: »Aus den Städten dieserVölker jedoch, die derHerr, dein Gott, dirals Erbbesitz gibt, darfst dunichts, wasAtem hat,am Leben lassen.Vielmehr sollst du dieHetiter undAmoriter, Kanaaniter und Perisiter, Hiwiter undJebusiter derVernichtung weihen, so wie es derHerr, dein Gott, dirzur Pflicht gemacht hat, damit sie euchnicht lehren,alle Gräuelnachzuahmen, die sie begingen, wenn sieihren Göttern dienten, undihrnicht gegen den Herrn, euren Gott, sündigt.«(Dt20,16ff.)
SolcheBibelstellen (und es gibtihrernoch sehrviele ähnliche) führenzu dem bekanntenVorwurf, dasalttestamentliche Gottesbild strotzevor Gewalt und sei für Christeninakzeptabel.Tatsächlich ist demTheologen und herausragenden Bibelkenner Eugen Drewermannnicht zu widersprechen: »DieAusrottung oderVertreibung ganzerVölker als dierechte Art des Heiligen Kriegeszu verstehen, den der Stammesgott(…) gebietet,