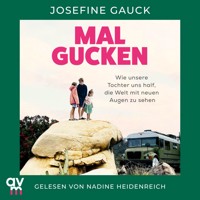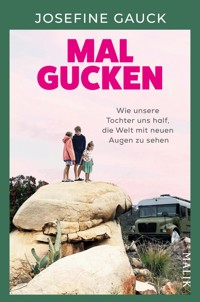
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Ein wunderbares Buch für Familien, die über eine Auszeit nachdenken »›Sie machen das genau richtig‹, verkündete der Arzt, ›packen Sie so viele Reize wie nur möglich in dieses Kind. Ballern Sie Pauli voll mit allem, was geht. Zu viel gibt es nicht, sie wird alles speichern und irgendwann darauf zurückgreifen müssen. Und dann wird sie es Ihnen danken und sich selbst auch.‹ Seine Worte schweben über allem. Sie rechtfertigen das Aufbrauchen der Ersparnisse genauso wie Weihnachten in Disneyland und Silvester auf Fidschi. Wann, wenn nicht jetzt? Worauf noch warten?« Um der erblindenden Pauli die Welt zu zeigen, nimmt sich die fünfköpfige Familie von Josefine Gauck (Enkelin von Joachim Gauck) ein Sabbatical und geht auf eine einjährige Reise um die Welt. »Mal gucken« steht für den Vorsatz der Familie, der fünfjährigen Tochter so viel wie möglich zu zeigen: Bilder, Farben, Erinnerungen, Begegnungen, denn niemand weiß, wie schnell die Sehkraft des Mädchens, die bei Reisebeginn etwa 7 % beträgt, nachlassen wird. »Mal gucken« heißt es auch, wenn es unterwegs um ungewisse Situationen und alltägliche Fragen der Kinder geht – zum Beispiel, wo nachts geschlafen wird oder wohin die Fahrt am nächsten Tag geht. Um das Budget einzuhalten und ein authentisches Bild von Land und Leuten zu bekommen, entdeckt die Familie das Leben im Camper, arbeitet u. a. auf Biofarmen und hütet Häuser samt Haustieren. In Kanada, USA, Neuseeland, Australien und Bali tauchen sie so in das Leben anderer Menschen ein. Pauli und ihre Brüder erleben die Freiheit in den Baumwipfeln eines kanadischen Kletterwalds und entdecken, wie weich Ziegeneuter sich beim Melken anfühlen. Mitreißend und sensibel erzählt die Autorin von der Realisierung der Reise, dem Potenzial einer lebensverändernden Diagnose und den Herausforderungen, als Familie unterwegs zu sein. Eine Weltreise, eine Diagnose und die Chance, Erinnerungen fürs Leben zu schaffen Josefine Gauck rückt die romantische Vorstellung von Roadtrips ins rechte Licht und reflektiert auch humorvoll über die Herausforderung, ein Jahr lang 24/7 den Bedürfnissen von drei Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren gerecht werden zu müssen. »Mal gucken« ist mehr als nur ein Reisebericht; es ist eine aufrüttelnde und authentische Geschichte darüber, wie eine Familie ihre Träume verwirklicht und ihr Leben aktiv gestaltet. Darüber hinaus zeigt Josefine Gauck auf berührende und hoffnungsstiftende Weise, wie eine lebensverändernde Diagnose eines Kindes nicht zu einer Krise, sondern zu einer Chance werden kann. Ansteckend und eindrucksvoll vermittelt sie, welche Kräfte die Reise freisetzt und wie die fünf als Familie dieses gemeinsame große Abenteuer bestehen. »Wie wir dachten, wir müssten unserer Tochter die Welt zeigen, und dabei feststellten, dass wir es selbst viel nötiger hatten.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.malik.de
Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Mal gucken« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Mit 73 Fotos und einer Karte
© 2025 Piper Verlag GmbH, Georgenstraße 4, 80799 München, www.piper.de
Für einen direkten Kontakt und Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an: [email protected]
Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de
Coverabbildung: Josefine Gauck
Bildteilfotos: Josefine Gauck
Karte: cartomedia, Karlsruhe
Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
((Text bei Büchern mit inhaltsrelevanten Abbildungen und Alternativtexten))
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Motto
Weltkarte zur Reise
Sie ist nur blind
Geld, Schule, Kinder
Was haben wir zu verlieren?
Erst mal Ferien
Die FFM
Half of me wants a cold beer
Lumberjacking in Brokeback Mountain
Anstrengend und teuer
Den Ozean hören
Kann man nix machen! Oder doch?
Der amerikanische Traum
Aho
Date with Destiny
Der Zauber unchristlicher Weihnachten
Halbzeit
Ich wär so gern ein Country Girl
»Wisst ihr eigentlich, was für tolle Eltern ihr habt?«
Lernen mit allen Sinnen
Wer die Wahl hat …
Countdown
Epilog
Danke
Bildteil
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Motto
Wir können Angst nicht aus der Welt vertreiben.
Aber Gott und Menschen sei Dank – sie bleibt nicht unsere Herrin.
Weit wird das Land, wenn Menschen das glauben, und ruhig unser ängstliches Herz.
Aus »Brief an meine Enkelin« von Joachim Gauck
Weltkarte zur Reise
Sie ist nur blind
April 2018 – Cuxhaven/Hamburg
»Und wer hat bei euch das Ticket gelöst«?, fragt mich ein Vater an einem überraschend warmen und sonnigen Freitag im April auf dem Spielplatz eines Schullandheims in Cuxhaven, und ich muss schmunzeln. Man nimmt das Thema hier mit Humor, das gefällt mir. Meine angestaute Anspannung beginnt abzufallen. So ganz konnte ich mir nicht vorstellen, was mich erwarten würde auf diesem Familienwochenende des Vereins Freunde blinder und sehbehinderter Kinder e. V.
»Vorträge, Selbsterfahrungen und Kontakte knüpfen für die Eltern und Spaß bei genialem Betreuungsschlüssel (1 : 1) für die Kinder«, so hatte Sina uns das Wochenende angepriesen. Sina, Mitarbeiterin des Vereins und ein Goldstück von einem Menschen, kam seit ein paar Monaten einmal in der Woche zu uns nach Hause und kümmerte sich um die Frühförderung unserer Tochter Pauli. Während sie versuchte, mit penetrant blinkenden Discokugeln Paulis Babyaugen zu stimulieren, schüttete ich ihr regelmäßig mein Herz aus. Ein Segen.
Schaden kann so ein Wochenende nicht, schließlich sind wir neu in diesem Business. Als mir in der 42. Schwangerschaftswoche zum Höhepunkt einer aufregenden Geburt unser drittes Kind – nach zwei mittlerweile fünf- und siebenjährigen Jungs ein Mädchen – in den Arm gelegt wurde, wirkte es zwar wie eine kleine, runzlige Omi, die schon alles erlebt hat, ansonsten schien aber jeder Körperteil am rechten Fleck zu sein.
Trotzdem hemmte mich etwas beim Schreiben der Geburtsanzeige.
Bei Freddie und Pablo hatte ich »Gesund, glücklich und dankbar« geschrieben, aber das »gesund« wollte dieses Mal nicht mit auf die Karte. Mutterinstinkt.
Denn auch ein paar Wochen nach ihrer Geburt verschwand das typische Neugeborenenschielen nicht. Paulis Augen kugelten ziellos in ihren Höhlen herum, und obwohl sie schon lächelte und aktiv reagierte, schien sie uns nicht anzusehen. Stattdessen lauschte sie andächtig, wenn sich jemand in ihrer Umgebung akustisch bemerkbar machte, und drehte ihren kleinen Kopf zum stärksten visuellen Reiz.
»Lichthunger« nennt man dieses Phänomen, wie ich nur kurze Zeit später lernte, denn weder die Kinderärztin noch der Augenarzt fanden den Zustand in irgendeiner Form witzig. Besonders die schnelle, zitternde Augenbewegung namens Nystagmus – wie wenn man aus dem fahrenden Zug schaut – besorgte die Ärzte, denn dieses Mal behielt Dr. Google ausnahmsweise recht: Das Phänomen kann tausend Ursachen haben, und ein Großteil davon sind Diagnosen, die man niemandem wünscht.
Drei Monate nach ihrer Geburt fanden wir uns in der neu eröffneten Kinderklinik der Hamburger Universität wieder. Ein Prachtbau, strahlend und modern, aber mit Mängeln: Erst wurde Pauli anscheinend mit einer anderen Patientin verwechselt, dann war kein Besprechungsraum verfügbar. Der Arzt versuchte, uns auf dem Flur vor dem Untersuchungsbereich, in dem sie unter Narkose lag, seine Erkenntnisse mitzuteilen, aber eine vorbeigehende Krankenschwester scheuchte uns mahnend mit den Worten »Hier können Sie nicht plaudern!« weg. Mein Hirn, bis dato voller Sorge bei unserer schlafenden Tochter im MRT, versuchte, sich kurz ein neues Ziel zu suchen: Wie kommt man auf die Idee, dass sich in einer Kinderklinik Arzt und Eltern irgendwo zum gemütlichen Teekränzchen treffen, fragte ich mich kopfschüttelnd, folgte dann aber dem Arzt in den einzigen leeren Raum weit und breit, das Stillzimmer.
Dunkelrote Jalousien schirmten die hereinfallenden Sonnenstrahlen ab. Automatisch flüsterten wir. Ich starrte auf einen der Fahrrad fahrenden Teddys auf der Tapete, während der Arzt trocken seine Diagnose über uns kippte. Nun haben Augenärzte manchmal Schwierigkeiten, die richtigen Worte zu finden. Dieser sagte: »Gehen Sie davon aus, dass Ihre Tochter keine Basketballspielerin wird. Vielleicht sollte sie lieber etwas mit Musik machen.«
Ah ja. Gut. Oder eben nicht. Er konnte ja nicht wissen, dass ich mir unsere drei Monate alte Tochter nie zuvor als Basketballspielerin vorgestellt hatte. Wie auch? Ist es doch das Naheliegendste, sobald man sein neugeborenes Kind nach einem Geburtsmarathon im Arm hält.
Was auf diesen Moment im Stillzimmer folgte, war wie der Augenblick beim Schaukeln, wenn man für den Bruchteil einer Sekunde am höchsten Punkt ist: kurze Erleichterung, aber dann wieder dieses drückende Gefühl in der Magengrube, beim Zurückschwingen.
Alle lebensbedrohlichen Schrecklichkeiten waren ausgeschlossen, aber Pauli war blind. Nahezu, vielleicht ein Sehrest. So ganz genau kann man das nicht sagen bei so einem kleinen Wurm, meinte der Arzt, dafür braucht es Untersuchungen in Spezialkliniken. Er vermutete eine äußerst seltene Anomalie der Netzhaut.
Kein Hirntumor, keine OPs, kein aufgesägter Schädel, keine Dauermedikation, keine Schmerzen. Das gar nicht mal so leise und bedrohliche Pochen der Ungewissheit, das in den letzten Wochen dazu geführt hatte, dass ich mir das Allerschlimmste ausmalte, verflog, einfach so, und schaffte Platz für neue Gefühle. Wenn man mit dem Grauenvollsten gerechnet hat, dann sagt man plötzlich Dinge wie: »Sie ist nur blind!« Ein Satz, von dem man nicht wusste, dass das Schicksal ihn für einen bereithält und dass er einem mit einem Gefühl von Erleichterung über die Lippen gehen kann und wird.
Ein Befund, der in einem anderen Kontext das Potenzial hätte, innerhalb von Sekunden den Boden unter den elterlichen Füßen in Luft aufzulösen, bedeutete für uns in diesem Moment das Glück auf Erden. Ach, wenn es nur das ist, damit kann man leben. Alles eine Sache der Perspektive, dachte ich optimistisch auf dem Weg zum Aufwachraum, um Pauli in Empfang zu nehmen.
Auf dem langen, nach frischer Farbe riechenden Gang kommt mir ein Pfleger entgegen, der ein Bett schiebt. Eine Frau mit dunklen Augenringen und verschwommenem Blick hält durch die Gitterstäbe die Hand eines kleinen Kindes ohne Haare. Auf der anderen Seite umklammert ein Mann krampfhaft die Metallstange des Bettes, als würde er beim Schieben helfen, dabei macht es eher den Eindruck, als würde er ohne das Bett umfallen.
Das bleibt mir erspart, denke ich dankbar und schäme mich sofort.
Im Aufwachraum herrscht eine angenehme Ruhe. Vereinzelt piepst etwas, die Schwestern reden leise miteinander. Ich komme zu Paulis Bett. Wie ein kleines Bündel liegt sie unter einer Decke, blass und tief schlafend. Kochsalzlösung tropft durch den Schlauch in ihren schlaffen Körper, und langsam sickern auch bei mir die Worte des Arztes durch. Mein Kind sieht nichts. Und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich weiß nicht im Geringsten, was da auf uns zukommt, wie es weitergeht. Schonungslos baut sich eine Wand aus unendlich vielen Fragen vor mir auf. Aber bevor ich die Möglichkeit habe, auch nur über eine Antwort nachzudenken, taucht eine neue Frage auf und blockiert die vorige.
Was heißt das jetzt? Was passiert als Nächstes? Wie funktioniert das alles? Können wir noch in unserer Wohnung wohnen? Was ist mit unseren anderen Kindern? Wird Pauli einen ganz normalen Kindergarten besuchen können? Wie verändert sich unser Leben jetzt? Was muss sich verändern? Was müssen wir ändern?
Verwirrt erzähle ich meiner Schwester am Telefon von den Untersuchungsergebnissen. Mein Gehirn kämpft mit dem konfusen Zustand von Erleichterung und Sorge und entlädt sich in einem Meer aus Tränen. Rückblickend bin ich ziemlich sicher, dass dies der einzige Moment war, in dem ich so heftig geweint habe. Danach war schlicht kein Raum mehr dafür. Vielleicht weil für Freddie und Pablo alles so normal wie möglich bleiben sollte, vielleicht setzte die Verdrängung schon ein.
Und nun, acht Monate später, haben wir das Gepäck in unserem Zimmer des Schullandheims verstaut, das sich nicht im Geringsten von den Zimmern der Klassenfahrten meiner Kindheit unterscheidet. In Schullandheimen steht die Zeit still. Der Fußboden aus beigem Linoleum, zwei Doppelstockbetten mit grau-gelb gestreifter Bettwäsche, Schränke aus Pressholz, ein Tisch, ein Stuhl. Der einmalige Geruch nach einer Mischung aus rotem Tee und »Irgendwas mit Fleisch, zerkochtem Gemüse und Soße« katapultiert mich zurück in ein Klassenfahrtgefühl aus Abenteuer und Heimweh.
Die mit dem Ticket ist also Pauli, unsere Tochter. Sie hat uns an diesen Ort geführt, an dem wir ohne sie vermutlich nie gelandet wären. Wir lernen Menschen kennen, die wir ohne sie nie getroffen hätten, und sammeln Erfahrungen, die ohne sie außerhalb unseres Horizontes lagen. Mit der Zeit trudeln mehr Familien auf dem Spielplatz ein. Alle Kinder sind entweder sehbehindert oder vollkommen blind. Einige haben zusätzlich Trisomie 21 oder Kleinwüchsigkeit. Manche sind ohne Augen auf die Welt gekommen, andere sind vom Wickeltisch gefallen oder durch ein Schütteltrauma so schwer geschädigt, dass sie nicht nur nicht mehr sehen, sondern auch ansonsten kaum am Leben teilnehmen können. Alle sind mit ihren Familien oder Pflegefamilien hier. Keins der betroffenen Kinder gleicht dem anderen, und trotzdem sitzen alle hier im gleichen Boot. Das merkt man sofort. Es gibt keinerlei Berührungsängste, alle haben dasselbe Thema, und daraus ergibt sich ein guter Gesprächseinstieg: »Und was hat dein Kind genau?«, fragt man ungeniert, denn deshalb sind wir ja hier: um uns auszutauschen und voneinander zu lernen. Jeder, der schon mal eine Selbsthilfegruppe besucht hat, kennt das Gefühl, unter seinesgleichen zu sein. Ein Problem oder Schicksal mit anderen Menschen zu teilen, verbindet.
Im »normalen Leben« ist man oft hin- und hergerissen: Man möchte nicht die Mutter sein, die ständig von den besonderen Herausforderungen, den Ängsten und Sorgen mit dem einen Kind erzählt, das anders ist als die anderen. Fragt mein Gegenüber nur aus Höflichkeit, oder ist es wirklich daran interessiert, was mir durch den Kopf geht?
Und dann gibt es ein paar Verwandte, die plötzlich viel erschütterter und trauriger über »das alles« sind. Die unfähig sind, beim Namen zu nennen, was los ist, und ständig weinen, wenn sie Pauli sehen, die ahnungslos und fröhlich vor sich hin glucksend an Sophie la Giraffe kaut. Dann findet man sich in Situationen wieder, in denen man diese Menschen wegen des eigenen Schicksals tröstet, und man selbst bleibt die ganze Zeit stark. Dabei möchte man doch auch einfach mal weinen, verzweifeln oder verzagen. Nur mal kurz. Aber das geht nicht. Da sind schließlich drei Kinder, und die haben Hunger und möchten ein Buch vorgelesen bekommen. Also macht man das. Und tröstet nebenbei die Verwandtschaft. Und erzählt ihr von den wunderbaren Dingen, die wir hier bei diesem Wochenende lernen: von den Hilfsmitteln, Apps und technischen Geräten, die das Leben für blinde und sehbehinderte Menschen fast grenzenlos erleichtern, und davon, was für ein Unterschied es ist, heute blind zu sein oder vor fünfzig Jahren, und wie das erst in zwanzig Jahren sein wird, wenn unsere kleine Dame erwachsen ist, was es dann alles geben wird, das können wir uns jetzt gar nicht vorstellen.
Noch weniger vorstellen kann ich mir, wie ein blindes Kind krabbeln lernt und laufen, wie es essen soll und spielen, wie es Freundschaften schließt und einen Kindergarten besucht. Vor meinem inneren Auge taucht eine kleine Gruppe Kinder auf, die glücklich im Garten ihrer Kita miteinander spielen, plötzlich laufen alle weg, und nur eins bleibt stehen, weil es nicht sehen kann, in welche Richtung die anderen gerannt sind … An Schule denk ich lieber nicht, und schon gar nicht an »in 20 Jahren«. Aber dann mach ich es natürlich doch.
Wie viel wird sie sehen? Wird das für immer so bleiben? Oder wird sie eines Morgens aufwachen und plötzlich gar nichts mehr sehen?, frage ich mich. Kann man ein Kind auf so etwas vorbereiten, und sollte man das überhaupt?
Und weit unten, tief vergraben unter der ganzen pragmatischen Lebensgestaltung, schlummern die wichtigen Fragen, an die ich mich nicht traue, von denen ich mich vehement abzulenken versuche: Wird sie sich verlieben, so wie andere es tun? Wird sie, wie Gleichaltrige, nach einer durchfeierten Nacht morgens auf dem Hamburger Fischmarkt mit einem letzten Bier in der Hand auf einer Mauer sitzen und mit ihrem Crush knutschen? Wie verliebt man sich, wenn man nichts sehen kann? Wie vertraut man? Wie kann man unabhängig sein, ein selbstständiges Leben führen? Wird sie genauso frei ihren Beruf wählen wie andere? Und Kinder bekommen? Wie kümmert man sich um ein Baby, wenn man selbst nichts sieht?
In Cuxhaven bekomme ich Antworten. Antworten von anderen betroffenen Eltern und von blinden Erwachsenen. Und diese Antworten spenden Hoffnung. Ich höre von Ski fahrenden, studierenden, verliebten, Familien gründenden, aber vor allem von glücklichen blinden Menschen. Und ich fange an zu vertrauen. Eins hat uns Pauli jetzt schon gezeigt: Es gibt so viel mehr als diesen einen Sinn. Und wir sind dankbar für die Begegnungen, die wir ihretwegen schon erleben durften, den erweiterten Horizont, das Fokussieren auf das Wichtige im Leben.
Es dauert fast zwei Jahre, bis wir eine richtige Diagnose bekommen. Die Spezialisten sind sich sicher, dass es sich bei ihrem Zustand um einen seltenen Gendefekt handelt. Einen Beweis dafür haben wir nicht. Alle Gene, die für diese Besonderheit bekannt sind, sind in Ordnung. Das heißt aber nichts. Jahr für Jahr werden mehr Varianten erforscht. Vielleicht ist ihre irgendwann dabei. Vielleicht nicht. Eigentlich ist es egal. Heilung gibt es aktuell sowieso nicht. Im Gegenteil, die Erkrankung, die, da Genmutation, keine ist, sondern eine Behinderung, verläuft degenerativ. Das heißt, irgendwann könnte sie ihren sogenannten Sehrest, der von Untersuchung zu Untersuchung zwischen zwei und acht Prozent schwankt, verlieren. Ob und wann, kann man nicht sagen. Nachtblind ist sie jetzt schon. Und so hangeln wir uns über die Zeit von Meilenstein zu Meilenstein. Erst krabbelt sie, später läuft sie. Und zwar wider Erwarten nicht ständig irgendwo dagegen. Da wir nicht genau wissen, was sie sehen kann, lernen und wachsen wir mit ihr in diesen neuen Abschnitt unserer Geschichte. Wir lernen, damit umzugehen, dass ein drei Monate altes Baby mit Brille anders angeguckt wird, später gewöhnen wir uns an, jede Stufe anzukündigen, wir leuchten unsere Wohnung bis in alle Ecken aus und melden sie bei einer inklusiven Kita an.
Eines Tages haben wir einen Brief mit einem bunten Kärtchen im Briefkasten. »Schwerbehindertenausweis« steht auf der Karte. Paulis Grad der Behinderung liegt bei neunzig Prozent. Ich schaue mir das Plastikdokument an, lese ihren Namen und die Kürzel für all die Hilfestellungen, die ihr gesetzlich zustehen: ständige Begleitung und Befreiung von Rundfunkgebühren, zum Beispiel.
Die übertreiben aber ganz schön; nicht schwerbehindert, sondern schwer in Ordnung, denke ich und packe das Teil in mein Portemonnaie.
Im Laufe der Jahre hat sich gezeigt, wie sehr wir Sehenden auf diesen Sinn fixiert sind und wie wenig man sich vorstellen kann, ohne ihn zu leben. Pauli kennt es nicht anders. Für sie ist das, was sie sieht oder eben nicht sieht, normal. Freddie und Pablo habe ich es damals anhand des Hais erklärt. Haie können elektromagnetische Impulse mithilfe von spezifischen Rezeptoren registrieren. Menschen nicht. Aber es fehlt uns nicht. Etwas vermissen, was man nicht kennt, ist das möglich, oder entsteht dieses Gefühl erst, wenn man sich als Nichtsehender in der Welt der Sehenden zurechtfinden muss?
Für meinen Mann Oli und mich war klar, dass wir Pauli nicht in Watte packen. Sie muss und darf die gleichen Erfahrungen machen wie ihre großen Brüder. Und die zwei waren bei diesem Prozess wahnsinnig hilfreich. Wäre Pauli unsere Erstgeborene gewesen, hätten wir uns möglicherweise mehr darauf fokussiert, wären vorsichtiger und sorgenvoller gewesen. So blieb weder Raum noch Kapazität dafür, die Jungs forderten das normale Leben in vollem Umfang ein, und das war ein Segen. Das Leben geht weiter, weil es weitergehen muss. So einfach und doch so hilfreich.
Ja, Pauli sieht etwas, sie ist nicht vollständig blind. Sie trägt eine starke Brille, die es ihr ermöglicht, das volle Potenzial ihres Sehrestes zu nutzen.
Ihr Status hat sich innerhalb der ersten zwei Jahre von »blind« zu »schwer sehbehindert« geändert. Das ist jetzt die offizielle Bezeichnung, und wie mit so vielen Merkmalen bei Menschen ist auch diese Behinderung unterschiedlich ausgeprägt, hat viele Gesichter und Varianten. Die gleiche Diagnose zeigt sich selbst bei Geschwistern mit unterschiedlichem Verlauf.
Prognosen sind nicht machbar. Uns wurde gesagt, dass ihre Augen sich bis zum sechsten Lebensjahr weiterentwickeln können, wie bei jedem Kind. Aber es kann auch in die andere Richtung laufen …, niemand weiß das.
Ich glaube, mit dieser Diagnose wurde ein Aspekt tiefer in unser Leben gepflanzt, der zwar jeden Menschen ständig begleitet, den wir aber zu oft versuchen zu beherrschen: die Ungewissheit. Diese radikale Ungewissheit, die so eine Diagnose und Prognose mit sich bringt, zwingt einen auf die harte Tour dazu, sie zu akzeptieren. Das Unlenkbare. Das nicht Planbare. Und plötzlich merkt man, wie lächerlich es war, wissen zu wollen, was passieren wird, zu denken, man könnte dahinterkommen, hinter das Geheimnis des Lebens, dabei hat man doch gar keine Chance. Ich finde es nicht toll, dass das Leben meines Kindes von einer Behinderung geprägt sein wird. Aber ohne sie hätten wir vielleicht nicht loslassen können von so viel Schnickschnack, der uns gehalten hat. Von den Unwichtigkeiten des modernen Lebens, die einen ständig dazu verleiten, Wege zu gehen, die man nicht gehen will, und hinter Mauern zu leben, die man nicht braucht.
Möglicherweise war es der letzte Schubs, »all in« zu gehen. Unsere Tochter könnte irgendwann ihr Augenlicht verlieren, was haben wir schon zu verlieren, wenn wir mal für ein Jahr unser gewohntes Leben verlassen und schauen, was passiert?
Geld, Schule, Kinder
April 2022 – Hamburg
Inmitten von Kisten und stapelweise Zeugs sitze ich in unserem Schlafzimmer auf dem Boden und kämpfe mit aller Macht dagegen an, nicht die Nerven zu verlieren. In ein paar Wochen ziehen wir aus diesem Haus aus, und bis dahin muss der komplette Hausstand in
kann weg,
kommt ins Lager,
kommt in die Übergangslösung (aka Haus meiner Mutter) und
kommt mit
sortiert werden.
Jedes Ding, das mir in die Hände fällt, verlangt gnadenlos eine Entscheidung. Das Abiturzeugnis in gleichem Maße wie jede einzelne Haarspange, die sich in den letzten Jahren angesammelt hat, oder die unzähligen, auf Schnipsel gekritzelten Botschaften meiner Kinder. Was kommt wohin? Das Differenzieren der Wichtigkeit sämtlicher Gegenstände fällt mir zusehends schwerer, und – man muss es sagen, wie es ist – ich bin vollkommen überfordert.
Wie ein Käfer auf dem Rücken verfalle ich in eine Starre und glotze an die Decke. Werde ich diesen Kapuzenpullover in Kanada anziehen? Und zu welcher Hose passt er am besten?, frage ich mich überflüssigerweise und hänge dem Gedanken dann trotzdem eine Viertelstunde nach.
Der Auszug entpuppt sich als Mammutprojekt, das dem unbeschwerten Jahr zwingend vorausgehen muss. Das hatte mir nicht vorgeschwebt, als die Idee zu dieser Reise in mir wuchs.
Ein Jahr zuvor waren wir in einem der Corona-Lockdowns nach Teneriffa geflüchtet. Wir schlüpften durch eine Grauzone und verlegten Homeschool und -office in die Sonne. Und während wir dort abseits der deutschen Ängste und Sorgen, der Passivität und Unzufriedenheit unsere Zeit verbrachten und feststellten, wie gut uns der Abstand tat, fingen wir an, unser bisheriges Leben zu reflektieren.
Diese Krise, der darauffolgende Tapetenwechsel und die Erkenntnis, dass das Schicksal uns die Aufgabe gegeben hat, ein Kind mit Sehbeeinträchtigung durchs Leben zu begleiten, lösten in Oli und mir ein starkes Bedürfnis nach Veränderung aus.
Wir fragten uns, was wir unseren Kindern beibringen und welche Werte wir ihnen vermitteln wollen, was an dem System und den Strukturen, in denen wir unser Leben verbringen, Murks ist und warum wir uns in Hamburg nicht mehr wohlfühlten. Das Gefühl, dass da noch mehr sein muss, dass es das nicht gewesen sein kann, bestimmte zusehends meine Gedanken. Bestehen in Deutschland wirklich die besten Voraussetzungen für unseren Lebensentwurf und die Bedürfnisse eines jeden einzelnen Familienmitgliedes? Gibt es genügend Unterstützung und genügend Förderung? Bietet dieses Setting uns Eltern ausreichend Möglichkeiten, für uns selbst zu sorgen, damit wir uns angemessen um unsere Kinder kümmern können? Ich wehrte mich vehement dagegen, nach dieser kleinen Auszeit wieder so weiterzumachen wie vorher.
»Mama, können wir nicht für immer hierbleiben«, fragte der damals neunjährige Pablo eines Abends beim Essen draußen auf der Terrasse unseres Airbnb-Häuschens, während er sich eine Ladung Nudeln mit Pesto in den Mund schob. Die Abendsonne schien auf sein gebräuntes Gesicht. Die tiefdunklen Schatten, die die Pandemie mit all ihren Herausforderungen unter seinen Augen hinterlassen hatte, verschwanden langsam. Ich guckte ihn an. Monatelang hatte ein Schleier aus Lethargie und Traurigkeit über seinem Blick gelegen. Nun funkelten seine Augen mich an. Es tat gut, ihn so zu sehen. Es heilte ein Stück der Zeit, die unsere Familie mehr gebeutelt hatte, als wir dachten. Freddie und Pauli stimmten sofort mit einem »Jaaaa« aus vollem Halse mit ein. »Können wir? Können wir? Bitte!«, bettelten sie in geschwisterlichem Einklang.
»Tja, wenn das mal so einfach wäre«, entgegnete Oli, als unsere Blicke sich trafen.
Später, als die Kinder im Bett waren und wir auf einer Bank vor unserem Häuschen saßen, den Blick über einen wilden Dschungel aus Bananenplantagen zum glasklaren Horizont des Atlantiks gerichtet, fragte ich meinen Mann: »Einfach sicher nicht, aber glaubst du nicht auch, es wäre einen Versuch wert?«
»Was?«, fragte Oli, der genauso wie ich spürte, dass es uns als Familie seit Langem mal wieder gut ging, »hier wohnen?«
»Nein, nicht direkt. Aber irgendwas anders machen. Es steht doch sowieso alles gerade kopf. Glaubst du nicht, es ist möglicherweise der beste Zeitpunkt, noch mal ganz neu anzufangen? Das Leben zu transformieren?«
»Ich höre zu …!«, sagte Oli, wohl wissend, dass ich in meinem Kopf schon Plan A–Z hatte, und gespannt darauf, wie diese aussehen würden.
»Was ist, wenn das, was hier gerade passiert, der Impuls ist, den wir brauchen?«, fragte ich weiter. Ich war beflügelt davon, wie wunderbar das alles hier aufging. Was hatte ich die Nächte vor unserer Abreise nach Teneriffa wach gelegen! Darf man das? In einer Pandemie das Land verlassen? Ist das unsolidarisch? Was ist, wenn die Schulen das rausbekommen? Zwar gab es zu diesem Zeitpunkt keine Auflage, dass die Kinder an ihrem festen Wohnsitz den täglichen Videocalls mit der Klasse folgen mussten, aber das Ganze ins Ausland zu verlegen war sicher auch nicht die gesetzestreueste Variante.
Aber all die Sorgen waren umsonst. Keinen scherte es, im Gegenteil: Selbst der homeschoolmüde Pablo schaffte es, die zermürbenden Stapel an Arbeitsblättern zu erledigen, wenn ihm dabei die Sonne auf den Rücken schien und er zwischen Mathe und Deutsch kurz in den Pool springen konnte. Die Nachmittage verbrachten wir am Meer, die Insel war leer, wir trafen keine Menschen, coronakonformer ging es also gar nicht. Dass etwas, von dem ich wusste, dass es uns guttun würde, mir dennoch im Vorfeld so viele Sorgen bereitet, sich schlussendlich aber zu etwas ganz Wunderbarem und Sorgenfreiem entwickelt hatte, brachte mich dazu, weiterzuspinnen.
Lapidar sagte ich: »Ach, so ein Jahr mit dem Wohnmobil durch die Gegend zu cruisen wär doch auch ganz cool!« Und ohne es zu ahnen, beförderte ich uns damit in eine existenzielle Zwickmühle, denn Oli und ich gehören zu den Menschen, die Angst davor haben, den Rest ihres Lebens zu bereuen, etwas nicht gemacht zu haben.
Oli lachte, aber ich wusste, er ist mit an Bord, und dieser Gedanke, den ich in ihn gepflanzt hatte, er würde wachsen. Er ist ein Träumer und ein Abenteurer, kein Grübler. Den Teufel an die Wand zu malen, darin war immer ich die Meisterin. Vielleicht überraschte es ihn deshalb, dass ich im Laufe unseres Aufenthaltes auf Teneriffa immer wieder mit dem Thema anfing. Er merkte, dass ich es ernst meinte. Und die Tatsache, dass dieser Mann noch nie eine Idee von mir schlechtgemacht oder wegdiskutiert hatte, bot Potenzial, dass auch diese ihre Chance bekäme.
Und nun, knapp ein Jahr mit Recherche, Vergleichen von Informationen, Auseinandersetzungen mit Behörden, Verhandlungen von Verträgen, der Abstimmung mit Arbeitgebern, dem Sortieren unserer Finanzen in riesigen Exceltabellen, mit Buchungen von Flügen, Warten auf Genehmigungen, dem Finden eines Übergangszuhauses für die Katzen und unzähligen Entscheidungen später, ist das Haus gekündigt und sind die One-Way-Tickets gekauft. Oli nimmt zum ersten Mal in seiner Karriere Elternzeit. Wir machen ein Sabbatjahr.
Seit diesen Tagen auf Teneriffa sind die Monate, von einer paradoxen Schwerfälligkeit begleitet, an uns vorbeigerast. Ein Jahr ist eine lange Zeit, wenn sich neben dem Alltag alles um eine einzelne Sache dreht, die das Leben grundsätzlich verändert. Ständig finden wir uns in Situationen wieder, in denen es noch zu früh ist, Vorgänge abzuwickeln, Gegenstände zu verkaufen oder Menschen zu verabschieden, und gleichzeitig wird die Zeit knapp.
Freunde und Familie haben Gesprächsbedarf, immer wieder müssen wir uns für diese rabiate Entscheidung rechtfertigen, und ständig sagen uns alle, wie mutig wir sind. Bis jetzt habe ich mich nicht als besonders mutig empfunden, eher im Gegenteil, aber wenn einem das pausenlos zugetragen wird, beginnt man, darüber nachzudenken. Mutig sein bedeutet, dass damit eine gewisse Bedrohung verbunden ist. Laut Wörterbuch: »Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Situation seine Angst zu überwinden«. Ich hatte unser Vorhaben weder als gefährlich noch als riskant eingestuft, und die Angst, die es zu bezwingen galt, war nicht vorhanden, aber ich bin ja offen dafür, den Teufel an die Wand zu malen. Ergo sorge ich mich zwischenzeitlich um die drei Hauptrisikofaktoren: Geld, Schule, Kinder.
Um das gleich vorwegzunehmen, dafür muss man Lösungen finden. Und zwar höchst individuelle. Denn auch bei uns tauchte als Erstes die Frage auf: »Geht das überhaupt?« Und diese Frage hätten wir ohne Weiteres mit »nein« und als Rechtfertigung wahlweise einen der fünf Millionen Gründe aufführen können, die einem so im Weg stehen. Und vielleicht ist das der Punkt, an dem das mit dem Mut wichtig wird. Denn ohne die lebenstransformierende Erkenntnis, dass ich nicht die Umstände managen, sondern mein Leben aktiv gestalten muss, damit es ist, wie ich es mir wünsche, hätte ich den Mut vielleicht nicht aufgebracht, mich in so eine ungewisse Situation zu begeben. Selbst Verantwortung für das Leben zu übernehmen und nicht der Vergangenheit, den eigenen Eltern, den Umständen, dem Prüfer, Busfahrer oder, schlimmer noch, den eigenen Kindern die Schuld zu geben war ein Schlüsselmoment in diesem Prozess, der sicherlich nicht von heute auf morgen stattgefunden hat. Es war nicht einfach und ist nicht im Vorbeigehen passiert. Im Gegenteil, es tut weh. Der Geburtsschmerz des Mutes. Er vergeht, aber es kostet Kraft, täglich ein Mindset aufrechtzuerhalten, das sich so fundamental von dem unterscheidet, wie man den Großteil seines bisherigen Lebens verbracht hat.
Ist dieser Schritt erst vollzogen, wird es einfacher. Wenn man die Grenze erst mal überschritten hat, sich eingestanden hat, dass man etwas wirklich verändern will, dann beginnt der Zauber. Dann ist ganz plötzlich alles möglich. Nachdem man die Schwelle übertreten und der Idee den nötigen Raum und die nötige Zeit gegeben hat, sich mit den eigenen Bedürfnissen und Erwartungen zu einer Vision zu verbinden, wird es immer klarer. Es ist ein Prozess.
Unzählige Male lassen wir uns erzählen, dass es in Vancouver genauso viel regnet wie in Hamburg, wir müssen trotzdem los und es selbst sehen. Begreifen durch Erleben. Die ursprünglichste aller Lernmethoden. Wann haben wir uns das abtrainiert? Warum glauben wir, dass die Theorie reicht? Nur in Gedanken über den Tellerrand zu schauen erfüllt nicht seinen Zweck. Unsichere Wege beschreiten, ausprobieren, eigene physische Erfahrungen sammeln und Momente erleben, die komplett außerhalb der Komfortzone liegen, so stößt man Prozesse an und setzt Potenzial frei. Potenzial, das sonst unter Mustern und Angewohnheiten und den Umständen des Lebens begraben bleiben.
Geld, Schule, Kinder also. Die drei wichtigsten Faktoren, die es zu bewältigen gilt.
Am einfachsten haben es uns die Kinder gemacht: Wir haben es tatsächlich riskiert und sie einfach gefragt, ob sie Lust hätten, ein Jahr um die Welt zu reisen, und dankenswerterweise haben sie, abenteuerlustig, wie sie sind, »ja« gesagt. Gut, sie waren damals elf, neun und vier. Ich würde mal behaupten, in dem Alter hätten wir sie auch ohne Weiteres davon überzeugen können, ein Jahr im Garten zu zelten. Trotzdem muss man individuell abwägen, inwiefern man Kinder, die keine Vorstellung davon haben, was es bedeutet, das Zuhause zu verlassen, oder wie lange ein Jahr wirklich dauert, tatsächlich in die Planung miteinzubeziehen.
Bei dem Thema Schule wird die Sache schon schwieriger. Grundsätzlich gilt in Deutschland die Schulpflicht, und zwar eine der strengsten auf der ganzen Welt. Möchte man es sich leicht machen, so plant man eine längere Auszeit besser, bevor die Kinder eingeschult werden. Für alle anderen Fälle kann ich hier leider keine pauschale Lösung anbieten. Abgesehen davon, dass das Schulsystem in Deutschland Ländersache ist, sind auch von Schule zu Schule und Schulleitung zu Schulleitung individuelle Lösungen möglich. Ich würde immer erst mal dazu raten, mit der Schule ins Gespräch zu kommen, und zwar so früh wie möglich.
Möchte man nicht reisen, sondern seine Zeit an einem Fleck im Ausland verbringen, kann man die Kinder natürlich auch dort an einer Schule anmelden. Darüber hinaus gibt es weltweit Onlineschulen für Homeschool-Kinder, auch dies könnte eine Option sein. Sollte man trotz intensiver Auseinandersetzung mit den zuständigen Entscheidungsträgern zu keiner befriedigenden Einigung kommen, so bleibt in letzter Konsequenz immer noch die Abmeldung aus Deutschland. In dem Fall sind die Kinder nicht mehr schulpflichtig. Allerdings stehen damit ein paar Auflagen in Verbindung, die es zu bedenken gilt.
Für alle, die hinterher definitiv in ihr altes Leben zurückkehren wollen, sei darauf hingewiesen, dass das deutsche Schulsystem auch für eine Rückkehr aus dem Ausland Auflagen parat hat. Sagen wir mal so: Erst lassen sie dich nicht raus und dann nicht wieder rein. Das sollte also vorab geklärt werden.
Im Internet gibt es sehr viele Foren zu dem Thema. Sich dazu auszutauschen ist informativ und empfehlenswert.
Und nun zum dritten der Top drei der »Geht nicht«-Gründe: dem Geld. Es wäre falsch zu sagen, dass es nicht hilfreich ist, welches zu haben. Im selben Maße wäre es aber auch nicht richtig zu sagen, dass es ohne unmöglich ist. Ich möchte nicht mit Phrasen um mich werfen, aber in diesem Fall gilt tatsächlich: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Man muss nur bereit sein, ihn zu suchen, und akzeptieren, dass er vermutlich anders aussieht, als man gedacht hat. Wenn man ihn aber erst mal beschreitet, ergeben sich Lösungen.
Ich kenne Familien, die haben viele Jahre gespart, um sich einen solchen Traum erfüllen zu können. Andere haben ihr Haus verkauft. Wieder andere haben ihre Ansprüche für ein solches Vorhaben stark reduziert. Natürlich kann man eine Weltreise machen, indem man jede Woche in ein anderes Flugzeug steigt und hippe Airbnbs und schicke Hotels bucht. Aber es geht auch anders. Low budget zu reisen ist eine Sparte, in die es sich reinzufuchsen lohnt. Es gibt unzählige Möglichkeiten, nicht nur was die Art und Weise der Fortbewegung, sondern auch der Unterkünfte betrifft. Man kann Autos und Wohnwagen überführen, auf Farmen gegen Verpflegung und Unterkunft arbeiten, Häuser und Haustiere sitten oder Wohnungen tauschen, um nur ein paar Optionen zu nennen. Wenn man bereit dazu ist, flexibel zu sein und auch mal Lösungen ins Auge zu fassen, die auf den ersten Blick nicht zur eigenen Vision des Traums gehört haben, sind die Möglichkeiten unbegrenzt.
Wir persönlich hatten ein wenig geerbt und viel gespart. Außerdem haben wir unser Auto, unser Lastenrad und andere sperrige Dinge verkauft und unser Haus gekündigt. Des Weiteren haben wir versucht, uns auf wenige lange Flüge zu beschränken. Flugtickets für fünf Personen gehen ins Geld, das ist einfach so. Da wir authentische Erfahrungen machen wollten, kamen für uns das Haussitten und das WWOOF-Programm (Worldwide Opportunities on Organic Farms) genau richtig, das Betreiber ökologischer Landwirtschaft und freiwillige Helfende zusammenbringt. Im Internet findet man viele Plattformen für solche Vorhaben.
Generell kann ich den Tipp geben, die aufregende Vorstellung einer Weltreise dem Budget anzupassen. Vielerorts kann man es sich nicht leisten, in jedem fancy Restaurant zu speisen, sondern breitet seine Picknickdecke eben daneben aus und holt die mitgebrachten Lunchboxen raus.
Die Planungsphase unserer Reise lag vor der Zeit von ChatGPT und Co. Ansonsten hätten wir es uns auch leicht machen können, Bedürfnisse, Wünsche und Budget in diese Maschine zu werfen und uns eine Route ausspucken zu lassen. Mit Sicherheit hätte die Reise ganz anders ausgesehen. Möglicherweise hätten wir andere tolle Dinge erlebt, die wir nun verpasst haben, möglicherweise hätte es uns auch nur mehr gestresst. Ich bin froh, dass wir unseren Kopf selbst nutzen und in uns hineinhorchen mussten, um herauszufinden, wohin wir eigentlich wollten.
Wir haben uns tatsächlich sehr von unseren Gefühlen leiten lassen. Unser Wunsch war es, uns inspirieren zu lassen und zu schauen, wie andere Menschen mit ähnlichen Voraussetzungen leben. Daraus ergab sich eine kleine, aber feine Liste von Kriterien, die wiederum eine kleine Auswahl an Zielen ergab.
Auf das Wesentliche runtergebrochen: englischsprachig, einigermaßen entwickelt und sonnig. Das mag auf den ersten Blick oberflächlich klingen, spiegelte aber vor allem unsere postpandemischen Bedürfnisse wider. Ein Jahr lang drei Kinder unterschiedlichsten Alters 24/7 zu betreuen und dabei zu reisen ist schon ein Abenteuer an sich. Uns war klar, dass einige Länder ressourcenschonender für unsere Nerven sein würden als andere.
Außerdem sind wir eine wetterfühlige Familie, und die vielen Winter unter der grauen Hamburger Wolkendecke haben uns einiges abverlangt. Pauli sieht im Dunkeln nichts, und die Hälfte des Jahres nicht draußen sein zu können, weil es zu dunkel oder zu nass ist, wollten wir schlicht nicht mehr. Wir brauchten Wärme und Sonne.
Und dann gibt es eben Länder, die wir schon immer mal sehen wollten. Kanada zum Beispiel. Südamerika wiederum fiel raus, da mein Mann zur Hälfte Venezolaner ist und wir den Kontinent schon viel bereist haben. Für Asien interessierten wir uns weniger als für andere Kontinente, Afrika wollten wir lieber erkunden, wenn die Kids größer wären, und Sehnsuchtsorte wie Hawaii, Island oder Japan fielen aus budgettechnischen Gründen von der Liste. Generell legten wir den Fokus auf Übersee. Europa war uns für unseren Befreiungsschlag nicht weit genug weg.
Schlussendlich beschränkten wir uns auf Kanada, die USA, speziell Kalifornien, Neuseeland und Australien, vielleicht Mallorca. Aber so ganz wollten wir uns nicht festlegen, bevor die Reise überhaupt gestartet war. Mal gucken …
An einem kalten Abend im Februar des Planungsjahres sitzen wir bei schummrigem Licht in unserem denkmalgeschützten Mietshaus und recherchieren die Durchschnittsmenge jährlicher Sonnenstunden an den verschiedenen Orten. Obwohl wir uns den Tipp, nicht zu viel vorab zu planen, um Raum für Möglichkeiten zu lassen, sehr zu Herzen nehmen, müssen wir aufgrund von Visabestimmungen ein grobes Gerüst aufstellen und ein paar Buchungen vornehmen. Auf drei Monate Kanada sollen drei Monate USA folgen, und dann wollen wir weiter nach Neuseeland. Wir stellen fest, dass ein Flug von Los Angeles nach Auckland über Fidschi sogar günstiger ist, und entscheiden, Silvester dort zu verbringen.
Von draußen klatscht kalter Regen gegen die dunklen Fensterscheiben, eingerollt schnurren unsere Katzen neben uns, im Keller rumpelt die Wäsche in der Maschine, in der Küche liegen drei Brotdosen bereit, um am nächsten Morgen befüllt zu werden, und wir planen ein neues Leben, das in wenigen Monaten beginnen soll. Beginnen wird.
Ich muss an den Professor an der Uniklinik denken, der Pauli seit der Diagnose betreut und uns ins Herz geschlossen hat. Bei unserem letzten Termin habe ich ihm von unserem Vorhaben erzählt.
»Sie machen das genau richtig«, verkündete er, »packen Sie so viele Reize wie nur möglich in dieses Kind. Ballern Sie Pauli voll mit allem, was geht. Zu viel gibt es nicht, sie wird alles speichern und irgendwann darauf zurückgreifen müssen. Und dann wird sie es Ihnen danken und Sie sich selbst auch!«
Seine Worte schweben über allem. Sie rechtfertigen das Aufbrauchen der Ersparnisse in gleichem Maße wie Silvester auf Fidschi und Weihnachten in Disneyland. Wann, wenn nicht jetzt? Worauf warten? Welchen Wink soll uns das Universum noch geben, um zu begreifen, dass jetzt die Zeit ist, es anzugehen? Man stelle sich vor, man schiebe es auf. Ein Jahr oder zwei. Und es käme wieder etwas dazwischen, weil das Leben so ist. Es ist immer irgendwas.
Und in unserem Fall ist das Irgendwas irgendwann eine mögliche Erblindung. Man stelle sich vor, man hat diesen Gedanken, so eine Reise zu machen und dem Kind die Welt zu zeigen, und plötzlich ist es zu spät. Plötzlich kann man sie ihm zwar noch zeigen, aber es würde sie nicht mehr sehen. Es wäre mit Sicherheit auch eine unvergessliche gemeinsame Erfahrung, auf eine andere Art, aber das wollten wir nicht riskieren. Das könnte ich mir nicht verzeihen.
Was haben wir zu verlieren?
Juli 2022 – Hamburg
Vor einer Woche sind wir ausgezogen. Nachdem wir mit unseren Freunden eine letzte Gartenparty feierten und wir bei jeder Verabschiedung, um Tränen zu vermeiden, »Wir sehen uns bestimmt noch« statt »Leb wohl« sagten, kam George mit seinem Transporter.
Ge-or-ge. Nicht Dschortsch oder Geeeeorg. Ein freundlicher, muskulöser Rumäne, der gut roch und über unsere Massen an Besitztümern immer nur lachend und mit starkem Akzent sagte: »Kein Problem, kein Problem!« George und seine Schwester Sorina hatten uns bei all unseren bisherigen Umzügen geholfen. Von München nach Barcelona, von Barcelona in die erste Hamburger Wohnung, von dort in den Reihenhausneubau, von dort in die Altbauwohnung und von dort in die denkmalgeschützte Doppelhaushälfte aus dem letzten Jahrhundert. Und nun ins Lager.
Sorina, dünn wie ein Streichholz, das Gesicht bemalt wie für ein Date mit dem Bachelor, lange künstliche Wimpern und Fingernägel, schnallte sich wie jedes Mal einen breiten Ledergürtel um und trug, ohne einen Tropfen Schweiß zu verlieren, mit George unsere Miele-Waschmaschine aus dem Keller nach oben. Ich erwähne die Marke nur, weil George mich wiederholt hat wissen lassen, dass sich Geräte dieses Herstellers durch ein besonders hohes Gewicht auszeichnen.
Ich bewunderte die Schwester dafür. Ich hätte diese Waschmaschine allein nicht einen Zentimeter verschieben können und fragte mich, wo ein so kleiner Mensch so eine Kraft hernahm und ob ich das auch könnte, wenn ich nur lange genug dafür trainieren würde, um so stark zu werden. Was mich weiterbrachte zu der Frage, ob ich überhaupt mal irgendetwas so lange tun könnte, bis ich an den Punkt käme, an dem ich behaupten kann: »Das kann ich richtig gut.«
Nun sind wir mit unserem übrig gebliebenen Krempel bei meiner Mutter eingefallen und stürzen ihr Haus ins Chaos. Die Kinder wissen gar nicht mehr, wohin mit ihrer Aufregung. Pauli kuschelt pausenlos mit den Katzen, Freddie nutzt jede freie Minute, um sich mit seinen Freunden zu treffen, und Pablo hüpft stundenlang auf dem Trampolin, solange es eben noch geht. Da wir noch so viel zu tun haben, müssen wir sie bespaßungstechnisch immer wieder vertrösten und sagen in Dauerschleife: »Bald haben wir ganz viel Zeit für euch!« Im Minutentakt fragen uns alle drei, wann es denn endlich losgeht, und »Wie oft noch schlafen, bis wir fliegen?«.
Heute sind es noch drei Mal. Drei Nächte noch, bis wir Deutschland verlassen. Aber an Schlaf ist nicht zu denken. Ich liege mit offenen Augen im Bett, und vor lauter Gewühle habe ich der neben mir schlafenden Pauli mit dem Ellenbogen eins über den Kopf gezogen. Ich starre in die Dunkelheit. Es ist Nacht. Und nachts gelten andere Gesetze. Jahrelange mühsame Arbeit an Lebenseinstellung und Mindset zählen dann nicht. Es ist die Zeit für nachtschattenartige Gewächse aus Zweifeln und Ängsten, die sich unbemerkt in einer Windung des Gehirns versteckt haben, das nachts zu einem gut gedüngten Nährboden für Pessimismus und apokalyptische Visionen mutiert. Nach Sonnenuntergang, wenn alles still ist und der helle Mond hinter der Hamburger Wolkendecke festhängt, gedeihen sie. Und sie wachsen schnell. Sie nähren sich von Hoffnung und positiven Gefühlen, hüllen das Gehirn in Windeseile in ein unkontrollierbares Dickicht und vereinnahmen alle Gedanken.
Entwurzeln wir unsere Kinder? Tun wir ihnen mit der Reise etwas Gutes? Wir haben doch selbst überhaupt keinen Plan und ziehen unsere Kinder da mit rein. Wäre es nicht sinnvoller, sie hätten ein stabiles Zuhause und Eltern, die wissen, was sie wollen, und nicht erst dabei sind, das rauszufinden? Alle sagen die ganze Zeit, dass es für die Kinder so toll sein wird und dass sie das nie vergessen werden. Und was, wenn das nicht so ist? Wenn wir nur Chaos verursachen und sie uns irgendwann vorwerfen, dass wir ohne Sinn und Verstand ein neues Leben angefangen haben und keiner dabei glücklich geworden ist? Ist das alles nur ein rücksichtsloser Versuch, sich selbst zu verwirklichen?
Mein Hals wird eng, und mir steigen die Tränen in die Augen. Ich möchte vertrauen, aber gerade fällt es schwer. Das Gefühl von Schuld frisst sich tief in meinen Bauch und breitet sich aus. Ich will meine Kinder nicht traumatisieren.
Vor meinen Augen tauchen Bilder auf: Freddie, Pablo und Pauli, wie sie als Erwachsene beim Psychologen sitzen und sagen, »Damals, als unsere Egofucker-Eltern uns unser Zuhause genommen haben und wir nie wieder glücklich wurden«.
Kann das sein?
Natürlich werden sie beim Psychologen, Coach, Heiler oder einer anderen helfenden Person sitzen. Wie jeder erwachsene Mensch es in seinem Leben tun sollte, und bestenfalls nicht erst, wenn es so aussichtslos ist, dass er aus eigener Kraft nicht mehr aufstehen kann. Selbstverständlich wird es Traumata geben, die wir unseren Kindern zufügen, das lässt sich unglücklicherweise überhaupt nicht vermeiden.
Es kann die eine Situation sein, in der sie uns gebraucht hätten und wir es nicht gemerkt haben.
Es kann der eine Moment sein, in dem sie wahnsinnig enttäuscht über eine vollkommene Lappalie waren und wir es als einen der in der Trotzphase typischen Wutanfälle augenrollend abgetan haben.
Es kann das eine Gespräch unter Erwachsenen sein, das sie mitbekommen haben, ohne dass es in ihrem Kinderkopf vernünftig eingeordnet wurde.
Wir haben es nicht in der Hand. Was wir aber in der Hand haben, ist, unsere eigenen Ängste nicht auf die Kinder zu projizieren, jeden Moment mit ihnen bewusst zu erleben und alles, was uns an ihnen triggert, als Lehrstunde für die eigene Weiterentwicklung zu sehen.
Wir können sie begleiten, sie, indem wir sie so akzeptieren, wie sie sind, zu resilienten Menschen machen. Wir können für sie da sein, uns mit ihnen freuen, mit ihnen leiden und jedes Mal die Gewissheit haben: Wenn sie dabei geführt werden, können sie an dieser Situation wachsen und ihr Leben lang davon profitieren.
Und wir können der Zuversicht eine Chance geben und darauf hoffen, dass diese Reise einzigartige Impulse setzt und wundervolle Spuren hinterlässt.
Ich beruhige mich etwas und hole ein zweites Pestizid gegen gedankenvernebelndes Unkraut aus meinem Repertoire:
Die Frage ist ja immer wieder: Was, wenn? Was, wenn alles schrecklich wird? Ja, aber was, wenn alles wundervoll wird? Sehr selten wird es so grauenvoll, wie das Gehirn es in den dunkelsten Momenten heraufbeschwört. Und wenn doch, kann man daraus lernen.
Was haben wir denn schon zu verlieren, wenn wir diese Bubble verlassen? Ich wette, in einem Jahr wird sich hier nichts verändert haben. Die gleichen Stände auf dem Markt an der exakt gleichen Stelle wie schon die letzten fünfzehn Jahre, die gleichen Klassenfeste mit dem gleichen Kuchenbüfett, die gleichen Mails der Lehrerinnen und Lehrer, gefüllt mit Beschwerden, Aufträgen und Erinnerungen, die gleichen Brötchen zum Frühstück.
Bis auf dass die Kinder größer werden, fühlt es sich für uns an wie Stillstand. Wenn ich nicht gerade den Wocheneinkauf in den Einkaufswagen lege, vom Einkaufswagen auf das Band, vom Band zurück in den Einkaufswagen, vom Einkaufswagen ins Auto, vom Auto ins Haus und im Haus in die dafür vorgesehenen Schränke sortiere (was für ein Zeitfresser, wann wird da mal was erfunden?), sind zumindest wir nur damit beschäftigt, Feuer zu löschen und zu reagieren, nicht aber zu kreieren und zu gestalten.
Unser Leben ist so von äußeren Faktoren bestimmt, dass wir kaum Zeit haben, innezuhalten und uns zu fragen, ob das Sinn macht, was wir da tun. Morgens, nachdem die Kinder aus dem Haus sind (ich habe das Gefühl, die Tage im letzten Jahr, an denen alle drei in ihren jeweiligen Institutionen waren – Pauli im inklusiven Kindergarten, Pablo und Freddie in der Schule –, kann ich an einer Hand abzählen), sind schon sämtliche Nerven des Tages aufgebraucht. Bis das gröbste Chaos beseitigt ist und mein Puls sich beruhigt hat, ist der halbe Tag um, und es wird wieder Zeit, irgendwen abzuholen und irgendwo hinzubringen. Jahrelang habe ich in dieses labile Zeitfenster zusätzlich mein Medizinstudium gequetscht. Ich hoffte auf diese Weise, die Anforderungen zu erfüllen, die die Gesellschaft und mein Ego mir partnerschaftlich auferlegt hatten, neben dem Mutterdasein einen weiteren Nutzen für die Welt zu liefern, und habe uns noch ein hyperkomplexes Studentenleben zugemutet. Wenn ich die sich sträubenden Jungs von mir abgeschält und erfolgreich in der Kita abgegeben hatte, stieg ich ins Auto, wischte mir die Tränen aus den Augenwinkeln und ballerte mir mit Wandas »Amore« das schlechte Gewissen aus dem Hirn, um Platz für Lungenfunktionstests, Muskelfaseraufbau und den Citratzyklus zu machen. Viel zu lange.
Ich schaue meine schlafende Tochter an. Auch sie ist ein Grund für diese Reise. Das eine oder andere Mal, als die vielen kleinen, schwelenden Brände des Alltags, gegen die wir ständig mit löchrigen Schläuchen anzukämpfen versuchten, immer näher kamen und nicht aufhören wollten, uns mit ihrem Rauch die Sicht zu vernebeln, dachten wir, wir bräuchten eine handfeste Ausrede, um etwas anders zu machen. Wir nahmen unsere Tochter als Grund:
»Wir müssen ihr die Welt zeigen!«, höre ich mich unseren radikalen Schritt rechtfertigen und ernte dafür ein mildes Lächeln: »Sie wird fünf sein, was soll sie davon noch erinnern?« Ja, was wird sie erinnern, frage ich mich jetzt auch panisch im Bett.
Aber dankenswerterweise gesellt sich eine hoffnungsvolle Vorahnung dazu.
Sie wird von der intensiven Familienzeit ihr Leben lang zehren, sie wird über sich hinauswachsen und Fertigkeiten lernen, die niemand für möglich gehalten hatte. Sie wird überall auf der Welt kleine Freunde haben und Englisch lernen. Sie wird das Kribbeln der schnellsten Achterbahn Kaliforniens in ihrem Bauch erinnern, in Neuseeland lernen, wie sich die weichen Euter von Ziegen beim Melken anfühlen und wie die frische warme Milch schmeckt. Sie wird die eisige Kälte der Flüsse in Colorado spüren, mitten im Indischen Ozean von einem Boot ins Wasser springen und mit Rochen tauchen und auf einem Surfbrett im Pazifik ihre ersten Wellen bezwingen. Sie wird singend auf dem Fahrrad durch den Golden Gate Park in San Francisco fahren und in Sydney die riesige weiße Oper bestaunen. Sie wird den intensiven Geruch der kanadischen Wälder und frisch gefällter Bäume erinnern und das weiche Fell jedes einzelnen Tieres, das sie kuschelnd in ihr Herz schließt. Und nicht zuletzt wird sie in die Geschichten von über fünfzig Büchern eintauchen, die ich ihr im Laufe des Jahres vorlesen werde, einfach weil ich Zeit habe.
All das kann ich in diesem Moment nicht wissen, aber das Potenzial, dass es gut wird, ist groß und lässt mich vertrauen.
Bei Tageslicht ist alles besser und am Morgen der Abreise sowieso.
Der schlimmste mir bevorstehende Abschied, der von meiner Schwester, hat die ganze Kiste real werden lassen. Nach einem unbeschwerten Tag mit unseren Familien, in dessen Verlauf wir uns immer weniger in die Augen schauten, die Atmung flacher und die Seufzer tiefer wurden, gipfelte das Ganze in verzweifelten Umarmungen auf der Straße. Während sich unsere Männer um die verwirrten Kinder kümmerten, meine betreten im Auto, ihre solidarisch heulend an uns klebend, schluchzten wir uns gegenseitig Wünsche und Versprechungen in die Ohren.
Den Moment, als ich kurz vor dem Abbiegen aus ihrer Straße in den Rückspiegel schaute und sah, dass sie aufgehört hatte zu winken und ihr Gesicht in den Händen vergrub, dieses Bild werde ich nie vergessen.
Sie ist das Netz in meiner Zirkusmanege, das mich auffängt, wenn ich mal wieder zu hoch geklettert, zu waghalsig balanciert oder den dreifachen Rückwärtssalto mit doppelter Schraube doch nicht geschafft habe. If you fall, I’ll catch you.
Ich werde sie abartig vermissen.
Die letzten Tage verbringen wir rasend zwischen Arztterminen und Besorgungen. Das meiste davon wird sich als unnötiger Ballast entpuppen. Auf unserer Route stehen nur hoch entwickelte Länder; alles, was wir brauchen, können wir bekommen. In den letzten Stunden treffe ich letzte Entscheidungen und packe das Chaos in kleine Packwürfel, die ich anschließend in den Koffer puzzle. Obwohl wir der Sonne hinterherreisen, kann ich mich beim besten Willen nicht entscheiden, wie viele Pullover ich einpacke. Außerdem fühle ich mich in Funktionswäsche äußerst unwohl. Ein Jahr in praktischen Trekkingklamotten mit abnehmbaren Hosenbeinen zu verbringen ist, man muss es aus gepäckgewichtstechnischen Gründen leider sagen, keine Option für mich. Ein bisschen was Hübsches soll schon mit. Auf der anderen Seite werde ich in ein paar Wochen auf einer kanadischen Farm in der Erde wühlen, etwas, was dreckig werden kann, muss auch mit. Und Schuhe? Was für Schuhe?
Als alles final in den fünf Koffern und diversen Handgepäckstücken verstaut ist (klar zu viel, in diesem Punkt sind wir ein Negativbeispiel) und die Katzen und weitere lieb gewonnene Lebewesen verabschiedet sind, stehen wir am Hamburger Flughafen.
Andere Menschen checken für zwei Wochen Sommerurlaub ein, wir nicht. Wir bleiben länger weg.
Unser Familienabenteuer beginnt genau jetzt.
Fast ein Jahr Planung, unendlich viele Entscheidungen, Recherche, Vorfreude, Zweifel, Fragen, Antworten und haufenweise Orga liegen hinter uns.
Wir haben unser Haus gekündigt, unser komplettes Hab und Gut verschenkt, verliehen, eingelagert oder weggeschmissen. Oli hat Elternzeit, ich habe keine Anstellung, die Kinder sind von der Schule befreit, nichts hält uns mehr hier. Wir sind frei.
Nachdem wir das Gepäck abgegeben und die Sicherheitskontrolle hinter uns gelassen haben, realisiere ich das, und all die Anspannung fällt ab. Endlich. Tränen der Erleichterung und der puren Freude rollen über mein Gesicht. Oli und ich umarmen uns lange und fassen nicht, dass es wirklich passiert. Wir haben es geschafft. Wir haben ermöglicht, was unmöglich schien. Wir erfüllen uns einen Traum.
Ich ahne, dass diese Reise mich verändern wird. Dass es nicht nur eine Reise um die Welt, sondern zu mir selbst wird und dass ich ein anderer Mensch sein werde, wenn ich wiederkomme.
Erst mal Ferien
Juli 2022 – Vancouver, Kanada
Kanada empfängt uns mit strahlend blauem Himmel. Mit dem Landeanflug zwischen der riesigen Bergkette und dem weiten Meer beginnt etwas Neues, für uns noch nie Dagewesenes. Wir haben Deutschland hinter uns gelassen, und sobald ich kanadischen Boden unter den Füßen habe, spüre ich schon jetzt, wie weit das alles weg ist. Vor uns liegt ein Jahr nur für uns. Mein Blick ist ausschließlich in die Zukunft gerichtet. Ein magisches Gefühl, das ungeahnte Energien freisetzt, macht sich breit, und mein Herz hüpft.
Um zu akklimatisieren, verbringen wir die erste Woche in einem kleinen Airbnb, das in echt noch viel kleiner als auf den Fotos ist. Das Gepäck muss in den Fluren stehen, sodass jeder Weg zu einer Kletterpartie wird. Die erste Challenge für Pauli, die sich ab jetzt ständig in unbekannten Umgebungen orientieren muss. Die School of Life beginnt für sie. Ein paarmal die falsche Tür, ein paarmal über einen Koffer stolpern, und schon hat sie ein Bild von dem Apartment und orientiert sich ohne Unterstützung.
Wir sind in einem familienfreundlichen Viertel gelandet. Nichts Hippes, kein aufstrebender Stadtteil, trotzdem unfassbar teuer. Jetlagbedingt sind die Kinder seit drei Uhr nachts hellwach, und so können wir unseren ersten Einkauf pünktlich zur Ladenöffnung um sieben Uhr morgens erledigen. Freddie, Pablo und Pauli wollen alles in den Wagen packen, was sie nicht kennen, jede Süßigkeit probieren, und die Jungs stehen mit großen Augen vor dem riesigen Chipsregal. Oli und ich wiederum müssen an der Kasse schlucken: Obwohl wir uns nur auf die Basics beschränkt haben, liegt die Summe, die auf dem Display aufleuchtet, in Sphären, die wir von einem gewöhnlichen Wocheneinkauf in Deutschland nicht gewohnt sind. Es ist der Beginn einer Anpassung unseres Budgets für die kommenden Monate. Der Dollar steht postpandemisch schlecht für uns, und nicht nur in Kanada, auch in den USA, in Neuseeland und Australien werden die Lebensmittel den Löwenanteil unserer Ausgaben bilden.
Um unsere Reisekasse nicht zu sehr zu überlasten, planen wir einen Mix aus unterschiedlichen Unterkünften. In Kanada werden wir nach der Woche in Vancouver vier Wochen mit einem Camper unterwegs sein. Danach ist ein Farmaufenthalt geplant, bei dem wir für Unterkunft und Essen arbeiten, und hinterher ein Haus- und Petsit. Auch wenn wir Raum für Spontanität lassen wollten, haben wir zumindest die ersten drei Stationen vorab geplant, um uns in der Anfangszeit nicht mit zu viel Recherche aufzuhalten.
Das erste Learning, das ich mir notiere: Wenn kein Auto zur Verfügung steht, bei der Buchung von Unterkünften immer darauf achten, dass ein Supermarkt in der Nähe ist. Man schleppt sich sonst einen Wolf. Gott sei Dank haben wir aus Deutschland einen faltbaren Bollerwagen mitgebracht, der uns viele, viele Male retten wird.
Die Woche in Vancouver fühlt sich an wie Urlaub. Wir verbringen sie damit, die Stadt zu erkunden. Noch sind ja Sommerferien, und diese reine Urlaubszeit wollen wir uns gönnen. Wir spüren noch deutlich das lange und anstrengende Schuljahr und die Auflösung des alten Lebens in den Knochen und sind trotzdem voller Neugier und Tatendrang. Die Kinder sind begeistert von der fremden Stadt und fahren mit ihren mitgebrachten Scootern weite Strecken, die wir Eltern zu Fuß zurücklegen.
An einem Tag wollen wir den Bus Richtung Strand nehmen und kommen etwa einen halben Kilometer vor der Haltestelle an einem stehenden Bus vorbei.
»Is this the Bus to Kitsilano Beach?«, fragen wir den Fahrer, der ein Sandwich in der Hand und eine Zeitung auf dem Lenkrad liegen hat und offensichtlich Mittagspause macht.