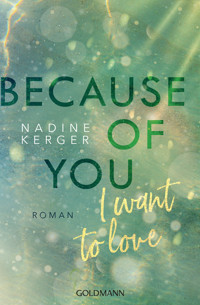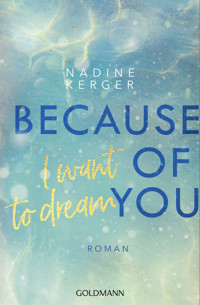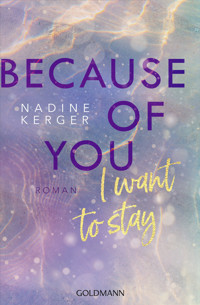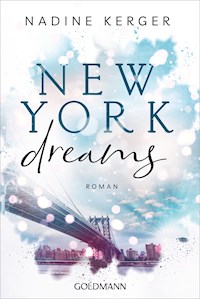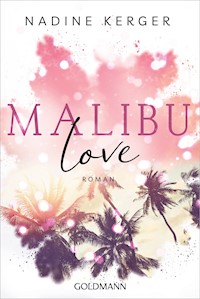
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Be Mine-Reihe
- Sprache: Deutsch
Isy ist glücklich. In L.A. startet sie ihre Anwaltskarriere, und mit Emma und Nick hat sie dort die besten Freunde, die man sich wünschen kann. Doch dann begegnet sie auf einer Party dem Mann, der ihr vor Jahren das Herz gebrochen hat – Hotelerbe Lucas Mortimer. Um sich abzulenken, lässt sie sich ausgerechnet mit Nicks bestem Freund ein, Bad Boy Connor Knightley. Als am nächsten Tag Fotos der beiden in der Presse auftauchen, schlägt der Surf-Star Isy einen Deal vor: Sie spielen für ein paar Monate ein Paar, denn Connor muss sein wegen Frauengeschichten angeschlagenes Image aufbessern. Es gibt nur eine Regel: Echte Gefühle dürfen nicht ins Spiel kommen ...
Spice-Level: 2 von 5
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Isy ist glücklich. Zurück in ihrer Heimatstadt L. A. will sie ihre Anwaltskarriere vorantreiben, und mit Emma und Nick hat sie dort die besten Freunde, die man sich wünschen kann. Die beiden wollen heiraten, und das ist gut so. Isy wusste ja von Anfang an, dass sie zusammengehören. Sie selbst gehört niemandem, und auch das ist gut so. Isy ist Realistin – die große Liebe gibt es nur im Film. Doch dann begegnet sie auf einer Party dem Mann, der ihr zum ersten und einzigen Mal im Leben das Herz gebrochen hat: Hotelerbe Lucas Mortimer. Um ihm etwas zu beweisen, lässt sie sich ausgerechnet mit dem Trauzeugen von Nick ein – Surfprofi, Frauenschwarm und Bad Boy Connor Knightley. Ihre wilde Knutscherei wird prompt von der Klatschpresse abgelichtet, und als die Fotos am nächsten Tag überall online zu finden sind, schlägt der Surf-Star Isy einen Deal vor. Sie spielen für ein paar Monate ein Paar, denn Connor muss sein angeschlagenes Image aufbessern. Im Gegenzug willigt er ein, Isy auf die Geburtstagsfeier von Lucas zu begleiten. Der Deal hat nur eine Regel: Echte Gefühle dürfen nicht ins Spiel kommen …
Weitere Informationen zu Nadine Kerger sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Nadine Kerger
Malibu Love
Roman
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Originalausgabe August 2022
Copyright © 2022 by Nadine Kerger
Copyright © dieser Ausgabe 2022
by Wilhelm Goldmann Verlag, ein Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Redaktion: Beate DeSalve
MR · Herstellung: ik
Satz: Mediengestaltung Vornehm GmbH, München
ISBN: 978-3-641-27605-8V001
www.goldmann-verlag.de
Für Mama und Papa.Weil ihr immer für mich da seid.
1.
Die Sonne stand schon tief und tauchte die Hügel von Malibu links und rechts der Straße in ein wunderschönes orangerotes Licht. Der Himmel über mir war von Wolkenschleiern durchzogen und wirkte fast pink. Ich musste mich zwingen, mich auf den kurvenreichen, einspurigen Highway zu konzentrieren, der sich von Thousand Oaks nach Western Malibu hinabschlängelte, und nicht die ganze Zeit nach dem Meer Ausschau zu halten, das immer wieder hinter den Hügelkuppen hervorblitzte. Ich war diese Straße eine halbe Ewigkeit nicht gefahren, konnte mich aber noch genau an die Kurve erinnern, hinter der das Meer ins Blickfeld geriet und dann bis zum Pacific Coast Highway nicht mehr verschwand. Und richtig: eine langgezogene Linkskurve, dann rechts, zwischen mehreren windschiefen Zypressen hindurch, und plötzlich tat sich der Pazifik vor mir auf, unendlich, tiefblau und glitzernd in der Abendsonne.
Der Anblick löste ein freudiges Kribbeln in mir aus, und ich drehte die Musik lauter. Der warme Fahrtwind, der durch die offenen Fenster hereinströmte, zerzauste mir die Haare, während ich den neuesten Song von Coldplay mitsang, der gerade im Radio gespielt wurde.
Von der Abzweigung auf den Highway 1, der von L. A. bis nach Nordkalifornien immer an der Küste entlangführte, war es nur noch eine Meile bis zum El Matador State Beach, wo ich an diesem Abend mit meinen besten Freunden Emma und Nick verabredet war. Auf dem kleinen Parkplatz oberhalb des Strandes fand ich, mit etwas Glück, schnell eine Parklücke für den klapperigen Mazda, den ich mir von meiner Mom geliehen hatte. Schnell zog ich die Chucks aus, mit denen ich gefahren war, und nahm meine nicht wirklich strandtauglichen 14-Zentimeter-Stilettos in die Hand, um barfuß zu der Holztreppe zu laufen, die zum Strand hinunterführte. Auf der obersten Stufe blieb ich einen Moment stehen, den Blick auf das Meer und die untergehende Sonne gerichtet, eine Hand auf dem verwitterten Holzgeländer. Es war nichts zu hören als das Rauschen des anbrandenden Ozeans und das Kreischen der Möwen, die über mir ihre Kreise zogen.
»Willkommen zu Hause, Isy«, murmelte ich und atmete die frische, salzige Meeresluft ein.
Ich spürte, wie sich mein Herz zusammenzog, und es dauerte einen Moment, bis mir klar wurde, was es war. Ich hatte all das in New York vermisst: den Strand, das Meer, die Sonne, die Palmen, die Farben, die Geräusche, die Gerüche. Offenbar, ohne dass ich es selbst gemerkt hatte. Vielleicht war ich einfach zu beschäftigt gewesen? Studieren, lernen, arbeiten, Leute kennenlernen, Partys … Die Stadt New York zog einen in ihren Bann und ließ einen nicht mehr los.
Aber jetzt spürte ich es ganz genau, das warme Glücksgefühl, das mich durchströmte. Es war schön, wieder in Kalifornien zu sein. Nach drei Jahren Studium an der NYU war ich zurück. Und ich würde meine beste Freundin Emma wiedersehen, nach viel zu langer Zeit.
Plötzlich konnte ich es nicht mehr abwarten und lief, so schnell ich konnte, die Stufen hinunter. Unten angekommen streckte ich meine nackten Füße in den warmen Sand und seufzte wohlig. Zu meiner Linken lag Malibu mit seinen – wie an einer Perlenkette aufgereihten – weißen Strandhäusern, und zu meiner Rechten war nichts als Sand und schroffe rote Felsen, überwuchert von blassblauem Kalifornischen Salbei und violetten Astern.
»Isy! Isy!« Emmas begeisterter Ruf riss mich aus meinen Gedanken. »Da bist du ja endlich!«
Einige der Spaziergänger und späten Strandbesucher drehten überrascht ihre Köpfe, und ich musste lachen. Wie schön, dass jetzt alle Anwesenden wussten, dass ich da war. Wahrscheinlich hatte man Emma bis Santa Barbara gehört. Auch übersehen konnte man sie nicht, denn sie stand etwa fünfzig Meter von mir entfernt mit den Füßen im Wasser und fuchtelte mit den Armen wie ein wild gewordener Fluglotse. Neben ihr stand ihr Freund Nick, der ebenfalls grinste und winkte.
Emma und ich rannten gleichzeitig los. Als wir beieinander angekommen waren, schlang sie die Arme so fest um mich, dass ich befürchtete, keine Luft mehr zu bekommen.
»Emma, du verrücktes Huhn!«, japste ich. »Du zerquetschst mich!«
»Ich bin so froh, dass du endlich da bist«, murmelte sie in meine Haare, ohne ihre Umarmung auch nur ein bisschen zu lockern. »Ich habe dich so schrecklich vermisst.«
»Ich dich auch, Em«, sagte ich, und ein warmes Gefühl breitete sich in meinem Bauch aus.
Emma war meine beste Freundin, seit wir uns in New York kennengelernt und zusammen in einer WG gewohnt hatten. Sie war Deutsche und hatte eigentlich nur ein Studienjahr an der NYU verbringen wollen, um dann in Frankfurt die Kanzlei ihres Vaters zu übernehmen. Doch am Ende war alles anders gekommen. Nick und Emma hatten sich verliebt, und sie war ihm nach ihrem Abschluss nach Malibu gefolgt, wo er einen Job angenommen hatte. Um ganz ehrlich zu sein: Ohne Nick und Emma war das Leben in New York nicht mehr dasselbe gewesen.
»Emma und Isy endlich wieder vereint«, sagte Nick schmunzelnd, als er bei uns angekommen war. »Gott sei Dank. Ich habe keine Ahnung, wie sich die Erde weiterdrehen konnte, während ihr in verschiedenen Städten an anderen Enden des Kontinents gelebt habt.«
Emma und ich grinsten uns an, doch kaum hatten wir uns voneinander gelöst, zog auch Nick mich in seine Arme und drückte mich nicht weniger fest als Emma zuvor.
»Ein Glück, dass du endlich da bist. Emma war so ungeduldig, dass es kaum auszuhalten war. Sie hat wortwörtlich die Stunden gezählt.« Er hielt mich auf Armeslänge von sich und grinste ebenfalls. »Na ja. Vielleicht habe ich dich auch ein klitzekleines bisschen vermisst. Wie war dein Flug?«
»Anstrengend«, sagte ich. »Neben einem schreienden Kleinkind und seinen streitenden Eltern.«
»Oh nein, wie grässlich«, sagte Emma mitfühlend. »Der absolute Albtraum auf einem Sechseinhalb-Stunden-Flug.«
»Es war okay«, erwiderte ich und hakte mich bei Emma unter. »Irgendwann hatte ich genug von dem Gezeter und habe den kleinen Schreihals auf meinen Schoß genommen. Nach einer halben Stunde Fingerspiele und ›Hoppe, hoppe, Reiter‹ ist er auf meinem Arm eingeschlafen. Genauso wie die erschöpften Eltern neben mir. Und dann war Ruhe. Keine Schreierei und kein Gestreite.«
Emma lachte auf. »Ach Isy. Du bist einfach zu gut für diese Welt …« Sie ließ ihren Blick einmal an mir hoch- und runterwandern. »Und von deiner Gutherzigkeit mal abgesehen: Du siehst absolut heiß aus. Sag mir bitte, dass du nicht in diesem Outfit von New York hierher geflogen bist. Die Sauerstoffmasken müssen aus der Kabinendecke gefallen sein, als du eingestiegen bist.«
Ich trug ein schwarzes, weit geschnittenes Off-Shoulder-Minikleid, dessen Stoff meinen linken Arm ganz bedeckte, den rechten aber gar nicht. Zugegebenermaßen endete es irgendwo kurz unter dem Po. Ich hatte es für ein Drittel des Originalpreises beim Sample-Sale in New York ergattert.
»Wahrscheinlich sind nicht nur die Sauerstoffmasken aus der Decke gefallen, sondern auch allen anwesenden Männern die Augen aus dem Kopf«, kommentierte Nick lachend und zupfte spielerisch an meinem Ärmel.
Ich schlug seine Hand weg. »So skandalös ist mein Outfit nun auch wieder nicht. Und um euch zu beruhigen: Ich bin vom Flughafen schnell noch zu meiner Mom gefahren, habe meine Koffer abgestellt und mich umgezogen. Und nachdem wir die Outfit-Frage hoffentlich geklärt haben, will ich endlich wissen, wo nun die Party des Jahrhunderts steigt, auf die ihr mich an meinem ersten Abend in L. A. unbedingt schleifen wolltet?«
Emma klatschte aufgeregt in die Hände und zeigte dann in Richtung der Klippen. Ich drehte mich um, und mein Blick folgte ihrem ausgestreckten Finger zu einer zweistöckigen Villa, die etwas zurückgesetzt zwischen den Felsen lag. Eine eigene, private Holztreppe führte nach oben und endete auf der Terrasse mit Glasbrüstung, in der sich die untergehende Sonne spiegelte. Ich konnte erkennen, dass das Haus von einem üppigen Garten und mehreren hohen kalifornischen Palmen umgeben war, deren Blätter sich sacht im Wind bewegten. Leise Lounge-Musik drang zu uns herunter, genauso wie das Gelächter der Gäste, die sich bereits auf der Terrasse tummelten und sich unterhielten.
»Beeindruckend«, sagte ich anerkennend. »Ich wusste ja, dass ihr schicke Nachbarn habt. Aber dass die euch auch auf ihre Partys einladen …«
Das Haus der beiden lag einige Hundert Meter den Strand hinunter, Richtung Central Malibu. Es war zwar klein und nicht zu vergleichen mit einigen der Luxusvillen, die sich zwischen Meer und Pacific Coast Highway aneinanderreihten. Doch das machte nichts, denn wer brauchte schon einen Palast, wenn man den Strand und das Meer nur ein paar Schritte entfernt vor dem Wohnzimmerfenster hatte?
»Das Geburtstagskind ist mein bester Freund. Wir kennen uns noch von der UCLA«, erklärte Nick. »Wir hatten zwischenzeitlich weniger Kontakt, weil die Entfernung so groß war, aber seit ich wieder in Kalifornien bin, sehen wir uns fast öfter als früher. Ich stelle euch später vor.«
»Darauf bestehe ich«, sagte ich und fügte hinzu: »Vor allem, wenn er heiß ist.«
Erwartungsvoll sah ich Emma an, die mir hinter Nicks Rücken ein begeistertes Daumen-hoch-Zeichen gab und dann schnell versuchte, ein unbeteiligtes Gesicht zu machen, als Nick sich umdrehte und sie stirnrunzelnd ansah.
Ich grinste, hakte mich auch bei Nick unter und zog beide in Richtung der Holztreppe, die vom Strand zur Villa hinaufführte. »Dann stürzen wir uns ins Getümmel! Ich kann’s gar nicht erwarten, auf unser Wiedersehen anzustoßen.«
Nachdem wir unsere Namen genannt hatten, ließen uns die Security-Männer, die den Treppenaufgang bewachten, durch, und wir erklommen gemeinsam die lange Holztreppe. Oben angekommen, schlüpfte ich in meine Stilettos und frischte meinen knallroten Lipgloss auf. Dann ließ ich meinen Blick einmal über die gut gelaunte Gästeschar schweifen, die in Grüppchen um den großen Swimmingpool stand, der den Großteil der Terrasse einnahm. Die Beleuchtung war eingeschaltet, und das Wasser schimmerte einladend türkisblau. Das Styling der Gäste unterschied sich extrem von dem, was ich aus New York gewöhnt war. Dort hatte ein cooles Outfit vor allem zwei Kriterien zu erfüllen: Erstens musste es schlicht und zweitens schwarz sein, idealerweise kombiniert mit extrem hohen High Heels und teuren Accessoires. Hier war das völlig anders. Die Kleider der Gäste waren viel lässiger, wenn auch nicht weniger sexy. Die bunten Röckchen mancher Frauen endeten direkt unter dem Po und erlaubten den Blick auf zumeist braun gebrannte Beine, aber auch einige lange Spaghettiträger-Kleider und Lederflipflops waren dabei. Verschiedene Muster, Materialien und Stilrichtungen wurden wild miteinander kombiniert. Das war der typische California-Style.
Ich strich mit einer Hand über mein schwarzes Kleid. In der kommenden Woche musste ich dringend shoppen gehen. Vielleicht würde Emma mitkommen, denn in Central Malibu gab es einige Vintage-Läden, in denen ich sicher auch etwas finden würde, was meinen derzeit eher mageren Geldbeutel nicht überstrapazierte.
»O Gott, ich hasse es, auf eine Party mit so vielen fremden Menschen zu kommen«, murmelte Emma neben mir und ergriff Nicks Hand.
Ich lächelte ihr aufmunternd zu. »Halte dich einfach an Nick und mich, Em. Nick kennt wahrscheinlich die Hälfte aller Leute hier, und ich gehe seit zwanzig Jahren alleine auf Partys. Kontaktfreudig ist quasi mein zweiter Vorname.«
Emma musste lachen. »Seit zwanzig Jahren? Du bist doch nicht schon als Kleinkind auf Partys gegangen.«
»Hey«, erwiderte ich gespielt empört. »Du hast ja keine Ahnung! Ich habe schon mit drei Jahren beim Geburtstag von Onkel Bob auf der Bar gestanden und Celine Dion gesungen! Und dazu getanzt. Ich war der Star des Abends.« Ich wackelte mit den Augenbrauen. »Wenn ich nicht Jura studiert hätte, wäre ich auf die Musicalschule gegangen, und ihr könntet mich heute am Broadway bewundern. Oder in Las Vegas.«
»Das kann ich mir sehr lebhaft vorstellen, Isy Kontaktfreudig Summers«, sagte Nick lachend. »Hey, da drüben ist Nate Fielder. Kennst du ihn schon, Emma? Er wohnt drei Häuser weiter.«
Weil ich nicht sonderlich erpicht auf Smalltalk mit Nicks Nachbarn und außerdem ziemlich durstig war, sagte ich schnell: »Wollt ihr ihm Hallo sagen, und ich gehe in der Zeit ein bisschen herum? Wir können uns ja gleich wieder treffen und dann anstoßen.«
Ich drückte Emma noch ein schnelles Küsschen auf die Wange – einfach weil ich mich so sehr freute, sie endlich wiederzuhaben – und schlenderte in Richtung der Bar, die direkt neben einer Treppe lag, die auf eine zweite, höher gelegene Terrasse führte.
Kaum war ich ein paar Schritte gegangen, hörte ich Emma hinter mir meinen Namen rufen. Ich drehte mich um.
»Bitte nicht auf die Bar steigen und Celine Dion singen, okay?«, flüsterte sie gerade so laut, dass ich sie verstehen konnte.
»Und wenn, dann nur, wenn wir dabei sind, um es zu sehen!«, fügte Nick, um einiges lauter als Emma, hinzu. »Und zu filmen.«
Ich lachte und warf ihnen kopfschüttelnd einen Luftkuss zu, bevor ich zur Bar hinüberlief. Die Cocktailkarte hörte sich verlockend an, aber ich begnügte mich erst einmal mit einem Ginger-Ale. Mit dem Glas in der Hand ging ich neugierig die Treppe zum ersten Stock der Villa hinauf.
Das Haus war ein absoluter Traum, schlicht gehalten, mit Flachdach und großen Glastüren, vor denen sich die Vorhänge im lauen Abendwind bauschten und die den Blick in das warm beleuchtete Wohnzimmer mit offener Küche freigaben. Auch auf der oberen Terrasse reichten die großen Glasfenster bis zum Boden, aber die Vorhänge waren zugezogen – wahrscheinlich, weil sich hier die Schlafzimmer befanden. Auf der Terrasse standen mehrere Liegen mit dicken weißen Auflagen. Darauf verstreut lagen einige Kissen, die dazu einluden, es sich bequem zu machen. Am Geländer waren Windlichter aufgereiht, in denen Kerzen flackerten und die alles in ein warmes Licht tauchten.
Hier oben war es etwas weniger voll. Nur ein paar Gäste standen in Grüppchen zusammen, lachten und unterhielten sich.
Während ich mich nach einer Sitzgelegenheit umsah, blieb mein Blick an einem gut aussehenden Mann am Rand der Terrasse hängen. Halb saß, halb lag er auf einer der Liegen, ganz allein, die Beine weit ausgestreckt. Er war groß und sportlich und hatte seine muskulösen Arme vor der Brust verschränkt. Der linke Arm war vom Handgelenk oberhalb seiner Uhr aufwärts mit einem aufwendigen dunklen Tribal-Muster tätowiert, das kaum Haut freiließ. Bis wohin das Tattoo ging, konnte ich nur erahnen, denn es verschwand am Oberarm unter dem weißen T-Shirt, das er trug. Seine langen braunen Haare waren auf dem Hinterkopf zu einem sexy Man-Bun zusammengebunden.
Ziemlich heißer Typ, schoss es mir durch den Kopf. Und die Liege neben ihm war frei …
Als hätte er meine Gedanken gelesen, blickte er in diesem Moment in meine Richtung. Vielleicht hatte er gespürt, dass ich ihn so intensiv gemustert hatte.
Kurz entschlossen lief ich die paar Schritte zu ihm hinüber und deutete auf die Liege neben seiner. »Hi! Ist hier noch frei?«
Ich war mir nicht ganz sicher, aber ich meinte, einen Hauch von Widerwillen zu spüren. Doch vielleicht bildete ich mir das auch nur ein, denn er atmete einmal tief durch und nickte dann.
Ich setzte mich und zupfte mein Kleid zurecht. Meine Beine waren noch ziemlich weiß, aber das war ja auch kein Wunder, wenn man mehrere Jahre in New York gelebt hatte. Doch jetzt war ich zurück in Kalifornien, und mein Teint würde bald sehr viel dunkler werden, so wie früher. Ich war zwar blond, aber im Sommer wurde ich richtig braun und bekam massenhaft Sommersprossen auf Wangen und Nase. Meine große Schwester Kathy behauptete, dass ich mit meinen blauen Augen, den blonden Haaren und dem kurvigen Körper aussehen würde wie Hilary Duff, und mit dem Vergleich konnte ich mehr als gut leben, auch wenn Hilary Duff etwas älter war als ich.
Über mir bewegten sich die Palmenwedel sanft im Wind und erzeugten ein beruhigendes Geräusch, das sich mit dem Rauschen des Ozeans und der leisen Musik aus den Boxen vermischte.
Unwillkürlich seufzte ich. »Schön, oder?«
»Hm?«, machte mein Liegestuhlnachbar, und obwohl es nur ein Laut war, konnte ich seine Irritation heraushören.
Ich machte eine ausladende Handbewegung, die alles um uns herum einschloss, auch den Strand und das Meer, das im Licht der untergehenden Sonne glitzerte. Ich hätte Stunden damit verbringen können zuzusehen, wie die Wellen heranrollten und sich aufbauten, bis sie ihren höchsten Punkt erreicht hatten, und dann in sich zusammenbrachen.
»Es ist schön hier, oder nicht?«, wiederholte ich und schaute ihn von der Seite an.
Aus der Nähe sah er noch besser aus. Er hatte hohe Wangenknochen und ein markantes Kinn, das – ebenso wie seine Wangen – von dem Schatten eines Dreitagebarts bedeckt war. Über seine Unterlippe zog sich eine feine weiße Narbe bis zum Kinn, die nur zu sehen war, weil an dieser Stelle kein Bart wuchs. Und er hatte einen schönen Mund.
Ich hatte eine Schwäche für Männer mit schönen Lippen. Okay, zugegeben – wer hatte das nicht?
»Ich bin übrigens Isy.«
Er zögerte einen winzigen Moment, dann sagte er: »Connor.«
Hm. Sonderlich gesprächig schien er ja nicht zu sein.
Ein Kellner kam mit einem Tablett voller Canapés vorbei. Als mein Magen hörbar knurrte, wurde mir bewusst, dass ich außer einem labberigen Airline-Sandwich und einer Mini-Tüte Chips im Flugzeug heute noch nichts gegessen hatte. Ich schaffte es, einen Garnelensalat im Gläschen sowie ein Bresaola-Avocado-Sandwich zu ergattern, und biss hungrig hinein. Dann trank ich einen Schluck von meinem Ginger-Ale. Ich konnte förmlich spüren, wie mein Blutzuckerspiegel langsam wieder anstieg.
»Kommst du von hier?«, machte ich einen weiteren Versuch, mit Connor ins Gespräch zu kommen.
Er schwenkte sein Glas, sodass die Eiswürfel in der klaren Flüssigkeit klirrten. Auf der Innenseite seines rechten Oberarmes war ein schwarzer Schriftzug zu erkennen, der allerdings nicht groß genug war, als dass ich ihn hätte entziffern können.
»Ja?«, antwortete er, die Augenbrauen so weit hochgezogen, dass sie fast seinen Haaransatz berührten.
Er formulierte es weniger als Antwort und mehr als Frage im Sinne von: Ist das nicht offensichtlich?
Puh, der war aber auch eine harte Nuss. Ob er immer so übel gelaunt war? Oder hatte er vielleicht nur einen schlechten Tag und musste etwas aufgemuntert werden?
»Hast du hier studiert?«, fragte ich freundlich, und als er nicht sofort antwortete, fuhr ich fort: »Ich bin in L. A. geboren und zur Schule gegangen, habe dann aber an der NYU studiert. Ich bin heute erst nach Kalifornien zurückgekommen, um Ende des Sommers meine Zulassungsprüfung zur Anwältin hier zu machen.«
Keinerlei Reaktion.
Ich spürte, wie mein Lächeln etwas verrutschte, da sagte er unvermittelt: »Darf ich ehrlich sein?«
»Wie bitte?«, fragte ich verdattert. Was für eine merkwürdige Frage, wenn man bedachte, dass wir uns keine zehn Minuten kannten und kaum ein paar Worte miteinander gewechselt hatten. »Ja, natürlich.«
Jetzt wandte er sich mir mit dem ganzen Körper zu und blickte mir das erste Mal an diesem Abend direkt in die Augen. Sie wirkten in dem dämmerigen Licht dunkel, fast schwarz. Ich schluckte.
»Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du all deinen Mut zusammengenommen und mich angesprochen hast. Aber die Sache ist die: Ich habe kein Interesse. Ich werde jeden Tag von zehn Frauen angesprochen, die mich kennenlernen und mit mir ins Bett wollen. Und so aufregend das am Anfang vielleicht gewesen sein mag, inzwischen langweilt mich diese Art von Oberflächlichkeit.«
Es dauerte einen Moment, bis seine Worte einsickerten. Dann machte sich eine Mischung aus Scham und Fassungslosigkeit in mir breit. Ich fühlte mich, als hätte er einen Eimer kaltes Wasser über meinem Kopf ausgeschüttet. Unglaublich! Was für ein arroganter Schnösel!
»Entschuldigung«, erwiderte ich kühl. »Aber nicht jeder Mensch, der mit dir redet, will gleich mit dir ins Bett.«
Ich versuchte dabei, die gemeine kleine Stimme in meinem Kopf zu ignorieren, die mir ins Ohr flüsterte, wie anziehend er auf mich gewirkt hatte und dass vielleicht auch etwas hätte laufen können, wenn er sich anders verhalten hätte. Aber jetzt natürlich nicht mehr, da half auch all sein gutes Aussehen nicht. Um bei mir zu landen, musste ein Typ schon ein bisschen mehr zu bieten haben.
Ich stellte das leere Glas etwas zu heftig auf dem Beistelltisch ab und stand auf. Das Gespräch war so was von beendet. Ohne abzuwarten, ob er noch etwas zu sagen hatte, schnappte ich mir meine Clutch und wandte mich zum Gehen, um Emma und Nick zu suchen. Den Rest des Abends würde ich in netterer Gesellschaft verbringen. Ich spürte, wie sich Connors Blicke in meinen Rücken bohrten, drehte mich aber nicht noch einmal zu ihm um.
Als ich die Treppe zur Poolterrasse erreicht hatte, entdeckte ich Emma und Nick, die in dem großzügigen Garten am Ende der Rasenfläche auf einer Bank saßen und aufs Meer blickten, wo gerade die Sonne wie ein roter Feuerball im Meer versank. Einen Moment blieb ich stehen und beobachtete die beiden. Er hatte seinen Arm um ihre Schultern gelegt, und sie schmiegte sich an ihn, eine Hand auf seiner Brust. Es war schön zu sehen, dass sie immer noch genauso verliebt waren wie in New York.
Ich wollte gerade zu ihnen hinunterlaufen, da löste Nick sich von Emma und sank vor ihr auf ein Knie. Mir stockte der Atem, als er ein Schächtelchen aus seiner Hosentasche holte und es öffnete. Zwar konnte ich auf die Entfernung nicht sehen, was es war, und auch nicht hören, was sie sagten, aber das musste ich auch nicht, denn Emma fiel ebenfalls auf die Knie und umarmte Nick stürmisch. Tränen stiegen mir in die Augen, und ich presste beide Hände vor den Mund, um nicht vor Begeisterung laut loszukreischen.
Ich war so in meine Betrachtung versunken, dass ich zusammenzuckte, als eine Stimme hinter mir sagte: »Sieht ganz so aus, als hätten wir jetzt mehr zu feiern als meinen Geburtstag.«
Ich drehte mich um. Connor stand vor mir und nickte mit dem Kinn in Richtung Garten, wo Emma und Nick sich küssten. Ungläubig starrte ich ihn an. Seinen Geburtstag …? Das hieß, er war der Gastgeber? Nicks Freund? Connor war Nicks bester Freund?
Bevor ich weiter darüber nachdenken konnte, begannen die Gäste auf der Terrasse zu klatschen und zu jubeln. Es schien auch den anderen nicht verborgen geblieben zu sein, dass sich gerade jemand verlobt hatte. Nick winkte strahlend und sah aus, als könne er die ganze Welt umarmen, während Emma ihr Gesicht beim Gehen an seinem Arm versteckte. Vermutlich wäre sie lieber in irgendein Loch gekrochen, als so im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen.
Ich lachte auf, weil diese Reaktion einfach so typisch für meine Freundin war, und stürmte die Treppe hinunter, um ihnen entgegenzurennen. Es gelang mir kaum, mich zu beruhigen, denn mein Herz sprang mir vor Freude fast aus der Brust. Niemand, wirklich niemand, hatte ein Glücklich-bis-an-ihr-Lebensende so sehr verdient wie Emma und Nick. Mit einem breiten Lächeln im Gesicht lief ich den beiden das kurze Stück über den Rasen entgegen. Emma sah mich, quietschte einmal auf, was mich noch mehr zum Lachen brachte, und flog mir dann entgegen. Wir fielen uns in die Arme.
»O mein Gott, Emma!«, rief ich. »Ihr werdet heiraten! Herzlichen Glückwunsch!«
Emma hatte nasse Wangen, als sie ihr Gesicht an meines drückte. »Danke! Ich kann es gar nicht fassen.«
»Zeig mir den Ring!«, drängte ich sie, und Emma streckte die Hand aus.
An ihrem Ringfinger prangte ein schöner Diamant in einer klassischen, schlichten Fassung – es war genau der Ring, den Emma sich selbst ausgesucht hätte.
»Er ist wunderschön«, sagte ich zu Nick und umarmte ihn fest. »Herzlichen Glückwunsch, du Geheimniskrämer. Du hättest ruhig etwas sagen können!«
Nick grinste bis über beide Ohren. Er wirkte, als sei er sehr zufrieden mit sich und der Welt.
»Als ob du vor Emma auch nur eine Sekunde ein Geheimnis bewahren könntest«, erwiderte er trocken.
»Jaja, schon gut«, räumte ich ein und fügte nach einem Moment etwas leiser hinzu: »Das hast du gut gemacht, Nick. Ich freue mich für euch.«
Connor trat neben uns, um den beiden ebenfalls zu gratulieren. Unwillkürlich versteifte ich mich etwas, dann machte ich einen Schritt zurück, damit er Emma umarmen konnte.
»Das ist übrigens Connor Knightley«, sagte sie, als der Gastgeber auch Nick umarmte, was mit viel herzhaftem Klopfen auf den Rücken verbunden war. »Das heutige Geburtstagskind und Nicks bester Freund seit Uni-Tagen.«
»Wir haben uns schon miteinander bekannt gemacht«, bemerkte Connor und sah mich an. »Ivy, richtig?«
Mein Gott, er hatte sich nicht mal meinen Namen gemerkt!
»Mein Name ist Isy«, sagte ich spitz. »Schön, dich kennenzulernen. Corey.«
In seinen Augen blitzte etwas auf, aber bevor er etwas erwidern konnte, rief ich: »Jetzt lasst uns doch endlich auf das freudige Ereignis anstoßen!«
Denn ja, er hatte mich abblitzen lassen. Und ja, Connor ging mir mit seiner arroganten Art auf den Wecker. Aber das würde mich keinesfalls davon abhalten, den Abend zu genießen und mit meinen beiden besten Freunden ihre Verlobung zu feiern.
2.
Als ich am nächsten Morgen aufwachte, brauchte ich einen Moment, um zu erkennen, wo ich war. Verwirrt setzte ich mich auf. Wo war der New Yorker Straßenlärm? Die Sirenen, die Autos, das Hupen, all die Geräusche der pulsierenden Stadt, die Tag und Nacht durch das schmale Fenster meines WG-Zimmers drangen und an die ich mich so gewöhnt hatte? Jetzt war alles, was ich hörte, Meeresrauschen, Kinderlachen und das Bellen eines Hundes.
Kalifornien. Ich war zurück in Kalifornien.
Und ich lag auf dem Sofa in Emmas und Nicks Wohnzimmer, auf dem ich in der Nacht nach der Party geschlafen hatte. Nachdem wir auf die Verlobung angestoßen hatten, war der DJ von der ruhigen Lounge- zu wilder Dance-Musik gewechselt, und die Party hatte richtig Fahrt aufgenommen. Emma hatte mir angeboten, bei ihnen zu übernachten, damit ich nicht noch die kurvige Straße nach Thousand Oaks fahren musste, und wir hatten das Fest irgendwann im Morgengrauen verlassen.
Ich rieb mir die Augen, stand auf und streckte mich. Dann tapste ich barfuß in die Küche und machte mir einen Kaffee. Mit der dampfenden Tasse in der Hand lief ich zurück ins Wohnzimmer und öffnete die Terrassentür. Warme, frische Luft schlug mir entgegen, und ich kniff die Augen zusammen, weil die Sonne schon so hoch am Himmel stand. Die Holzbohlen unter meinen Füßen waren warm, als ich zu dem Daybed lief, das auch schon in Emmas und Nicks New Yorker Wohnung auf der Dachterrasse gestanden hatte, und mich darauf fallen ließ. Ich streckte die Beine aus und genoss den Ausblick auf den sich endlos vor mir erstreckenden azurblauen Pazifik und die Sonne, die auf meiner Haut kribbelte.
In der Küche hörte ich die Kaffeemaschine ein zweites Mal brummen, und keine Minute später trat Emma auf die Terrasse.
»Guten Morgen«, murmelte sie und setzte sich langsam und vorsichtig neben mich, ganz so, als würde ihr jede Bewegung wehtun. »Ich habe Kopfweh.«
Ich schmunzelte und trank einen Schluck meines Kaffees. »Kein Wunder, du hast gestern auch etwas über die Stränge geschlagen. Was dir natürlich absolut zusteht. Schließlich habt ihr euch verlobt.«
Sie lächelte und betrachtete versonnen den Ring an ihrer Hand. »Unglaublich, oder?«
Ich rutschte zu ihr hinüber und legte meinen Kopf an ihre Schulter.
»So unglaublich finde ich es gar nicht. Ich habe von Anfang an gewusst, dass ihr zusammengehört. Weißt du noch, als ihr euch beim Poetry-Slam das erste Mal gesehen habt? Ich habe direkt gemerkt, dass es bei Nick eingeschlagen hat. Da war einfach diese besondere Chemie zwischen euch. Du hast es nur nicht sehen wollen.« Ich piekte ihr mit einem Finger in die Seite. »Weil du zu sehr mit anderen Dingen – oder sollte ich besser sagen: mit jemand anderem? – beschäftigt warst.«
Sie lachte auf, fasste sich dann aber sofort an den Kopf und stöhnte.
»Bring mich nicht zum Lachen«, flehte sie. »Bitte!«
Schweigend betrachteten wir ein paar spielende Kinder, die am Meer eine riesige Sandburg mit Türmen und Wassergraben bauten. Zwei Väter halfen ihnen dabei und schienen beim Bau fast noch mehr Spaß zu haben als die Kinder.
»Wie spät ist es eigentlich?«, fragte ich nach einer Weile und trank meinen Kaffee aus.
»Es müsste so kurz vor zwölf sein«, erwiderte Emma und begann, ihre Schläfen zu massieren.
»Oh verdammt!«, fluchte ich und sprang auf. »Ich habe meiner Mom versprochen, dass ich zum Mittagessen zu Hause bin. Sie plant eine kleine Willkommensfeier für mich. Meine Schwester und ihre Familie sind auch da.«
Emma folgte mir zurück ins Wohnzimmer und beobachtete kopfschüttelnd, wie ich mir hektisch das Schlafshirt, das sie mir geliehen hatte, über den Kopf zog und wieder in das Kleid von letzter Nacht schlüpfte.
»Gib mir zwei Minuten. Ich ziehe mich an und fahre dich zu deinem Auto«, sagte sie dann und stellte die Kaffeetasse auf dem Tisch ab. »Das geht schneller, als wenn du läufst. Aber vorher brauche ich eine Kopfschmerztablette. Oder vielleicht besser gleich zwei.«
Vierzig Minuten später parkte ich das Auto vor dem Apartmentblock in Thousand Oaks, in dem meine Mutter seit der Scheidung von meinem Vater vor zehn Jahren lebte, mittlerweile gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Trevor. Die Cherry Avenue war gesäumt von Kirschbäumen, die der Straße zu ihrem Namen verholfen hatten, und von Pinien und Zedern, die ihren vertrauten harzig-trockenen Duft verströmten, als ich das Auto abschloss und die Straße überquerte. Obwohl ich es eilig hatte, blieb ich einen Moment stehen und betrachtete die Bank, die auf dem Bürgersteig direkt unter einem alten, knorrigen Eukalyptusbaum stand. Etwas in meinem Magen kribbelte, und wie auf Autopilot machte ich einen Schritt auf sie zu. Dann noch einen. Und noch einen. Bis ich bei ihr angekommen war. Langsam fuhr ich mit dem Finger über das raue, verwitterte Holz, und es dauerte nicht lange, bis ich fand, wonach ich suchte.
I + L
Die Buchstaben waren immer noch zu erkennen, genauso wie das leicht missglückte, schiefe Herz drumherum. Es war gar nicht so einfach, wie man dachte, mit einem Messer Bilder und Buchstaben in Holz zu ritzen. Fast konnte ich vor mir sehen, wie ich vor vier Jahren dort gesessen hatte, verliebt, lachend, händchenhaltend, küssend. Glücklich.
Ich seufzte. Dumm und naiv.
Schnell schüttelte ich das merkwürdige Gefühl ab, das mich zu überfallen drohte, und lief die schattigen Stufen bis zur Haustür hinauf.
Obwohl das Apartment klein war und Trevor, der Lehrer war, das alte Mädchenkinderzimmer eigentlich als Büro brauchte, hatte meine Mom mir angeboten, für die Anfangszeit bei ihnen einzuziehen, wofür ich ihr sehr dankbar war. Mein Studium in New York war abgeschlossen, aber um als Anwältin arbeiten und mich in Kanzleien in Los Angeles bewerben zu können, brauchte ich die Anwaltszulassung in Kalifornien, für die eine weitere – nicht gerade einfache – Prüfung abgelegt werden musste, die Ende des Sommers anstand. Ich musste mir, so schnell es ging, einen Nebenjob suchen, denn ich wollte meiner Mutter nicht länger als nötig auf der Tasche liegen. Aber im Grunde freute ich mich, eine Zeit lang wieder bei ihr zu wohnen. Wir hatten uns in den letzten Jahren schon selten genug gesehen, und ich hatte sie vermisst – genauso wie meine große Schwester Kathy und meine beiden Nichten.
»Tante Isy! Tante Isy!« Eine kleine Fee und eine noch kleinere Prinzessin rissen die Haustür auf, kaum dass ich den Schlüssel umgedreht hatte. »Tante Isy ist da!«
Ich ging in die Hocke und wurde von der dreijährigen Faith und der fünfjährigen Skylar fast umgeworfen. Als ich die beiden an mich zog, umschlossen vier kleine Ärmchen meinen Hals. Ich versuchte zu ignorieren, dass mir dabei ein Zauberstab in die Schulter stach und eine Krone in die Wange piekte, und atmete ihren zarten Kinderduft ein. Dann drückte ich jeder von ihnen einen Kuss auf die Stirn.
»Hallo, ihr seid ja wunderhübsch. Wer seid ihr denn?«
»Wir sind Elsa und Tinker Bell«, antwortete Skylar stolz.
Ausgiebig, wie es von mir erwartet wurde, bewunderte ich die glitzernden Kostüme, die sie trugen.
»Elsa und Tinker Bell, freut mich sehr, euch kennenzulernen. Und was habt ihr mit meinen süßen kleinen Nichten Skylar und Faith gemacht?«
Faith kicherte. »Aber Tante Isy, wir sind es doch«, wisperte sie aufgeregt. »Wir haben uns nur verkleidet!«
»Ach so, verstehe«, flüsterte ich verschwörerisch zurück. »Ich sage es niemandem weiter. Es bleibt unser Geheimnis.«
Die beiden kicherten wieder.
»Dürfen wir dich nach dem Essen schminken?«, fragte Faith dann. Dabei legte sie den Kopf schief, was besonders süß aussah und bewirkte, dass man ihr keinen Wunsch abschlagen konnte. Das wusste sie natürlich nur allzu gut. »Wir haben unsere Schminksachen dabei.«
Ich öffnete den Mund, um etwas zu sagen, aber Skylar fiel mir ins Wort: »Ich kann dich wie einen Tiger schminken.«
»Oder wie eine Prinzessin!«, fügte Faith hinzu. »Oder wie einen Marienkäfer! Oder wie eine Marienkäfer-Prinzessin!«
Ohne meine Antwort abzuwarten, waren sie schon wieder losgerannt, um weiterzuspielen. Sie waren zwei unermüdliche und gleichzeitig zuckersüße Energiebündel.
Ich erhob mich und schlüpfte schnell in mein Zimmer, wo ich Shorts und ein T-Shirt aus meinem Koffer kramte und gegen mein Party-Outfit tauschte. Im Badezimmer schminkte ich das Make-up vom Vorabend ab, spritzte mir kaltes Wasser ins Gesicht und band die Haare zu einem Pferdeschwanz zusammen, bevor ich mich auf den Weg in die Küche machte, wo ich den Rest der Familie vermutete.
Als ich an der offenen Wohnzimmertür vorbeikam, blickte mein Schwager John auf, der wie üblich auf dem Sofa saß und fernsah.
»Ah. Die verlorene Tochter.«
Den Spruch brachte er jedes Mal, wenn wir uns sahen. Und das nur, weil ich für ein paar Jahre in New York studiert hatte, anstatt wie Kathy in L. A. zu bleiben!
Kathy war Physiotherapeutin und hatte ihren Job aufgegeben, als sie Skylar bekommen hatte. John arbeitete nicht – zumindest nicht richtig, denn er war zu Geld gekommen, als er vor ein paar Jahren mit einigen Freunden irgendeine schlaue App entwickelt und dann verkauft hatte. Er investierte hier und da in Start-ups und in Aktien, aber die meiste Zeit hing er zu Hause und auf dem Golfplatz herum. Was natürlich nicht bedeutete, dass er auch nur im Entferntesten daran dachte, mal einen Finger krumm zu machen, während meine Schwester herumsprang, die perfekte Hausfrau und Mutter sein wollte und dabei häufig an den Rand eines Nervenzusammenbruchs kam.
Er musterte mich einmal von oben bis unten.
»Hast du zugenommen?«, fragte er dann und verzog seinen Mund zu einem Grinsen.
Es war mir immer schon ein Rätsel gewesen, wie meine fröhliche und lebenslustige Schwester einen Kotzbrocken wie John hatte heiraten können. Ich hatte da so eine Vermutung, dass Kathys erste Schwangerschaft nicht wirklich geplant gewesen war, obwohl sie es damals behauptet hatte, und ihre Hochzeit mit John dem Umstand geschuldet war, dass sie das hatte schaffen wollen, was Kathy als »geordnete Familienverhältnisse« bezeichnete. Aber das würde meine Schwester, die immer sehr darauf bedacht war, nach außen das perfekte Bild zu wahren, natürlich niemals zugeben.
»Du mich auch, John«, murmelte ich und ergriff die Flucht, bevor ich etwas Unüberlegtes sagen konnte.
Auf keinen Fall wollte ich einen Streit vom Zaun brechen, denn meiner Mutter waren die Familienessen heilig. Wir hatten ewig keines mehr gehabt, bei dem alle anwesend waren. Und außerdem hatte ich nicht vor, mir die Stimmung vermiesen zu lassen.
»Hallo zusammen!«, rief ich fröhlich, als ich die Küche betrat.
Meine Mutter, die mit dem Rücken zur Tür an der Spüle stand, drehte sich um und trocknete ihre Hände an einem Küchenhandtuch ab, bevor sie mich in den Arm nahm.
»Isabella! Wie schön, dass du da bist! Wie war es mit deinen Freunden gestern Abend?«
Meine Mutter war so ungefähr der einzige Mensch auf der Welt, der mich Isabella und meine Schwester Katherine nannte.
»Ziemlich ausgelassen. Die beiden haben sich verlobt, da gab es was zu feiern.«
Meine Familie kannte Emma und Nick bislang nur aus meinen Erzählungen, persönlich waren sie sich noch nicht begegnet.
Trevor, den ich am Abend zuvor noch nicht gesehen hatte, nahm mich in den Arm. Er roch nach Minze und den Zigarren, die er heimlich rauchte, genau wie früher. Manche Dinge änderten sich nie.
»Schön, dass du wieder da bist, Isy«, sagte er und zwinkerte mir zu. »Deine Mutter ist überglücklich. Und ich auch, denn niemand außer dir hat Lust, sich mit mir über Football zu unterhalten.«
Kathy, die am Herd stand und hektisch in einem der Töpfe rührte, streckte mir das Gesicht hin, damit ich ihr einen Kuss auf die Wange drücken konnte.
»Hey, Mini«, begrüßte sie mich mit meinem Spitznamen und pustete sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Kannst du die Kartoffeln aus dem Ofen nehmen? Das Essen ist gerade fertig.«
»Schön, dich zu sehen, Kittykat«, sagte ich lachend. »Deine Freude darüber, dass ich endlich zurück bin, scheint dich ja fast zu überwältigen.«
Sie verzog das Gesicht, aber ich sah, dass sie ebenfalls grinste, bevor sie sich wieder dem Herd zuwandte.
»Ich tobe innerlich vor Freude, glaub mir«, versicherte sie. »Ich kann es nur gerade nicht so zeigen, weil die Soße überkocht.«
»Man muss Prioritäten setzen«, stimmte ich ihr zu und stellte mich ans Spülbecken, um mir die Hände zu waschen.
Die beiden Mädchen kamen hereingestürmt, umrundeten einmal den Tisch und rannten wieder in den Flur zurück.
»Seid nicht so wild!«, rief meine Schwester so laut, dass mir die Ohren klingelten. »Und passt mit der Vase auf dem Sideboard auf!«
Die Kinder hörten sie gar nicht und rannten einfach weiter. Kathy seufzte resigniert.
Im gleichen Moment betrat John die Küche, ganz so, als hätte er geahnt, dass das Essen so gut wie fertig war, und sagte: »Kannst du bei den Mädchen nicht mal härter durchgreifen? Wir haben uns doch als Kinder auch besser benommen. Damals hat man gehorcht.«
In schwesterlicher Solidarität sah ich Kathy an und verdrehte die Augen. »Kinder sind doch keine Schäferhunde.«
John grinste spöttisch. »Und seit wann bist ausgerechnet du Expertin in Sachen Kindererziehung?«
Ungefähr genauso ein Experte wie du, dachte ich. Aber um die Stimmung nicht zu verderben, behielt ich den Gedanken lieber für mich. Statt ihm zu antworten, nahm ich mir zwei Küchenhandschuhe, holte die Auflaufform aus dem Ofen und stellte sie auf den Tisch. Dann gab ich etwas von den Kartoffeln auf die Teller der Kinder und zerteilte sie, damit sie schon einmal abkühlen konnten.
»Das Essen sieht fantastisch aus, Mom«, sagte ich, als sie eine Platte mit Roastbeef und eine Schüssel mit Caesar Salad auf den Tisch stellte und sich neben Trevor setzte. »Du hättest dir nicht so viel Arbeit machen sollen.«
Sie winkte ab, aber ich merkte, dass sie sich über das Kompliment freute.
»Ach was, das ist doch keine Arbeit«, behauptete sie. »Das mache ich gerne für euch. Wenn du mal Familie hast, wirst du es auch so machen. Nicht wahr, Kathy?«
John begann mit dem Essen, bevor die anderen überhaupt etwas auf dem Teller hatten. Ich konnte die Art, wie er das Roastbeef in sich hineinschaufelte, mit dem Ellenbogen auf dem Tisch und dem Kopf dicht über dem Teller, nicht ausstehen. So viel zum Thema gute Erziehung.
Er sah auf. »Dann ist es vorbei mit der großen Anwaltskarriere. Dann heißt es nur noch: Brei kochen und Windeln wechseln.«
»So ein Quatsch.« Stirnrunzelnd reichte ich meiner Mutter die Soße. »Frauen können sich heute entscheiden, ob sie Karriere machen oder Kinder bekommen wollen. Oder beides. Wir leben doch nicht mehr im Mittelalter.«
Na ja, du vielleicht schon, setzte ich in Gedanken hinzu und konnte ein Schmunzeln nicht unterdrücken, während ich Skylar und Faith Wasser einschenkte.
John schnaubte. »Frauen, die Kinder und Karriere vereinbaren wollen, sind in meinen Augen egoistisch. Dabei bleiben doch zwangsläufig die Kinder auf der Strecke.«
»Ich habe auch aufgehört zu arbeiten, als ich euch bekommen habe«, sagte meine Mutter überflüssigerweise.
Na, und wo hatte sie das hingebracht? Sie hatte mich und meine Schwester bekommen, als sie noch sehr jung gewesen war, und damals ihren Job aufgegeben, weil mein Vater – Oberarzt in demselben Krankenhaus, in dem sie ihre Ausbildung zur Krankenschwester machte – sehr gut verdient hatte. Als ich gerade sechzehn geworden war, hatte er uns über Nacht verlassen. Anscheinend hatte er damals gedacht, dass er – mit fast erwachsenen Töchtern – nun endlich eigene Wege gehen könne. Oder zumindest andere. Gemeinsam mit einer jüngeren Frau, mit der er offenbar schon eine längere Zeit ein Verhältnis gehabt hatte. Mittlerweile lebten er und seine zweite Ehefrau in Washington und hatten einen gemeinsamen Sohn. Unser Verhältnis war freundlich, aber nicht übermäßig herzlich, und das war irgendwie in Ordnung so.
»Willst du damit sagen, dass alle Frauen, die Kinder haben und einem Beruf nachgehen, schlechte Mütter sind?«, fragte ich John fassungslos.
»Genau das will ich sagen. Dann lieber keine Kinder bekommen.«
Was war er nur für ein Steinzeitmensch! Ich sah meine Schwester an, doch sie mied meinen Blick und wischte hochkonzentriert etwas Soße vom Lätzchen ihrer Jüngsten. Ich wusste, dass ihr die Ansichten ihres Mannes peinlich waren, aber Kontra gab sie ihm deswegen noch lange nicht. Gott bewahre, dass es zu einem Streit kam!
Resigniert lehnte ich mich in meinem Stuhl zurück. »Na, dann wird es dich ja beruhigen, dass ich nicht vorhabe, welche zu bekommen.«
Trevor tätschelte meine Hand. »Dir fehlt nur der richtige Mann dazu, glaub mir, Liebes.«
Ich wusste, dass er es gut meinte. Aber: Puh, wie konnten einen Menschen denn in einer so kurzen Zeit so sehr erschöpfen?
»Vielleicht ist der richtige Mann ja auch einer, der sich die Kinderbetreuung mit der Frau teilt«, sagte ich und zog eine Augenbraue hoch.
»Warum willst du keine Kinder, Tante Isy?«, fragte Skylar mit ihrer süßen Piepsstimme.
»Weil sie keinen Mann findet, der welche mit ihr kriegen will, Prinzessin«, antwortete John an meiner Stelle.
Ich schielte nach dem Bratenmesser auf der Fleischplatte vor mir und unterdrückte den Impuls, danach zu greifen. Ich wollte die Kinder nicht traumatisieren. Und schreiende Farben standen mir nicht, weswegen ich lieber darauf verzichten wollte, den Rest meines Lebens Orange zu tragen.
Stattdessen küsste ich Skylar auf die Schläfe und sagte lächelnd: »Weil ich niemals so süße Kinder bekommen würde wie euch zwei Engel. Also lasse ich es lieber bleiben und verwöhne meine beiden Nichten nach Strich und Faden.«
Nach dem Essen räumte ich zusammen mit Trevor den Tisch ab und spülte das Geschirr, während er abtrocknete. Dabei unterhielten wir uns über die Los Angeles Rams, die dabei waren, ihr Team für die nächste Saison zusammenzustellen. Trevor war ein eher stiller Mann, aber er blühte auf, wenn man mit ihm über Football redete. Als wir in der Küche fertig waren, ging er zu John ins Wohnzimmer, um mit ihm irgendeinen Bericht über Eishockey zu schauen, und ich setzte mich mit einem Kaffee zu Kathy auf die Terrasse. Die Kinder planschten mit Schwimmflügeln im Nichtschwimmerteil des Gemeinschaftspools der Apartmentanlage, die für kalifornische Verhältnisse typisch angelegt war: zweistöckige Gebäude, die um ein Schwimmbecken und einen schönen Garten mit Palmen und blühendem Oleander herum angeordnet waren. Was wie der absolute Luxus klang und an anderen Orten – wie beispielsweise in New York – unbezahlbar gewesen wäre, war hier in Kalifornien für die Bürger der Mittelschicht fast normal. Die wirklich reichen Menschen hatten ein Haus mit großem Garten und einem eigenen Pool, den sie sich nicht mit anderen teilen mussten.
Kathy und ich hatten als Teenager abends oft in der Dunkelheit Seite an Seite am Pool gesessen, die Beine ins Wasser baumeln lassen und geredet. Wir hatten über unsere Zukunftspläne oder einfach nur über unsere Freunde und die Schule gesprochen, manchmal auch über Jungs. Kathy hatte damals schon Physiotherapeutin werden wollen und davon geträumt, eines Tages mit dem amerikanischen Olympiateam um die Welt zu reisen. Ich wollte studieren – ich wusste nur noch nicht, was – , aber auf jeden Fall auch heiraten und Kinder bekommen. Den Mann dafür hatte ich damals schon gehabt.
Bei der Erinnerung daran wusste ich nicht, ob ich den Kopf schütteln, lachen oder bloß ein kleines bisschen Wehmut empfinden sollte. Wir waren so jung und ahnungslos gewesen! Sowohl für mich als auch für Kathy war letztlich alles anders gekommen, als wir es uns damals vorgestellt hatten.
Ich winkte meiner Mutter zu, die neben dem Schwimmbecken stand und die planschenden Mädchen mit Argusaugen bewachte.
»Und, wie ist es, wieder zu Hause zu sein?«, fragte Kathy, als ich meine Beine auf einen Hocker legte und mich in das gemütliche Polster zurücklehnte.
»Schön und gleichzeitig ungewohnt. Anders als in New York.« Ich wusste nicht genau, wie ich es beschreiben sollte. »Hier ist es auf eine andere Art schön.«
»Erzähl mir was von New York«, bat Kathy sehnsüchtig.
Wir hatten zwar regelmäßig telefoniert und Nachrichten ausgetauscht, aber ich hatte Kathy von meinem New Yorker Leben nie in allen Details erzählt. Ich war dort ein ganz anderer Mensch gewesen, hatte – vor allem, was Männerbekanntschaften anging – ungezwungener und freier gelebt als in meiner Zeit in Kalifornien. Ich war zwar auch ein temperamentvolles Kind und ein wilder Teenager gewesen, aber ich wusste, dass ich mich in New York noch einmal verändert hatte und dass Kathy die New Yorker Isy vielleicht sogar ein wenig fremd sein würde.
»New York steht niemals still, es ist immer hektisch, pulsierend, lebendig«, antwortete ich schließlich. »Das kann einen einerseits ganz schön ermüden, andererseits ist es auch inspirierend. Es spornt einen irgendwie an. Die Menschen, die dort leben, sind so unterschiedlich. Da gibt es zum einen die leistungsorientierten, die nach oben streben und reich werden wollen. Und die, die schon unendlich reich sind und auf der Fifth Avenue am Central Park oder irgendwo anders in ihren Luxuswohnungen in Manhattan leben. Gleichzeitig sind viele so arm, dass sie nicht mal wissen, wie sie ihre nächste Mahlzeit bezahlen sollen. Und natürlich all die Menschen dazwischen: die Familien, die eher in Queens oder Brooklyn wohnen, weil sie sich die Wohnungen in der Stadt nicht leisten können. Und die Künstler, die Musiker, die Freigeister in SoHo oder Williamsburg …« Ich suchte nach Worten. »Die Stadt hat so viele Facetten, dass man sie kaum beschreiben kann. Ich habe fast alle davon geliebt.«
Kathy lächelte schwach. »Du hattest offensichtlich eine aufregende Zeit dort.«
Ich schmunzelte. »Die Arbeit in der Kanzlei Donovan & Thompson, wo ich meinen Studentenjob hatte, war anstrengend – und das Studium erst recht. Aber das Nachtleben in New York konnte ich mir unmöglich entgehen lassen. Ich war auf Dachterrassen von luxuriösen Penthousewohnungen, wo der Champagner in Strömen floss, und in irgendwelchen Underground-Clubs, wo Indie-Bands aufgetreten sind, deren Namen keiner kennt. Es gibt Poetry-Slams und Verbindungspartys und Konzerte und Pop-up-Restaurants und Club-Eröffnungen …«
Kathy hing an meinen Lippen, als würde sie versuchen, über meine Erzählungen das pulsierende Leben in sich aufzusaugen, das sie selbst nicht haben konnte.
»Wie bist du da überall reingekommen?«, fragte sie staunend.
Ich wackelte mit den Augenbrauen. »Ich habe meine Mittel und Wege.«
Sie kicherte. »Das glaube ich dir aufs Wort. Und was war mit den Männern? Du hast zwar nie Einzelheiten erzählt, aber den einen oder anderen hast du erwähnt.« Sie runzelte die Stirn. »Ethan? Oder Philipp?«
Ich goss uns beiden ein Glas Eiswasser aus der Karaffe auf dem Tisch ein.
»Es gab schon ein paar besondere Männer. Aber ich war nicht gerade auf der Suche nach einer festen Beziehung«, sagte ich vage und dachte kurz an die vielen interessanten Männer, die ich in den letzten drei Jahren kennengelernt und gedatet hatte. Ich war keine große Freundin von One-Night-Stands, aber gegen eine unverbindliche Beziehung, die beiden Seiten Spaß machte und dann irgendwann ohne Herzschmerz und Liebeskummer endete, hatte ich nichts einzuwenden. Und New York war dafür genau das richtige Pflaster gewesen.
»Und jetzt? Hast du dich ausgetobt und bist wieder auf der Suche nach was Festem?«
»Nein!«, sagte ich und lachte. »Ich brauche keinen Freund. Ich glaube nicht an die große Liebe.«
»Das war aber mal anders«, erwiderte sie.
»Die Zeiten ändern sich eben. Ich bin nicht mehr dieselbe wie früher.«
Kathy schwieg einen Moment.
»Ich glaube, es war genau die richtige Entscheidung, nach New York zu gehen«, sagte sie dann. »Du brauchtest die Ablenkung einfach, nachdem es dir damals so schlecht ging …«
Ich versuchte, das unangenehme Gefühl in meinem Bauch zu ignorieren, das ihre Worte in mir auslösten.
»Ich hatte auf jeden Fall eine tolle Zeit dort«, sagte ich betont fröhlich. »Aber jetzt erzähl mir lieber mal, wie es dir geht.«
»Ziemlich plumper Themenwechsel, Mini. Aber ich lasse ihn dir durchgehen«, sagte sie augenzwinkernd. »Ich habe ein Angebot für einen Job in dem Reha-Zentrum in Santa Clarita bekommen, in dem ich damals meine Ausbildung gemacht habe.« Sie verdrehte die Augen. »Santa Clarita ist nicht gerade New York, ich weiß.«
»Aber das ist doch fantastisch!«, rief ich begeistert. »Herzlichen Glückwunsch! Hast du dich dort beworben?«
Sie schüttelte den Kopf. »Als ich meine alte Chefin zufällig beim Einkaufen getroffen habe, hat sie mich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, dort wieder anzufangen. Ich müsste natürlich noch eine förmliche Bewerbung schreiben und ein paar Auffrischungskurse belegen, schließlich bin ich schon einige Jahre aus dem Job.«
»Und?«, fragte ich aufgeregt. »Wirst du ihr Angebot annehmen?«
»Ich weiß es nicht.« Sie zuckte mit den Schultern und blickte auf ihre Hände. »Du hast ja gehört, was John von arbeitenden Müttern hält.«
Ich schnaubte. »Ich glaube, du solltest lieber darauf hören, was du willst, und weniger auf das, was John will.«
Sie begann, an der Kerze, die vor ihr auf dem Tisch stand, herumzuknibbeln.
»Du verstehst das nicht«, behauptete sie. »Es geht ja nicht nur darum, dass ich gerne sein Einverständnis hätte, sondern auch um praktische Dinge. Wenn ich arbeite, müssten wir unser ganzes Leben anders organisieren. Wer holt die Mädchen von der Schule und dem Kindergarten ab? Wer macht mit ihnen Hausaufgaben? Wer fährt sie ins Ballett? Wer kümmert sich um sie, wenn sie krank sind? Glaub mir, Kinder sind häufiger krank, als du dir das vorstellen kannst.«
Sie seufzte.
»Wenn ich in Santa Clarita arbeiten würde, müsste ich pendeln«, fuhr sie dann fort. »Weißt du, wie schrecklich hier die Rushhour ist? Wahrscheinlich wäre ich permanent im Stress und überall zu spät, selbst wenn ich nur in Teilzeit arbeiten würde. Ich will keine Kinder, die nachmittags weinend auf ihre Mom warten und immer die Letzten sind, die abgeholt werden.«
Ich verstand, was sie meinte, aber andererseits musste es auch Mittel und Wege geben, so etwas zu organisieren.
»John arbeitet doch ohnehin nicht und ist die meiste Zeit zu Hause«, sagte ich. »Er könnte sie zum Beispiel morgens fahren und mittags abholen. Oder ihr könntet euch abwechseln.«
Sie rollte ein Wachskügelchen zwischen Daumen und Zeigefinger.
»Womit wir wieder beim Thema ›Johns Einverständnis‹ wären.«
Ich kaute auf der Unterlippe. »Ich würde dich dabei unterstützen, Kittykat.«
Liebevoll sah sie mich an. »Das ist süß von dir, Mini. Aber du wirst auch bald anfangen zu arbeiten, und wir brauchen eine dauerhafte Lösung.«
»Vielleicht könnt ihr euch eine Nanny suchen, die ein Auto hat, die Kinder also auch fahren und abholen kann?«
»John sagt, dann geht ein Großteil meines Gehalts für die Kinderbetreuung drauf. Und das macht doch irgendwie keinen Sinn, wenn ich mich auch selbst um die Kinder kümmern kann. Kostenlos.«
»Aber …«, fing ich an, aber Kathy unterbrach mich.
»Ist ja auch egal. Wir werden sehen, wie alles kommt. Und was ist mit dir?«, erkundigte sie sich. »Was hast du für Pläne, wenn du die Anwaltszulassung hast? Wirst du bis dahin bei Mom und Trevor wohnen?«
»Und du sagst, meine Themenwechsel seien plump?«, murmelte ich und wich dem Wachskügelchen aus, das sie nach mir warf, statt zu antworten. »Ich möchte mich nach der Zulassung in L. A. bewerben. In irgendeiner Großkanzlei, in der ich viel Geld verdiene, mit dem ich schnell meinen Studienkredit abbezahlen kann. Eigentlich könnte ich bis dahin hier wohnen bleiben, aber ich befürchte, dass es etwas zu eng wird. Trevor braucht sein Büro. Ich denke, ich werde mir einen Job und eine eigene Wohnung suchen.«
Außerdem musste ich mir ein Auto kaufen, was ein großes Loch in mein Erspartes reißen würde. Aber in L. A. und Umgebung war man auf ein eigenes Auto angewiesen, denn öffentliche Verkehrsmittel gab es – anders als in New York, wo man überall mit U-Bahn, Bus oder Taxi hinfuhr – kaum.
»Und wenn du einen Vertrag in einer schicken Kanzlei in L. A. unterschrieben hast, ziehst du in eine exklusive Penthousewohnung in der Innenstadt, Miss Superanwältin?«, zog meine Schwester mich gutmütig auf.
»So ist der Plan«, antwortete ich grinsend. »Du darfst mich jederzeit besuchen kommen und meinen Spa-Bereich nutzen, wenn du möchtest.«
»Ich bin zweifache Mutter, für mich ist es Wellness, wenn ich es schaffe, mir die Beine zu rasieren. Daher trinke ich gerne auf deinen zukünftigen Spa-Bereich«, erwiderte Kathy und hielt mir ihr Wasserglas zum Anstoßen hin. Als ich ihr mit meinem Glas entgegenkam, fügte sie hinzu: »Aber schau mir dabei bitte nicht in die Augen! Sonst muss ich in den nächsten sieben Jahren Sex haben.«
Ich prustete los, und Kathy lächelte müde.
»Das ist mein voller Ernst«, versicherte sie. »Faith wacht im Moment jede Nacht um drei Uhr auf und kann nicht mehr einschlafen, wenn ich sie nicht zu uns ins Bett hole. Ich liege dann meist bis morgens wach – mit ihren Füßen im Gesicht. Das geht schon seit Wochen so.« Einen Moment schloss sie erschöpft die Augen. Dann gab sie sich einen Ruck und stand auf. »Die Mädchen sollten langsam aus dem Wasser, sonst erkälten sie sich noch.«
Ich griff nach ihrer Hand. »Setz dich wieder. Ich gehe und helfe Mom, die Mädchen abzutrocknen und anzuziehen. Danach hole ich uns einen Kaffee, und wir quatschen noch ein bisschen, okay?«
Dankbar lächelte sie mich an und setzte sich mit einem erleichterten Aufseufzen wieder.
»Du bist die Beste, Isy, weißt du das?«
»Na klar«, antwortete ich augenzwinkernd und schnappte mir die beiden Minnie-Mouse-Handtücher, die ordentlich gefaltet auf einem der Stühle lagen. »Aber für dich würde ich alles tun, Kathy. Ich bin immer für dich da.«
3.
Am nächsten Vormittag saßen Emma und ich auf der Terrasse ihres Strandhauses, die Füße auf der Holzbrüstung der Veranda, und bräunten unsere nackten Beine. Die Sonne fühlte sich herrlich auf meiner Haut an, und glücklich ließ ich meinen Blick über den Strand und das tiefblaue Meer schweifen, das sich vor uns bis zum Horizont erstreckte.
Zahlreiche Surfer saßen auf ihren Brettern im Wasser und warteten auf die perfekte Welle. Ihre Köpfe hoben und senkten sich synchron mit dem regelmäßigen Wogen des Meeres. Hin und wieder löste sich einer von ihnen, paddelte mit kräftigen Armzügen mit der sich auftürmenden Welle mit und schwang sich dann aufs Brett, um sie zu reiten. Den einen gelang das besser, den anderen schlechter, aber offensichtlich hatten alle Spaß daran.
»Ihr könntet euch einen Gasgrill anschaffen«, schlug ich Nick vor, der seit einer halben Ewigkeit versuchte, die Holzkohle unter dem riesigen Barbecue-Grill zu entfachen, indem er mit einer Zeitung über der noch kaum sichtbaren Glut herumwedelte.
Nick hörte mit dem Wedeln auf und starrte mich fast empört an. »Niemals! Grillen ohne richtiges Feuer ist kein Grillen.«
Emma und ich wechselten einen Blick, doch sie zuckte nur mit den Schultern und senkte grinsend den Kopf. Einen Moment beobachtete ich ihn noch, dann erbarmte ich mich, stellte mich neben ihn und schob ihn mit der Hüfte zur Seite.
»Lass mich mal ran, Mr Castaway. Ich werde Feuer machen. Als echtes California-Girl kann ich das bestimmt besser als du, City-Boy.«
Nick verzog keine Miene, als er mir die Streichholzschachtel überreichte. »Lass mich raten: Du hast schon mit drei Jahren auf dem Geburtstag deines Onkels Bob den Grill angefeuert?«
»Ganz genau.« Ich grinste ihn an und nahm die Rolle Küchenpapier, die neben dem Grill stand. Ich knüllte einige Stücke davon zusammen und schob sie zwischen die Kohlen. Dann entzündete ich das erste Streichholz, um es zwischen die Kohlestückchen zu stecken und das Küchenpapier zu entzünden. Vier weitere Streichhölzer folgten. Jetzt glommen an verschiedenen Stellen kleine Glutherde, die ich durch vorsichtiges Pusten immer weiter anfachte. Es dauerte keine zehn Minuten, da war die Glut vollends entfacht, und Nick konnte den Deckel des Grills schließen, damit er aufheizen konnte.
»Vielen Dank.« Nick klopfte mir kameradschaftlich auf die Schulter. »Wenn ich mal auf einer einsamen Insel stranden sollte, dann hoffentlich mit dir. Und einem Volleyball namens Wilson.«
»Mit mir, Wilson, einer Packung trockener Streichhölzer und Küchenpapier meinst du wohl?«, konterte ich, und er lachte.
»Magst du noch einen Eistee?«
Als ich nickte, machte Emma Anstalten aufzustehen.
»Bleib sitzen. Das übernehme ich«, sagte Nick und verschwand im Haus.
Emma sah ihm verträumt hinterher. »Ist er nicht toll?«
»Unglaublich toll«, bestätigte ich. »Wenn er auch noch ein Feuer entfachen könnte, wäre er perfekt. Man könnte ihn fast heiraten.«
Sie blickte auf den funkelnden Verlobungsring an ihrem Ringfinger und lächelte. »Ich nehme ihn auch so.«
Ich schüttelte belustigt den Kopf. »Hauptsache, er entfacht dein Feuer, Em.«
»Natürlich. Jeden Tag aufs Neue«, behauptete Nick, der zurückgekommen war, und reichte mir das Glas, bevor er Emma einen Kuss auf den Scheitel drückte.
Dankend nahm ich das Glas und trank einen Schluck.
»Und davon abgesehen, dass du diesen absoluten Traummann hier heiraten wirst, wie läuft es im Job bei dem Kinderhilfeverein? Tut mir leid, ich habe den Namen vergessen.«
»Alliance for Children’s Rights«, antwortete Emma und ergriff die Hand ihres Verlobten, der sich neben sie gesetzt hatte. »Es ist toll da. Die Arbeit macht richtig viel Spaß, und ich habe zum ersten Mal das Gefühl, etwas wirklich Sinnvolles zu tun. Obwohl es auch manchmal echt anstrengend ist und ich durchdrehen könnte, wenn die Dinge nicht so laufen, wie ich es will.«
»Wieso?«, fragte ich. »Wer oder was bringt dich denn zum Durchdrehen?«