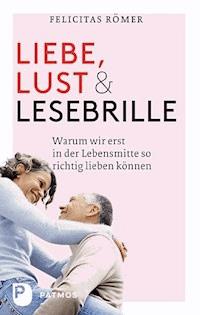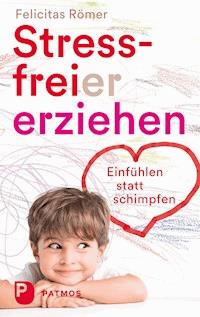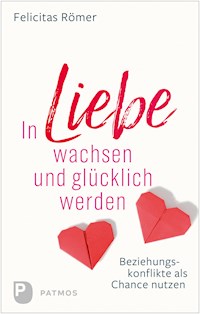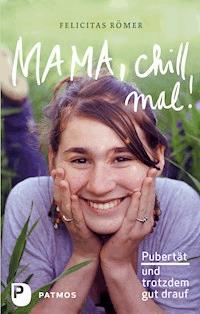
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Patmos Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Monster? Kaktus? Nein: Jugendliche in der Pubertät sind nicht nur ruppige Stinkstiefel. Auch wenn nicht immer alles "easy" ist: Panik vor der Pubertät ist nicht nötig. Felicitas Römer, selbst Mutter von inzwischen erwachsenen Kindern, zeigt: Wenn Eltern bereit sind, alte Denkweisen und eingefahrene Verhaltensmuster aufzugeben, ist die Pubertät für alle eine große Chance, sich selbst positiv zu verändern. Mit liebevollem Blick und vielen praktischen Tipps beschreibt Felicitas Römer, wie Eltern entspannt durch die Pubertät ihrer Kinder kommen. So können Eltern immer öfter, wenn der Nachwuchs auffordert: "Chill mal!", locker antworten: "Aber gerne!".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NAVIGATION
Buch lesen
Cover
Haupttitel
Inhalt
Über die Autorin
Über das Buch
Impressum
Hinweise des Verlags
Felicitas Römer
Mama, chill mal!
Pubertät und trotzdem gut drauf
Patmos Verlag
Inhalt
Voll cool, ey! Teenager sind besser als ihr Ruf Plädoyer für eine unbeliebte Spezies
Fröhlich reifen Wie sich Ihr Kind in der Pubertät entwickelt
Hormone! Wenn der Körper macht, was er will
Alles klar und echt verwirrt: Aufklärung ist mehr als Nachhilfe in Bio
Voll peinlich: Sexualität und Scham
Let’s talk about sex! Und warum das manchmal schwierig ist
Die Baustelle unter der Schädeldecke: Ist der Stirnlappen schuld?
Kognitive Revolution: Der clevere Teenager
»Wer bin ich und wenn ja, warum?« – Entwicklungsaufgaben im Jugendalter
Emotionale Achterbahn: Zwischen »total gut drauf« und »alles voll ätzend«
»Ich bin okay« – Selbstannahme wäre ein schönes Ziel
Gemeinsam wachsen Warum Pubertät die ganze Familie bewegt
Plötzlich Chaos? Pubertät und Familiendynamik
Zoff – ja bitte! Warum Familienharmonie überbewertet wird
Warum Streit hilft. Und wie Sie Ihren Teenager auf die Palme bringen
Wehmut, Stolz und andere Gefühle – was Jugendliche auslösen
»Homies« und »Best Friends«: Warum Gleichaltrige jetzt so wichtig sind
Partnerschaft: Immer schön lebendig bleiben
»Nerv nicht!« Geschwisterliebe, Geschwisterstress
Selbstfürsorge: 5 Tipps, sich Gutes zu tun
Flauschig bleiben Die etwas andere Art, mit Jugendlichen umzugehen
Von wegen zickig! 10 Sachen, die Heranwachsende liebenswert machen
Mein Kind, das fremde Wesen? Interessiert sein!
Gute Gespräche führen
Die Kunst der Annahme: Jugendliche lieb haben
Muss man auf seine Kinder stolz sein? Warum Schule und Leistung überbewertet werden
Schluss mit »pädagogisch wertvoll«! Sondern: Sparringspartner werden
Einfach ich. Oder: Wie geht »authentisch sein«?
Das Wesentliche sehen: Achtsamkeit ist heilsam
Güte und Geduld: Altmodische Tugenden dringend benötigt
Heute schon gekichert? 10 (unkonventionelle) Tipps für den Alltag mit Teenagern
Hilfreich sein So stärken Sie Ihren Jugendlichen
Da sein: Die Kunst der elterlichen Präsenz
»Ich bin ich und du bist du« – gute Abgrenzung
»Ich will doch nur dein Bestes« – wie geht »fördern«?
Prinzip Selbstwirksamkeit: Was Jugendlichen guttut
Vertrauen: Ohne Vorschuss geht es nicht
Erste Liebe. Und warum Eltern sie schützen sollten
Trösten oder was? Wenn das Kind Kummer oder Sorgen hat
Autonomie fördern. Und warum es nicht um Abschied geht
Loslassen lernen: 10 Tipps
Herausforderungen meistern Konflikte mit Jugendlichen lösen
Typisch Teenager: Was tun, wenn …?
»Ich chill’ dann mal!« – warum »Faulenzen« und »Nichtstun« jetzt dazu gehören
Provokationen. Und welche Funktionen sie erfüllen
»Ich will aber!« Mitbestimmen lassen
Was spüre ich, was möchtest du? Konflikte lösen mithilfe der Gewaltfreien Kommunikation
7 No-Gos: Was Sie jetzt lieber lassen sollten
Geht doch! Warum das Leben mit Teenagern Spaß macht
Anhang
Anmerkungen
Quellennachweis
Voll cool, ey! Teenager sind besser als ihr Ruf Plädoyer für eine unbeliebte Spezies
Erinnern Sie sich noch an die Schwangerschaft? War das nicht eine aufregende Zeit? Und war die Freude auf die Geburt nicht stärker als jede Sorge und Furcht?
Ich frage das, weil die sogenannte »Pubertät« von Entwicklungspsychologen gern als »zweite Geburt« bezeichnet wird. Verständlich. Immerhin geht es in beiden Phasen um Abnabelung – im konkreten wie im übertragenen Sinne.
Und? Freuen Sie sich auf diese »zweite Geburt« Ihres Kindes genauso wie auf die erste? Ach, nicht so richtig? Willkommen im Club! Wenige Eltern freuen sich auf die Pubertät ihres Kindes. Gemischte Gefühle sind hier das Minimum. Einige Mütter und Väter haben eine diffuse Angst vor dieser Familienphase. Oder zumindest gehörigen Respekt. Viele sorgen sich, ihr Kind könnte in der Pubertät denselben Blödsinn veranstalten wie sie selbst damals. Andere wiederum grauen sich davor, von ihrem Teenager »schlecht« behandelt zu werden oder mit ihm nicht mehr klarzukommen.
Doch sind Teenager wirklich so schrecklich? Sind sie allesamt pickelige und mies gelaunte Monster, die uns das Leben zur Hölle machen? Die ihr Zimmer vollmüllen, nur um uns zur Weißglut zu treiben?
Nein, natürlich nicht. Doch leider hat der Jugendliche keinen guten Ruf. Besonders die Medien bedienen das Bild des »schwierigen Pubertisten«, der gelangweilt in seinem Zimmer herumhängt, die Eltern beschimpft oder das nächstbeste Auto knackt. Ein missratener Teenager lernt Regeln laut TV nur noch in der Wüste oder im Dschungel. Selbst die Super-Nanny kann hier nichts mehr ausrichten.
Das negative Image der Jugend hat lange Tradition. So soll schon Sokrates moniert haben: »Die Jugend liebt heute den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt mehr vor älteren Leuten und diskutiert, wo sie arbeiten sollte. Die Jugend steht nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widerspricht den Eltern und tyrannisiert die Lehrer.«
Viele Jugendgenerationen haben gegen die herrschenden Konventionen ihrer Eltern rebelliert und versucht, neue Werte in die Gesellschaft zu integrieren. Dass das nicht ohne generationsübergreifende Konflikte abgehen kann, ist klar. Aber es ist nun mal das gute Recht junger Menschen, das soziale und politische Leben mit- oder umzugestalten. Oder sogar ihre Pflicht? Schließlich gäbe es sonst keine Veränderung, keinen Fortschritt, keine neuen Ideen in dieser Welt. Man denke nur an die 68er-Generation, die sich nur mit massivem Kraftaufwand von der kriegsgeschädigten Elterngeneration lösen konnte und durch Provokationen viele gesellschaftliche Veränderungen in Gang gesetzt hat.
Heute sind Jugendliche weniger wegen ihrer revolutionären politischen Haltung unbeliebt, sondern weil sie einfach den gewohnten Familienfrieden durcheinanderbringen. Sie stellen die Werte der Eltern in Frage, nehmen gnadenlos deren Argumentation auseinander und verhalten sich oft wenig bestätigend. Das ist für manche Eltern schlecht zu ertragen.
Jugendliche werden oft als laut oder unzugänglich, als launisch, »aggressiv« oder desinteressiert beschrieben – oder alles zusammen. Nur sehr wenige Eltern sagen: »Meinem Kind geht es nicht gut. Es leidet unter der Pubertät.« Viele sagen aber: »Mein Kind ist schwierig. Es verhält sich provokativ, es nervt, es ist anstrengend, es bringt mein Leben durcheinander. Ich will das nicht!«
Teenager werden leider oft auch nicht ernst genommen: Haben sie Kummer oder Ärger? »Die Pubertät ist schuld.« – »Das gibt sich.« – »Der regt sich schon wieder ab.« – »Das darf man nicht zu wichtig nehmen.« Oder: »Selber schuld! Wer sich anständig benimmt, der wird auch anständig behandelt.« Das ist insofern bedauerlich, als sich hinter der widerspenstigen oder spröden Fassade meistens ein zartes und verletzliches Wesen verbirgt, das dann ungesehen und allein bleibt.
Die wenigsten Jugendlichen sind wirklich »problematisch«. Die meisten pubertieren moderat und friedlich vor sich hin und haben mit dem Klischee des exzessiven Jugendlichen nichts gemein. Viele Teenager sind fröhliche und höchst kreative Gesellen. Sie sind liebenswert, sensibel, witzig, frech und ehrlich. Okay, manche sind laut und fordernd. Andere eher ruhig und verschlossen. Mal geht es ihnen »voll super«, mal sind sie mies drauf. Auf jeden Fall bringen sie Schwung in die Bude und katapultieren uns aus unserer emotionalen Komfortzone. Und das ist gut so. Sie bereichern damit nämlich unser Leben. Und wer in der Lage ist, selbstkritisch und humorvoll sein eigenes Verhalten unter die Lupe zu nehmen, wird es im Umgang mit Teenagern viel leichter haben.
»Mama, chill mal!« Genau! Bleiben Sie entspannt. Jugendliche sind keine Monster, Kakteen oder Stinkstiefel. Sie »haben gerade Pubertät«, mehr nicht. Und Sie als Eltern sind bestens dazu geeignet, Ihren Kindern jetzt beizustehen.
Fröhlich reifen Wie sich Ihr Kind in der Pubertät entwickelt
»Hilfe – mein Kind kommt in die Pubertät!« Denken Sie das auch manchmal? Vermutlich, denn Sie halten ja gerade dieses Buch in der Hand. Es ist eine gute Idee, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, bevor die Wellen über einem zusammenschlagen.
Was Sie aber nicht zu haben brauchen, ist Angst. Weder vor der Mutation Ihres Kindes zu einer Art Monster. Noch davor, zu versagen. Wenn Sie es bis jetzt geschafft haben, Ihrem Kind eine zuverlässige Mutter zu sein, dann kann auch jetzt eigentlich nichts mehr schiefgehen. Denn die Grundlage, die Sie geschaffen haben, wird Ihrem Kind helfen, gut durch die Pubertät zu kommen. Ihre Saat wird Früchte tragen. Darauf können Sie vertrauen.
Starten Sie also fröhlich und wohlgemut in die Pubertät Ihres Kindes. Machen Sie sich von Anfang an klar, dass es nicht darum geht, Fehler zu vermeiden oder Probleme zu verhindern. Sondern darum, sich auf die Pubertät des Kindes einzulassen. Dazu gehört u. a.:
• die Pubertät des Kindes als wichtigen (nicht nur lästigen!) Lebensprozess zu würdigen;
• die Pubertät als besonders intensive Lebensphase zu akzeptieren, in der sich alle Familienmitglieder »bewegen« müssen;
• bereit zu sein, sich in gewissem Maße mit sich selbst, den eigenen Gefühlen, Werten und Bedürfnissen zu beschäftigen;
• wiederholt und geduldig zu versuchen, das pubertierende Kind zu sehen und zu »lesen«.
Um einen Jugendlichen und sein Verhalten besser verstehen (»lesen«) zu können, ist es hilfreich, sich bewusst zu machen, was er gerade alles so durchmacht – physisch, psychisch, mental, emotional und überhaupt. Darum geht es in diesem Kapitel. Denn: Wissen hilft, Verständnis und Mitgefühl zu entwickeln.
Hormone! Wenn der Körper macht, was er will
Pubertät ist bekanntlich, wenn die Eltern peinlich werden. Sie ist aber in erster Linie der Lebensabschnitt, in der sich das Kind langsam zum Erwachsenen entwickelt und dabei viele verschiedene Entwicklungsaufgaben zu bewältigen hat. In der Wissenschaft bezeichnet man die Pubertät als den Teil der Adoleszenz, in dem die Geschlechtsreifung erfolgt. Rein biologisch betrachtet geht es also darum, dass das Kind fortpflanzungsfähig wird. Das hört sich simpel an, ist aber in Wirklichkeit ein hochkomplexes Geschehen, das hier nur grob skizziert werden soll.
Alles beginnt im Kopf, genauer gesagt im Gehirn: Der Hypothalamus im Zwischenhirn, der als oberste Steuerungszentrale des menschlichen Hormonsystems fungiert, beginnt nämlich bereits einige Jahre vor der Pubertät, das Protein Kisspeptin zu produzieren. Damit wird der Körper in die Lage versetzt, den Prozess der Geschlechtsreifung in Gang zu setzen. Kisspeptin wiederum bewirkt die Ausschüttung des sogenannten Gonadotropin-Releasing-Hormons, das seinerseits in der Hypophyse (Hirnanhangdrüse) dafür sorgt, dass zwei weitere Hormone produziert werden: das sogenannte luteinisierende Hormon (LH) sowie das follikelstimulierende Hormon (FSH). Diese Hormone gelangen dann in den Blutkreislauf und regen in den jeweiligen Keimdrüsen, den Hoden bzw. den Eierstöcken, die geschlechtliche Reifung an. Sie initiieren einerseits die Produktion von Samen- und Eizellen, sorgen aber auch dafür, dass vermehrt Sexualhormone gebildet und ausgeschüttet werden.
Im Körper des Jungen ist das vor allem das Testosteron, im Körper des Mädchens das Östrogen. Diese Geschlechtshormone werden durch das Blut im Körper verteilt und sorgen hinfort für die körperlichen Veränderungen, die das Kind ab jetzt durchmacht.
Meistens geht der eigentlichen Pubertät ein heftiger Wachstumsschub voraus: Das Kind schießt plötzlich in die Höhe, besonders Arme und Beine wachsen schnell und deutlich. Oft passen dann die körperlichen Proportionen nicht mehr so recht zueinander: Der Junge wirkt schmächtig und schlaksig. Manche Mädchen schießen ebenfalls in die Höhe und wirken hager, andere wiederum entwickeln zunächst ein bisschen »Babyspeck«. Beides ist kein Grund zur Sorge und gleicht sich mit der Zeit wieder aus, kann aber für den betroffenen Teenager durchaus mit Leidensdruck verbunden sein – vor allem, wenn er sich dazu »dumme Kommentare« anhören muss. Hier ist Zurückhaltung gefragt, auch seitens der Eltern!
Östrogen und seine Folgen: Was im Körper des Mädchens passiert
• Nach dem Startschuss durch die Geschlechtshormone beginnen beim Mädchen zunächst die Milchdrüsen und dadurch die Brust zu wachsen. »Knospung« nennt man es, wenn sich zunächst die Brustwarze verdickt und manchmal druck- und schmerzempfindlich wird. Die meisten Mädchen sind heutzutage so um die 10 Jahre alt, wenn das passiert. Etwa mit 15 oder 16 ist die Brust ausgewachsen.
• Die Figur wird langsam weiblicher: Am Bauch, an den Beinen und an der Hüfte lagert sich aufgrund des ausgeschütteten Östrogens Fett ab.
• Auch die inneren Geschlechtsorgane verändern sich langsam: Die Gebärmutter wächst, die Scheidenwand verdickt sich. Die ersten Eizellen reifen heran, das Mädchen kann harmlosen, hellen Ausfluss bekommen (Weißfluss).
• Die Schamhaare beginnen zu sprießen, zunächst spärlich, dann dichter im Schambereich, etwas später auch in den Achselhöhlen.
• Etwa im Alter zwischen 11 und 16 hat das Mädchen zum ersten Mal seine Menstruation, man nennt das Menarche. Auch wenn in dieser frühen Phase oft noch kein Eisprung stattfindet, so markiert dieser wichtige Einschnitt im Leben eines Mädchens seine beginnende Fruchtbarkeit: Es könnte ab jetzt schwanger werden.
• Die geschlechtliche Reifung des Mädchens beginnt im Allgemeinen etwa mit 10 und ist etwa mit dem 18. Lebensjahr abgeschlossen.
Testosteron und Co.: Was im Körper des Jungen passiert
• Bei Jungen bewirkt der erhöhte Testosteronspiegel im Blut das Wachstum des Hoden, der Nebenhoden, des Penis, der Prostata und der Samenleiter.
• Auch beim Jungen wachsen bald Haare, zunächst im Schambereich, etwas später unter den Achseln und auf der Brust. Zuletzt setzt der Bartwuchs ein, der zunächst als Flaum erscheint und manchmal erst nach Jahren dichter wird.
• Das ausgeschüttete Testosteron lässt den Kehlkopf des Jungen wachsen, der »Adamsapfel« entsteht.
• Die Stimmbänder werden länger und dicker. Da sie nun weniger schwingen, wird die Stimme tiefer. Allerdings wachsen die Stimmbänder nicht immer gleichmäßig, so dass die Stimme unkontrollierbar zwischen hoch und tief schwankt und manchmal krächzend oder piepsend ist: Der Stimmbruch ist da!
• Das Testosteron sorgt auch dafür, dass der Junge nun kräftiger wird, da er Muskelmasse aufbaut, und dass seine Gesichtszüge männlicher werden.
• Auch wird der Penis des Jungen nun häufiger steif, oft nachts, aber leider auch in höchst unpassenden Situationen, ganz ohne eigenes Zutun. Das passiert, weil der Körper physiologisch übt. Das kann den Jungen durchaus gelegentlich stören oder ihm peinlich sein.
• Der erste Samenerguss, auch Spermarche genannt, geschieht überraschend und unwillkürlich, oft nachts im Schlaf. Das ist weder zu kontrollieren noch zu verhindern und von daher manchmal auch etwas unheimlich. Oft findet er im 13. oder 14. Lebensjahr statt, manchmal aber auch erheblich früher oder später. Oft sind die ersten Ejakulationen noch ohne Spermien, da diese noch gar nicht produziert wurden.
• Die geschlechtliche Entwicklung des Jungen beginnt im Allgemeinen etwa mit 12 und ist etwa mit dem 20. Lebensjahr abgeschlossen.
Alles klar und echt verwirrt: Aufklärung ist mehr als Nachhilfe in Bio
Auch wenn sich diese körperlichen Veränderungen schön sachlich beschreiben lassen, so können sie Kinder gehörig irritieren. Teenager sind oft überrascht, wenn sie das erste Schamhaar entdecken oder plötzlich von sexuellen Fantasien und Bedürfnissen überrollt werden. Umso wichtiger ist es, dass Jugendliche gründlich aufgeklärt sind, bevor es so richtig losgeht.
• Erzählen Sie Ihrem Kind rechtzeitig und relativ genau, was in nächster Zeit mit seinem Körper geschehen wird.
Wenn Sie das selbst mit Scham erfüllt, so ist das eher normal als merkwürdig: Wir alle schließlich haben unsere Schamgrenzen, die es zu respektieren gilt. Trotzdem sollten Sie mit Ihrem Kind sprechen – auch wenn es Ihnen schwerfällt.
• Sprechen Sie aber nicht nur über biologische Fakten, sondern auch über ungewohnte Gefühle, die jetzt auftreten können.
Erklären Sie Ihrem Kind, dass es normal ist, wenn es angenehme Gefühle wie Lust, Freude oder Stolz empfinden wird; aber dass auch unangenehme Gefühle wie Sorge, Traurigkeit oder ein unklares Unwohlsein hochkommen können. Betonen Sie, dass alle diese Gefühle normal und erlaubt sind.
Jugendliche reagieren auf die körperlichen und psychischen Veränderungen trotz guter Aufklärung manchmal irritiert. Die erste Menstruation kommt – trotz aller theoretischen Vorbereitungen – doch irgendwie überraschend. Das kann ein Mädchen verwirren. Manche sind stolz, endlich »eine Frau zu sein«, manche haben Bauchschmerzen und fühlen sich nicht gut, andere wiederum haben ein diffuses merkwürdiges Gefühl von Fremdheit dem eigenen Körper gegenüber. Und einige haben von alldem ein bisschen. Seien Sie also nicht überrascht, wenn ein Mädchen, das gerade seine Tage bekommen hat, weinerlich und anhänglich wirkt, also eher regressiv reagiert. Das ist eine typische Folge, wenn große Entwicklungsschritte anstehen. Gehen Sie mit solchen Reaktionen verständnisvoll und gelassen um, damit Ihre Tochter sich sicher und geborgen fühlt.
Ein Junge wird vielleicht nicht von seinem ersten Samenerguss berichten, so dass es hier oft schwieriger ist, konkret darauf zu reagieren. Deshalb ist es besonders wichtig, ihm rechtzeitig zu vermitteln, dass es normal ist, unwillkürliche Erektionen und Ejakulationen zu bekommen. Es gibt Männer, die als (unaufgeklärte) Jungen fürchteten, an einer schlimmen Krankheit zu leiden, nachdem sie ihre erste Ejakulation erlebt hatten. Solche Ängste sollte man Kindern und Jugendlichen unbedingt ersparen.
Schön wäre es natürlich, wenn sich der Vater dieses Themas annehmen würde, in Form eines offenen Vater-Sohn-Gespräches. In der Realität drücken sich leider manche Männer davor: Sie sind selber von ihren Vätern nicht aufgeklärt worden und wissen nicht, wie sie es anstellen sollen. Das ist verständlich. Umso löblicher wäre es, trotzdem einen Versuch zu starten. Selbst wenn das Gespräch holprig ausfallen sollte und der Sohn peinlich berührt raunzt: »Papa! Das weiß ich doch schon alles!«, so stellt sich der Vater doch immerhin als männlicher Ansprechpartner zur Verfügung. Und allein das ist schon Gold wert!
Es ist übrigens durchaus auch hilfreich, zuzugeben, dass man selber Scham empfindet, denn das entlastet auch den Teenager. Eine Prise Humor kann natürlich auch nicht schaden!
Voll peinlich: Sexualität und Scham
Viele Grundschulkinder haben schon Erfahrungen mit Selbstbefriedigung und anderen sexuellen Experimenten gemacht, oft unbemerkt von den Eltern. Das ist entwicklungspsychologisch betrachtet vollkommen gesund. Es kann dabei auch zu gleichgeschlechtlichen sexuellen Spielereien gekommen sein, ohne dass das irgendetwas über die spätere geschlechtliche Ausrichtung aussagt. Erste Schwärmereien, etwa für Popstars, kommen in diesem Alter ebenfalls schon vor und können durchaus als sehr intensiv bis leidvoll erlebt werden.
In der Pubertät nun steht der Jugendliche vor der Aufgabe, seine kindliche Sexualität in eine Erwachsenensexualität zu überführen. Daher kommt es während der Pubertät zu einer Intensivierung und Veränderung der Sexualität. Die ausgeschwemmten Hormone beflügeln erotische Fantasien, was für Mädchen und Jungen anfangs oft gleichermaßen reizvoll wie verwirrend ist. Auch homoerotische Fantasien kommen häufig vor, was besonders Jungen verunsichern kann. Die Vorstellung, möglicherweise schwul zu sein, ist immer noch mit Ressentiments und Angst verknüpft, zumal Jungen sich kaum trauen, mit anderen Jungen oder ihren Vätern darüber zu sprechen.
Insgesamt gilt: Je freier und unbefangener der Teenager im Kindesalter mit seinem eigenen Körper umgehen konnte und je körperfreundlicher die Erziehung bisher war, desto weniger Gewissensbisse wird der Jugendliche haben, wenn er erotische Fantasien hat oder sich selbst befriedigt. Eltern tun nun gut daran, den Teenager damit in Ruhe zu lassen, seine Intimsphäre zu respektieren und ihn auf keinen Fall zu kontrollieren.
Auch das andere Geschlecht wird nun zunehmend interessant, es wird geflirtet, der Teenager testet seine Wirkung aus, bis es dann irgendwann zum ersten Kuss und mehr kommt. Dass das eine besonders aufregende Zeit ist, wissen Sie noch aus Ihrer eigenen Jugendzeit. Hoffen und Bangen, der erste herzzerreißende Liebeskummer, die Sorge, dem bzw. der Auserwählten womöglich nicht zu gefallen, Konkurrenz und Eifersüchteleien – all damit hat der Jugendliche nun erstmals in größerem Ausmaß zu tun. Das macht Stress, manchmal positiven, manchmal unangenehmen. Und manchmal ist das dann der Grund dafür, die Schule zu vernachlässigen und sich leidenschaftlich den eigenen Stimmungen und Sehnsüchten hinzugeben.
Auch Scham spielt in der Pubertät eine große Rolle. Die Bedeutung dieses Gefühls wird häufig unterschätzt. Scham berührt sehr viele Aspekte unseres Lebens, in besonderer Weise aber die eigene Körperlichkeit. Der Teenager wird sich seines sich verändernden Körpers bewusst: Er fühlt sich manchmal darin noch unvertraut und entwickelt ein neues oder ausgeprägteres Schamgefühl. Selbst wenn Sie bisher in der Familie sehr freizügig mit Körperlichkeit und Nacktheit umgegangen sind, so kann es sein, dass sich das Kind plötzlich ins Badezimmer einschließt und sich ab jetzt konsequent nicht mehr »oben und unten ohne« blicken lässt. Nicht mal Mama darf mehr rein. Basta. Und das ist gut so. Wenn Jugendliche ihre Schamgefühle ernst nehmen und klare Grenzen setzen, schützen sie damit ihre Intimsphäre. Das ist ein wichtiger Entwicklungsschritt in Richtung Selbstständigkeit. Lange waren es die Eltern, die das Kind in seiner körperlichen Integrität geschützt haben. Nun muss der Jugendliche lernen, es selbst zu tun.
Die Scham eines Kindes hat also keinesfalls etwas mit Verklemmtheit zu tun, sondern mit einer gesunden Haltung dem eigenen verletzlichen Körper und der ebenso verletzlichen Seele gegenüber. Indem Ihr Teenager seine Intimsphäre schützt, grenzt er sich auf gesunde Weise ab. Diese Form der Abgrenzung sollten Sie unbedingt respektieren!
Let’s talk about sex! Und warum das manchmal schwierig ist
Man möchte meinen, wir lebten in einer Gesellschaft, in der Sex kein wirkliches Tabu mehr sei: Überall hängen Plakate mit nackten Frauen herum, in Zeitschriften und Internet findet man Infos und Sex-Tipps. Pornos sind problemlos online zu ordern, es gibt Sexualkunde in der Schule usw. Die Jugend scheint so gut aufgeklärt zu sein wie noch nie eine Jugendgeneration zuvor.
Das stimmt. Einerseits. Andererseits haben diverse Untersuchungen zutage befördert, dass heutige Teenager sowohl erstaunlich große Wissenslücken als auch oft unrealistische Vorstellungen von Sexualität haben. Sex mit einem Partner bzw. einer Partnerin ist nicht immer leicht, leidenschaftlich und berauschend, wie es in Werbung und Filmen oft suggeriert wird. Sexualität zwischen zwei Menschen kann besonders in jungen Jahren enttäuschend oder kompliziert sein. Schließlich braucht es ein gewisses »Feintuning«, wenn Menschen sich sexuell begegnen. Und wie soll das funktionieren, wenn man noch nicht mal genau weiß, wie es überhaupt genau geht? Das gemeinsame Entdecken der Sexualität erfordert viel gegenseitigen Respekt und Geduld. Woher weiß ich, was sie/er will? Mache ich alles richtig? Bin ich begehrenswert? Mag der/die andere mich wirklich so, wie ich bin?
Viele Jungen empfinden Leistungsdruck, weil sie souverän wirken und potent sein wollen. Wenn das dann nicht klappt, erleben sie das als Beschämung. Mädchen haben oft ambivalente Gefühle und Sorgen, nicht schlank oder sexy genug zu sein. Angesichts der überall präsenten schönen und dünnen Models fürchten sie, dass der Liebste sie mit diesen vergleichen könnte. Lust auf Sexualität und Angst vor Beschämung und Kränkung sind hier oft miteinander vermischt.
Mit all diesen Gefühlen, Bedürfnissen und Sorgen müssen die Teenager umgehen lernen. Das ist ganz schön viel auf einmal!
Mag es vielen Eltern noch leichtfallen, das Kind über die körperlichen Veränderungen in der Pubertät zu informieren, so haben viele echte Hemmungen, mit dem Kind über Sexualität zu reden. Die Tatsache, dass auch Kinder oft schamvoll mit diesem Thema umgehen und es mit dem Satz: »Ich weiß doch eh’ schon alles!« abwehren, macht das Ganze auch nicht leichter.
Viele Jugendliche wollen nicht über ihr Sexualleben reden – und das ist völlig in Ordnung so. Denn abgesehen davon, dass das eine sehr intime Angelegenheit ist, beginnt der Teenager doch gerade erst, sich von Ihnen abzulösen, sich aus seinem Kindsein und seiner Abhängigkeit zu befreien. Da wäre es doch ein Rückschritt, sich mit diesem heiklen Thema an seine Eltern zu wenden. Eher vertrauen sie sich ihren Freundinnen oder Freunden an, lesen Dr. Sommer in der »Bravo« oder googlen sich die Finger wund.
Erwarten Sie also nicht, dass Ihr Teenager Ihnen irgendetwas von seinen erotischen Fantasien oder gar sexuellen Handlungen erzählt. Ihr Kind hat auch hier ein Recht auf seine Intimsphäre. Stellen Sie auch keine indiskreten Fragen, die Ihren Sohn oder Ihre Tochter in Verlegenheit bringen.
Kurz und kompakt: Was jetzt wichtig ist
• Vermitteln Sie Ihrem Kind, dass es sich mit Fragen an Sie wenden kann. Sagen Sie ihm das aber auch nur, wenn Sie es ehrlich meinen.
• Stellen Sie Ihrem Kind seriöse Informationsquellen zur Verfügung, z. B. Bücher oder das unten genannte kostenlose Infomaterial der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung – besonders wenn das Thema Sie überfordert oder Ihr Kind nicht mit Ihnen sprechen will.
• Finden Sie eine gelassene Haltung dazu, dass Ihr Kind jetzt verstärkt sexuell mit sich selbst (und später auch mit anderen) experimentiert. Wenn Ihnen das schwerfällt, versuchen Sie herauszufinden, woran das liegt: War die Entdeckung Ihrer eigenen Sexualität womöglich belastet? Was sind Ihre Sorgen? Haben Sie selber Enttäuschungen erlebt und wollen Ihr Kind davor schützen? Versuchen Sie unbedingt, die eigenen Erfahrungen nicht auf Ihr Kind zu übertragen. Ihr Kind muss einen gewissen Freiraum für eigene (sexuelle) Erfahrungen haben.
• Weisen Sie Ihre Tochter bzw. Ihren Sohn auf die Notwendigkeit von Verhütungsmitteln hin und fragen Sie immer mal wieder nach, ob diese jetzt langsam nötig werden.
• Klären Sie Ihr Kind über Aids und andere Geschlechtskrankheiten auf, und zwar ohne ihm Angst zu machen. Schließlich soll Ihr Teenager seine Sexualität möglichst angstfrei ausprobieren können. Schutzmaßnahmen erklären: Ja! – Panikmache? Nein!
Literaturtipp: Auf den Internetseiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (www.bzga.de) können Sie unter dem Menüpunkt »Infomaterialien« eine 79-seitige Broschüre zu dem Thema: »Über Sexualität reden. Die Zeit der Pubertät« kostenlos bestellen oder herunterladen. Es gibt dort auch informative und kostenlose Broschüren für Jungen und Mädchen rund um das Thema Sexualität.
Die Baustelle unter der Schädeldecke: Ist der Stirnlappen schuld?
Bis vor ein paar Jahren war man der Überzeugung, dass ausschließlich Hormone an dem merkwürdigen Verhalten von Jugendlichen schuld seien. Doch dann machten Forscher die Entdeckung, dass sich das Hirn eines Jugendlichen in einem gigantischen Umbauprozess befindet. Ebenso wie dies bereits in der sehr frühen Kindheit geschieht, verdickt sich nun die graue Substanz des Gehirns. Millionen neuronaler Verbindungen werden neu geknüpft, Millionen andere wiederum verschwinden. Diejenigen Nervenbahnen, die vom Jugendlichen häufig benutzt werden, avancieren zu einer Art »Datenautobahn«, auf der die Informationen blitzschnell weitergeleitet werden. Das bedeutet, dass Jugendliche nun genauso schnell denken können wie Erwachsene. Mindestens.
Andere Nervenverbindungen, die weniger oder gar nicht genutzt werden, werden hingegen stillgelegt. Viele Fachleute gehen davon aus, dass das Gehirn in diesen Wachstumsphasen besonders lern- und aufnahmefähig, aber auch besonders anfällig ist, etwa für die Entwicklung psychischer Erkrankungen.
Dieser kolossale Umbauprozess umfasst das gesamte Gehirn des Jugendlichen. Allerdings findet er regional zeitversetzt statt, die Hirnreifung vollzieht sich sozusagen von hinten nach vorn: Zunächst werden nämlich die Hirnteile umgebaut, die für die Kontrolle der Bewegungen, die Wahrnehmung, die Orientierung und die Sprache benötigt werden. Der Stirnlappen hingegen, der sich im Frontalhirn befindet, ist offensichtlich das Hirnareal, das als Letztes ausreift. Das ist insofern interessant, als der Stirnlappen (auch präfrontaler Cortex genannt) als oberstes Steuerungs- und Kontrollorgan des Gehirns gilt. In diesem Teil der Großhirnrinde werden Signale aus der Außenwelt mit bereits gespeicherten Gedächtnisinhalten abgeglichen. Und hier wird auch nach einer angemessenen Handlungsmöglichkeit gesucht. Etwas verkürzt kann man also behaupten, dass der Stirnlappen die Instanz im Gehirn ist, die Affekte reguliert, Impulse steuert und vorausschauendes Denken und Handeln ermöglicht. Man schreibt dem präfrontalen Cortex auch eine wichtige Analyse- und Überwachungsfunktion zu.
So hat man bei Menschen, deren präfrontaler Cortex beschädigt war, unter anderem festgestellt, dass sie Schwierigkeiten hatten, Probleme zu analysieren, die Konsequenzen ihres Handelns einzuschätzen sowie aus Fehlern zu lernen. Auf der Basis dieser Erkenntnisse gehen Wissenschaftler mittlerweile davon aus, dass Jugendliche aufgrund eines mangelhaft funktionierenden präfrontalen Cortexes oft irrational und affektgesteuert agieren. Der unreife präfrontale Cortex des Teenagers beantwortet also die Frage »Schlage ich jetzt zu oder gehe ich weg?« oder »Mache ich jetzt Hausaufgaben oder was Schönes?« möglicherweise anders als der reife präfrontale Cortex eines Erwachsenen.
Einige Wissenschaftler vermuten zudem, dass Teenager bei der Verarbeitung von Emotionen auf einen anderen Teil ihres Gehirnes zurückgreifen. In einer Studie, bei der den Fotos von wütenden, lachenden, ärgerlichen und aggressiven Gesichtern die entsprechenden Emotionen zugeordnet werden sollten, stellte sich heraus, dass bei Jugendlichen hier die sogenannte Amygdala arbeitete, die als Teil des limbischen Systems für die Verarbeitung von Gefühlen zuständig ist, während Erwachsene für ihre Einschätzung den frontalen Cortex nutzten. Teenager können offensichtlich Gefühle nicht richtig einschätzen, sondern reagieren sehr impulsiv darauf.1
Hirnforscher gehen davon aus, dass es im Gehirn des Teenagers zu einer Art Ungleichgewicht kommt: Während der Stirnlappen noch nicht vollständig ausgereift ist, arbeitet das limbische, also das emotionale System auf Hochtouren: Der Teenager verhält sich daher oft nicht umsichtig, vorausschauend oder einigermaßen »vernünftig«, sondern schlicht »kopflos« und irrational.
Weiterhin hat man festgestellt, dass das sogenannte Belohnungssystem im Gehirn des Jugendlichen anders funktioniert als bei Kindern oder Erwachsenen: Nach Erfolgserlebnissen wird normalerweise der Botenstoff Dopamin ausgeschüttet, was Zufriedenheits- oder Glücksgefühle auslöst. Zuständig für diese Dopaminausschüttung ist der sogenannte Nucleus accumbens, der im Vorderhirn liegt. Forscher gehen davon aus, dass auch der Nucleus accumbens bei Teenagern oft nicht »richtig« funktioniert: Entweder es wird zu wenig Dopamin ausgeschüttet, dann funktioniert das Belohnungssystem nicht richtig und der Teenager erlebt keine Glücksgefühle. Oder es wird dort zu viel ausgeschüttet, dann ist der Teenager vom Dopamin bereits überschwemmt und es fehlt ihm der Anreiz, das körpereigene Belohnungssystem anzukurbeln. Wissenschaftler haben so die These aufgestellt, dass Jugendliche deshalb mehr »thrill« als Erwachsene brauchen, um Glücksgefühle erleben zu können. Das könnte erklären, warum Teenager manchmal zu hochriskantem Verhalten neigen, Drogen und Alkohol konsumieren, liebend gerne Achterbahn fahren und Horrorfilme gucken: Manche brauchen offensichtlich ein Maximum an Stimulation, um das körpereigene Belohnungssystem in Gang zu setzen.
Auch das merkwürdige Schlafverhalten von Jugendlichen ist mittlerweile durch hirnorganische Besonderheiten erklärt worden: So wird das Schlafhormon Melatonin bei Teenagern mit ein bis zwei Stunden Verspätung ausgeschüttet. Deshalb kommen Teenager so spät ins Bett und morgens kaum aus demselben wieder heraus.
Doch machen wir uns nichts vor: Die Hirnforschung steht trotz neuartiger Forschungsmethoden immer noch ganz am Anfang. So sind viele hirnorganische Prozesse in ihrer Bedeutung für die Entstehung von psychischen Erkrankungen noch weitgehend unklar bzw. umstritten. Einig sind sich die Forscher immerhin in der Ansicht, dass die äußeren Lebenseinflüsse die Formung des Gehirns maßgeblich mitentscheiden. Wie genau das geschieht, weiß man allerdings nicht.