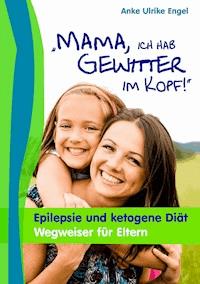
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Die Diagnose Epilepsie verändert mit einem Schlag das ganze Leben der betroffenen Familien. Was bedeutet das alles für uns und unser Kinde? Im ersten Teil dieses Buches werden von der Diagnose, über Behandlungsmöglichkeiten bis hin zu sozialrechtlichen Fragestellungen alle Themen angesprochen, die für Eltern nun wichtig sind. Im zweiten Teil führt dieses Buch übersichtlich und leicht verständlich in die Grundlagen der ketogenen Ernährung ein. Es beantwortet in einzigartiger Weise Fragen von Familien, die vor oder während einer ketogenen Diät auftauchen. Die ketogene Diät ist eine sehr fettreiche, streng kohlenhydrat- und eiweißlimitierte Form der Ernährung. Allen Varianten der ketogenen Therapie ist gemeinsam, dass sie den Fastenstoffwechsel nachahmen. Schon seit Jahrzehnten ist sie eine schulmedizinisch etablierte Behandlungsoption bei schwer einstellbaren Epilepsien und wird im Rahmen der Epilepsiebehandlung in vielen Kliniken angeboten. Für alle interessierten Familien und auch zur Unterstützung während der Durchführung ist dieses Buch das passende Standardwerk.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Kinder Maximilian und Paul.
INHALT
V
ORWORT
U
NSERE
G
ESCHICHTE
K
APITEL
1
E
PILEPSIE IM
K
INDESALTER
U
RSACHEN DER
E
PILEPSIE
AUSLÖSENDE
F
AKTOREN
D
IE
D
IAGNOSE
E
INORDNUNG
& K
LASSIFIKATION
E
IN
A
NFALL IST NOCH KEINE
E
PILEPSIE
E
PILEPSIESYNDROME IM
K
INDESALTER
E
PILEPSIESYNDROME IM
J
UGENDALTER
D
IE
A
RZTWAHL
M
EDIKAMENTÖSE
E
INSTELLUNG
W
EITERE
B
EHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN
K
RANKHEITSBEWÄLTIGUNG
E
PILEPSIE IM
A
LLTAG
S
CHULE
& K
INDERGARTEN
K
APITEL
2
D
IE KETOGENE
D
IÄT
A
N DIESER
S
TELLE
: E
IN
W
ORT VORAB!
W
AS IST DIE KETOGENE
D
IÄT?
G
ESCHICHTE DER KETOGENEN
D
IÄT
A
NWENDUNGSFELDER DER KETOGENEN
D
IÄT
I
ST UNSERE
E
PILEPSIE THERAPIERESISTENT?
W
IRKUNG DER KETOGENEN
D
IÄT
T
YPISCHE
M
ISSVERSTÄNDNISSE
V
ORAUSSETZUNGEN FÜR DIE
D
URCHFÜHRUNG
K
ETOGENE
D
IÄT:
JA
ODER
NEIN?
E
INFÜHRUNG UND
E
INSTELLUNG DER
D
IÄT
Ü
BERWACHUNG DER KETOGENEN
D
IÄT
„
F
EINTUNING“ DER KETOGENEN
D
IÄT
E
RFOLGSBEWERTUNG DER KETOGENEN
D
IÄT
W
IE
S
IE
I
HR KIND FÜR DIE
D
IÄT GEWINNEN
GUTE
V
ORBEREITUNG IST HALBER
E
RFOLG
!
KLEINE UND GROßE
H
ERAUSFORDERUNGEN
MCT-F
ETT IN DER KETOGENEN
D
IÄT
A
LTERNATIVE
: M
ODIFIZIERTE
A
TKINS
D
IÄT
V
OR
-
UND
N
ACHTEILE IM
V
ERGLEICH
H
ÄUFIGE
F
RAGEN ZUR KETOGENE
D
IÄT
D
ER
A
USSTIEG AUS DER KETOGENEN
D
IÄT
Z
U
G
UTER LETZT
…
B
EZUGSQUELLEN
K
ETOGENE
D
IÄT
L
ITERATURVERZEICHNIS
VORWORT
„Beachte immer, dass nichts bleibt, wie es ist und denke daran, dass die Natur immer wieder ihre Formen wechselt.“ (Marc Aurel)
Diagnose Epilepsie! Manchmal verändert ein Moment das ganze Leben. So, als ob es einem den Boden unter den Füßen wegreißt…Unser jüngster, bis dahin völlig gesund geglaubter, Sohn erhielt im Alter von zwei Jahren die für uns niederschmetternde Diagnose: Epilepsie! Es begann eine sehr schwere Zeit für uns. Wir mussten hilflos mit ansehen, wie es unserem Kind immer schlechter ging. Alles Bemühen einer medikamentösen Einstellung führte nicht wie erhofft zur Anfallsfreiheit. Gleichzeitig wurden die Vorwürfe, Vorurteile und Widerstände aus dem sozialen Umfeld immer unerträglicher und wirkliche Hilfestellung fanden wir weder für unser Kind, noch für uns als Familie. Nachdem wir uns nahezu allein durch diese Zeit gekämpft haben und viele Herausforderungen am Ende doch erfolgreich bewältigen konnten, war es mir ein großes Anliegen alle Erfahrungen in einem Buch zusammen zu tragen und damit ein Werk zu schaffen, das betroffenen Eltern dabei helfen kann, mit der Krankheit umzugehen, sie anzunehmen und den Weg durch das Labyrinth zu meistern, das mit der Diagnose Epilepsie vor ihnen liegt. Ein Stück weit soll dieses Buch auch unsere Geschichte erzählen. Sie soll Hoffnung geben und Mut machen, neue Wege zu gehen, Widerstände zu überwinden und für die Rechte des eigenen Kindes zu kämpfen. In diesem Buch wird darauf verzichtet, zu sehr in die Klassifikation der kindlichen Epilepsieformen und -syndrome einzutauchen. Sicher sind Sie bereits in mitten der Diagnosestellung für Ihr Kind angelangt, oder haben diese bereits hinter sich gebracht. Die nachfolgenden Kapitel sollen vielmehr eine Hilfestellung für die Zeit nach der Diagnosestellung sein und sich mit den Herausforderungen beschäftigen, die eine solche Diagnose mit sich bringt. Insbesondere wird auf die ketogene Diät als mögliche Behandlungsform der Epilepsie eingegangen. Im Anhang dieses Buches finden Sie eine Sammlung von Kontaktadressen und Internetseiten zum Thema Epilepsie und der ketogenen Diät als Behandlungsform.
Alles Gute für Sie und Ihr Kind!
UNSEREGESCHICHTE
„Der Sonne Licht, es hellt den Tag, nach finsterer Nacht.“
Im Sommer 2010 erhielten wir für unseren jüngsten Sohn, der damals zwei Jahre alt war, die Diagnose Epilepsie. Wir, das sind Mama, Papa, zwei bis dahin völlig gesunde Kinder und Labrador Corry, beide Elternteile Vollzeit berufstätig, gerade die Finanzierung für ein Haus unterzeichnet und kurz vor Baubeginn – und dann diese Diagnose: plötzlich steht das eigene Leben still, das ganze Lebenskonzept wird in Frage gestellt, alles droht zu zerbrechenWir wissen heute, dass Paul schon im Alter von etwa 6 Monaten die ersten Anfälle hatte - wir deuteten diese leider viel zu lange als Erschrecken. Paul zuckte bei Berührung zusammen, schleuderte mit Kopf und Oberkörper nach vorne. Bereits im Alter von einem Jahr wurde dies für uns so auffällig, dass wir zum wiederholten Mal den Kinderarzt bei der Vorsorge darauf ansprachen. Doch dieser beruhigte uns damit, dass Paul eben ein wenig schreckhaft und sensibel sei und so ignorierten wir unsere Angst - es war ja schön zu hören, dass mit dem eigenen Kind alles in Ordnung ist. Die Situation verschlimmerte sich allerdings zunehmend und so äußerten wir zur Vorsorgeuntersuchung im Alter von zwei Jahren erstmals laut den Verdacht, dass Paul Epilepsie haben könnte. Wir bestanden auf eine neurologische Untersuchung! Die Wartezeit auf einen Termin beim Facharzt war lang und so kam das Schicksal dazwischen, bevor eine fachärztliche Untersuchung stattfinden konnte. Mitte September stürzte Paul sehr schwer aufgrund eines Anfalls von der Terrasse mit einem nachfolgenden Klinikaufenthalt von zwei Wochen. Paul ging es in dieser Zeit sehr schlecht. Die Schwellung am Kopf war heftig und die Anfälle erreichten ihren ersten Höhepunkt. Ich konnte den Kleinen nicht mehr aus den Augen lassen – ständig stürzte er aufgrund der Anfälle, immer wieder schlug er heftig auf den Vorderkopf. Die ganze Sache hatte nur ein Gutes: endlich sahen die Ärzte diese Anfälle und die Diagnostik begann. Erst ein Schlaf-Entzugs-EEG brachte Gewissheit über die Form der Epilepsie. Paul litt an einer benignen myoklonischen Epilepsie des Kindesalters. Eine gutartige Form, wie man uns sagte. „Glück gehabt“, dachten wir, "eine gutartige Form der Epilepsie, die sich wahrscheinlich in einigen Jahren verwächst. Kein Grund zur Sorge." Weit gefehlt, denn nur wenige Wochen später erkannten wir, trotz – oder gerade wegen – der Medikamente, unser eigenes Kind nicht wieder und hatten allen Grund zur Sorge: der Kleine wurde mittlerweile täglich von mehr als 100 Anfällen heimgesucht. Paul konnte keine fünf Meter mehr alleine laufen, ohne dass er stütze und jeder Sturz auf den Kopf löste wiederum Serien von Anfällen aus. Er konnte nicht mehr essen, ohne dass er sich die Gabel in den Mund oder ins Auge rammte, er konnte nicht mehr aus dem Glas trinken, ohne dass er sich unter einem Anfall das Wasser über die Brust schüttete. Er konnte nicht mehr klettern, toben oder Laufrad fahren. Auch das Einschlafen wurde für ihn bald zur Qual, denn er hatte viele Anfälle, die ihn ständig wieder aufweckten. Seine geliebten Bilderbücher schauten wir kaum noch an, denn dies löste ebenfalls Anfälle aus.
Um Paul vor schweren Verletzungen zu schützen, trug er von da an einen Helm und die Medikamente wurden weiter aufdosiert. Entsprechend weinerlich und ängstlich, aber auch aggressiv war unser kleiner Sonnenschein geworden. Das Sprechen ging immer mehr zurück und Pauls Entwicklung stagnierte sichtbar. Die Zahl der Anfälle stieg noch weiter an und auch die Heftigkeit nahm noch weiter zu. Was Nebenwirkung der Medikation und was Folge der Erkrankung war, konnte uns niemand sagen. Neben der Sorge um das Kind, sahen wir uns plötzlich mit vielen weiteren Problemen konfrontiert. Da wir immer öfter aufgrund Pauls schlechter Verfassung nicht zur Arbeit konnten, traten berufliche Probleme in unser Leben. Vollzeitjob als Unternehmensberaterin und so viele Krankenhausaufenthalte - das ging nicht zusammen. Bald stellte sich auch der Kindergarten quer und kündigte trotz der genehmigten Einzelintegrationshilfe den Betreuungsplatz für Paul auf. Von da an musste ich mich von der Arbeit freistellen lassen und so kamen auch noch finanziellen Sorgen hinzu. Zu allem Überfluss begegneten unserem kleinen Engel auch immer mehr soziale Ausgrenzung und Vorurteile. „Den mit dem Helm!“ wollte plötzlich niemand mehr zum Spielen einladen. Die ganze Situation ließ ein normales Leben kaum noch zu und führte uns an unsere Belastungsgrenze. Am Ende fragten wir uns, was für Paul und auch für uns als Familie an dieser Epilepsie eigentlich noch als gutartig bezeichnet werden konnte! Die Versuche der medikamentösen Einstellung mit Keppra mussten wir also als gescheitert betrachten. Uns war klar: nun würde der Teufelskreis des weiteren Ausprobierens einer Reihe anderer Medikamente beginnen – immer in der Hoffnung, Anfallsfreiheit zu erreichen. Uns war klar, dass wir das nicht wollten. Aus meinem Studium war mir der Film „Solange es Hoffnung gibt“ bekannt, an den ich mich plötzlich erinnerte. Er handelt von einem Kind, das bei schwer einstellbarer Epilepsie mit der ketogenen Diät behandelt und am Ende anfallsfrei wird. Ich machte mich an die Recherchearbeit, verbrachte Stunden in der Unibibliothek, um mich zu informieren. Am Ende war klar, dass dies unser Weg sein sollte und so entschieden wir uns für einen Therapieversuch mit der ketogenen Diät. Wir lösten mit dieser Entscheidung einigen Gegenwind aus, denn Paul galt noch nicht im Sinne der geltenden Definition als Patient mit pharmakoresistenter Epilepsie und die Standardbehandlung sah etwas anderes vor. Zu aufwendig und eine Zumutung für Kind und Familie sei diese Diät. Wir sollen uns doch zum Wohle unseres Kindes auf die Behandlung mit gut etablierten Antiepileptika konzentrieren.
Wir setzten die Entscheidung zur Diät trotz aller Widerstände durch! Wir fanden in der Filderklinik bei Stuttgart Gehör und die Bereitschaft, die Behandlung mit der ketogenen Diät für Paul zu unterstützen. Nach dem ersten ambulanten Vorstellungstermin in der Klinik schlichen wir nach Rücksprache mit dem behandelnden Neurologen die Medikation langsam aus. Im Frühling 2011 wurde Paul in der Filderklinik auf die ketogene Diät eingestellt. Eine neue Zeit voller Hoffnung brach für uns an. Der Start war natürlich nicht ganz einfach, aber schnell zeichneten sich erste Erfolge ab. Im Verlauf von einigen Wochen nahm die Zahl und Intensität der Anfälle immer weiter ab. Paul stürzte nicht mehr, und so konnten wir endlich auf den Helm verzichten. Nach vier Monaten war Paul anfallsfrei. Auch in der Entwicklung holte er wieder auf. Im neuen Kindergarten begegnete man Paul ohne Vorbehalte und begleitete die ketogene Diät sehr gewissenhaft. Die liebevolle Betreuung und die vielen neuen Freunde ließen unser Kind wieder aufblühen. In unendlicher Dankbarkeit durften wir mit ansehen, wie unser kleiner Sonnenschein das Lachen wiederfand. Heute, vier Jahre nach Diätbeginn, blicken wir auf eine Zeit zurück, die uns in jeder Hinsicht bereichert hat. Unser Kind ist altersgerecht entwickelt. Alle Defizite konnte Paul dank der zahlreichen Unterstützung aufholen. Das EEG ist sauber, keine Anfälle seit fast zwei Jahren, keine erhöhte Anfallsbereitschaft mehr nachweisbar. Die Epilepsie hat ihn freigegeben. Wir haben unser Kind zurück! Unser Kind ist gesund - zurück im Leben! Kurz vor Erscheinen dieses Buches haben wir die ketogene Diät beendet – das Therapieziel ist erreicht.
Uns ist es mit der Diät stets gut gegangen. Alle kleinen und großen Schwierigkeiten konnten wir überwinden. Paul war in jeder Hinsicht noch nie so gesund, wie unter der ketogenen Diät. Unser größter Respekt gilt unserem Sohn, der die Diät stets toll akzeptiert und mit großer Disziplin durchgehalten hat. Wir haben die ketogene Diät geschafft – und das trotz voller Berufstätigkeit. Wir würden die Entscheidung für die Diät jederzeit genau so wieder treffen und möchten mit diesem Buch anderen Eltern Mut machen, neue Wege zu gehen. Wir hätten durchaus auch länger „durchgehalten“. Sicher hilft die ketogene Diät nicht allen epilepsiekranken Kindern - dies gilt aber ebenso für die Medikamente! Sicher ist die Diät ein Mehraufwand – für uns rechtfertigte jedoch die Hoffnung auf Anfallsfreiheit jeden Mehraufwand der Welt! Die ketogene Diät - eine nicht zumutbare Belastung für Kind und Familie? Sicher ist sie eine Belastung. Aber sind die Gabe von unzähligen Medikamenten, die damit einhergehenden Verhaltensänderungen beim Kind, die möglichen organischen Schädigungen durch die Nebenwirkungen, die unzähligen Anfälle und Krankenhausaufenthalte, sowie die soziale Ausgrenzung nicht ebenso riesige Belastungen? In jedem Fall kann die ketogene Diät als Behandlungsoption eine große Chance eröffnen, die Sie ergreifen dürfen. Zu verlieren haben Sie nichts – nur zu gewinnen! Paul ist nun schon 2 Jahre ohne ketogene Diät. Die Anfälle sind nicht zurückgekehrt. Wir durften in den letzten Jahren viel lernen: über unser Kind, über uns selbst. Unser größter Dank gilt der Filderklinik: für die schönen Aufenthalte, die Anregungen, das Konfrontieren mit uns selbst, die liebevolle Begleitung und das „Lehren von griechisch, als wir mit unserem Latein am Ende waren“.
KAPITEL 1 EPILEPSIE IM KINDESALTER
WWW.PIXELIO.DE © BY MARTINAN
URSACHEN DER EPILEPSIE
Damit epileptische Anfälle auftreten, muss eine dauerhaft vorliegende Übererregbarkeit der Hirnnervenzellen vorliegen, was man als chronische Anfallsbereitschaft bezeichnet. Diese Anfallsbereitschaft ist meist auf EEG-Ableitungen sehr gut zu erkennen und beruht auf Veränderungen in Bau und Funktion der Nervenzellen, insbesondere der Zellwände und ihrer Ionenkanäle. Auch eine falsche Funktionsweise im Stoffwechsel der Zelle oder die mangelnde Verfügbarkeit besonderer Substanzen für die Erregungsübertragung, können Grund für die Fehlfunktionen sein. Wie man sich vorstellen kann, sind die Ursachen für das Vorliegen solcher Veränderungen sehr vielschichtig und komplex. So können ungünstige erbliche Anlagen, altersgebundene Reifungsvorgänge im kindlichen Gehirn, grundlegende hirnorganische Störungen und akute Sinnesreize eine überschießende Nervenzellerregungen und damit den epileptischen Anfall bei einer Epilepsie auslösen. Oft spielen einzelne dieser Bedingungsfaktoren zusammen, weshalb die Findung einer Ursache für die Epilepsie oft einem Puzzlespiel gleicht. Besonders da auch bestimmte Stoffwechselerkrankungen gelegentlich neben anderen Krankheitserscheinungen auch zu einer Epilepsie führen können. Wichtig ist es außerdem, die beobachteten Anfälle als zerebralen Krampfanfall zu identifizieren und von anderen nicht epileptischen Anfallsarten, wie zum Beispiel anfallsartigen Kreislaufstörungen, der kindlichen Nachtangst, Affektkrämpfen oder psychisch bedingten anfallsartigen Verhaltensstörungen, zu differenzieren. Zerebrale Anfälle treten als Symptom einer Epilepsie in sehr verschiedenen Formen auf. Somit lassen sich zahlreiche epileptische Syndrome (Zusammenfassung bestimmter Symptome) benennen. Nachfolgend soll auf diese nicht im Detail eingegangen werden, da dieses Buch einen anderen Schwerpunkt setzt. Die Komplexität des Krankheitsbildes legt den Schluss nahe, dass man sich bei Verdacht auf Vorliegen einer Epilepsie gezielt an Fachärzte, Epilepsiezentren oder Fachzentren wenden sollte, die in der Diagnosestellung im Kindesalter die passende fachliche Kompetenz aufweisen.
EEG (Elektroenzephalografie)
Ein Verfahren zur Messung der Hirnaktivität mittels Darstellung der Hirnströme. Das EEG ist eine relativ kostengünstige, mit wenig Aufwand verbundene, Untersuchungsmethode und ein Standardinstrument in der Neurologie.
AUSLÖSENDEFAKTOREN
Mit der Diagnose Epilepsie verändert sich oft einiges im Leben der kleinen Patienten. Ein geregelter Tagesablauf mit ausreichend Schlaf ist in jedem Fall ratsam, da Müdigkeit das Auftreten epileptischer Anfälle begünstigt. Ebenso können fieberhafte Infekte die Anfallsbereitschaft erhöhen – Fieberkrämpfe sind wohl die bekannteste Form epileptischer Anfälle im Kleinkindesalter. Kinder, die unter sogenannten Reflexepilepsien leiden, reagieren auf einzelne alltägliche Sinnesreize mit zerebralen Anfällen. Diese Reize lösen durch die Anregung besonders überempfindlicher Nervenzellverbände zerebrale Anfälle als eine Art automatisierte Reaktion (Reflex) auf den Reiz aus. Häufig können optische Reize anfallsauslösende Wirkung haben. Ebenso bekannt ist auch das Auslösen von Anfällen durch akustische, haptische, taktile oder Angst auslösende Reize. Einige Eltern berichten von ähnlichen Beobachtungen das Autofahren oder das Vorlesen von Büchern betreffend. Bestimmte Tätigkeiten, wie Rechnen oder Schreiben, können ebenfalls epileptische Anfälle auslösen. Auch psychische und körperliche Belastungen und hormonelle Umstellungen in der Pubertät können zeitweise Anfälle begünstigen. Medikamente, die das zentrale Nervensystem anregen, bei Kindern z.B. Imipramin gegen Bettnässen oder Theophylin bei Asthma, können ebenfalls Anfälle bewirken.
DIEDIAGNOSE
„Eine der verbreitetsten Krankheiten ist die Diagnose“. Karl Kraus
Mit der Diagnose Epilepsie stehen viele Eltern häufig ganz unerwartet vor einer völlig neuen Situation. Von einem auf den anderen Tag müssen sie sich damit auseinandersetzen, was es bedeutet, ein krankes Kind zu haben. Wiegt nicht schon allein die Sorge um das Kind schwer genug, so kommen oft ganz neue Probleme aus dem sozialen Umfeld auf die Familien zu. Auch wenn sich die Epilepsie einreiht in eine ganze Reihe anderer schwerwiegender Diagnosestellungen, erfordert diese Erkrankung wiederum ein neues Auseinandersetzen mit einigen Themen. Epilepsie ist eine der häufigsten Erkrankungen des zentralen Nervensystems im Kindesalter. Bis eine genaue Diagnose feststeht ist es meist ein weiter Weg. Zunächst beobachten die Eltern eine Auffälligkeit bei ihrem Kind und tragen diese im ersten Schritt als Sorge zum betreuenden Kinderarzt. Oft genug berichten betroffene Eltern, dass sie dort zunächst nicht wirkliches Gehör finden und die beobachteten Auffälligkeiten nicht ernst genug genommen werden. Als Eltern sind Sie auf jeden Fall die ersten Experten bei der Beobachtung Ihres Kindes. Ein Festhalten der vermuteten Auffälligkeit per Video kann hilfreich sein - auch für die spätere genaue Abgrenzung des epileptischen Syndroms, ist jedoch oft durch die Unvorhersehbarkeit des Auftretens für die Eltern nur schwer zu leisten. Bleiben Sie deshalb auf jeden Fall hartnäckig, wenn sie das Gefühl haben, dass mit ihrem Kind etwas nicht stimmt. Epileptische Anfälle können ganz leise ablaufen und werden oft erst spät als solche erkannt. Gerade die früher als „kleine Anfälle“ bezeichneten Anfallsformen, wie Absencen oder Myoklonien, werden gerne als Verträumtheit oder Erschrecken fehlgedeutet. Bestehen Sie bei Verdacht auf Krampfanfälle auf eine EEG-Untersuchung bei einem erfahrenen Neuropädiater. Diese ermöglicht den Nachweis erhöhter Anfallsbereitschaft oder typischer epileptischer EEG-Muster, welche bei Vorkommen auch die Form der Epilepsie genauer beschreiben lassen. Neben dem Wach-EEG, das unter voller Aufmerksamkeit des Kindes abgeleitet wird, stehen als diagnostische Instrumente noch das Schlaf-EEG, sowie das Schlafentzugs-EEG zur Verfügung. Letzeres wird unter Schlafentzug abgeleitet (d.h. nach langem Wachhalten des Kindes). Mit dem so herbeigeführten Schlafmangel möchte man das Gehirn provozieren, da unter Schlafmangel typischerweise eher epileptische Anfälle auftreten. Ebenso gibt es Epilepsieformen, die nur im Schlaf auftreten und deshalb auch oft nur im Schlag-EEG nachgewiesen werden können. Neben diesen kurzen Ableitungen, die in der Regel ca. 20-30 Minuten dauern, besteht noch die Möglichkeit einer Langzeitableitung mit einem mobilen Gerät, die unter bestimmten diagnostischen Fragestellungen eingesetzt wird. Diese Langzeitableitungen nennt man Monitoring (oft 24 Stunden), die meist auch von Videoaufnahmen unterstützt werden, um sich ein Anfallsgeschehen genau anzusehen. Vor einer EEG-Untersuchung brauchen Sie und Ihr Kind sich nicht zu sorgen, denn sie ist schmerzlos, nur etwas geduldfordernd. Gerade bei jüngeren Kindern ist es eine Herausforderung, da diese möglichst ruhig liegen bleiben müssen. Nach Auswertung der EEG-Ergebnisse wird entschieden, ob die Einstellung auf ein Medikament erforderlich ist. Dies hängt neben den hirnelektrischen Aktivitäten, die man auf dem EEG sehen kann, auch von der echten Anfallssituation ab. Einige Kinder haben Anfälle, auch bei unauffälligem EEG. Andere wiederum haben keine oder nur wenig Anfälle, obwohl das EEG pathologisch ist. Man behandelt in der Regel keine EEG-Befunde, sondern die dazugehörigen Kinder. Das will heißen, dass die Experten stets genau abwägen, ob und wenn ja in welcher Form, die Epilepsie behandlungsbedürftig ist. Im Zweifel macht es oft Sinn, das Kind in einem speziellen Epilepsiezentrum oder einer Epilepsieambulanz vorzustellen. Neben dem EEG besteht die Möglichkeit einer MRT-Untersuchung, die dazu dient eventuelle hirnorganische Schädigungen oder Veränderungen als Ursache der Epilepsie zu diagnostizieren. Die MRT-Untersuchung muss unter Umständen unter Narkose durchgeführt werden, da diese in der engen Röhre nicht alleine liegen bleiben würden. Ob eine Narkose notwendig ist, hängt jedoch vom Kind, dessen Alter und Verhalten ab. Auch eine Blut- und Stoffwechseldiagnostik, sowie genetische Untersuchungen, können herangezogen werden um eine genaue Diagnosestellung zu ermöglichen. Die Differenzialdiagnostik zu nicht epileptischen Anfällen kann notwendig werden.
WWW.PIXELIO.DE © BY ANDREAS ZÖLLIK





























