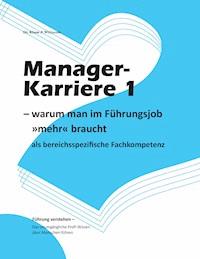
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Manager-Karriere
- Sprache: Deutsch
Wer viel leistet, bekommt oft bald Führungsaufgaben übertragen und macht Karriere. Eine Manager-Karriere, das Weiterkommen auf dem Karrierepfad bis hin in Toppositionen wird erheblich bestimmt von der jeweils geeigneten und passenden Führungskompetenz. Nicht selten bekommt man eine Führungsposition angetragen, obgleich man selbst noch gar nicht damit gerechnet hat. Das Dilemma ist dann weitergehend ein Aufgabenfeld, das anders als bisher nicht mehr bereichsspezifisch fachlich ist, vielmehr neue Talente erfordert wie das Denken in Zusammenhängen und den Umgang mit Mehrdeutigkeit und Komplexität – und dies bis ins obere Management. Immer hat man es mit Menschen zu tun. Die geforderten Managerfähigkeiten lassen sich von Grund auf weder rezeptartig noch »on the job« quasi nebenbei lernen oder entwickeln. Zwischenmenschliches Verhalten ist nämlich großenteils unbewusst. Immerhin besser wahrzunehmen, welche Fakten Relevanz besitzen, auf die man folglich achtsam sein muss, das lehren und schärfen wissenschaftlich und praxistaugliche »Verstehensmodelle«. Hinzu kommt die authentische Umsetzung und Anwendung in der Managementpraxis. Dieses Lern- und Übungsbuch - als Ratgeber und Trainings-leitfaden – eröffnet ein besseres Verstehen management- relevanter Phänomene fokussiert auf Menschen-führen. Es wendet sich an »Schlüssel«-Personen in Unternehmen, welche mit dem innerhalb ihres Berufslebens entwicklungsspezifischen Orientierungsmuster »Aufwärtsmobilität« beruflich eine Manager-Karriere erstreben. Es ist das Buch, das lebendiges Profi-Wissen bietet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Ausgangslage - Für wen ist dieses Buch nützlich und lesens-wert?
Manager-Karriere . . im Führungsjob »gut« sein :
warum man im Führungsjob »mehr« braucht als bereichsspezifische Fachkompetenz
Wer viel leistet, bekommt oft bald Führungsaufgaben übertragen und macht Karriere. Eine Manager-Karriere ist indes keine Frage von Glück oder Beziehungen, das Weiterkommen auf dem Karrierepfad bis hin in Toppositionen wird vielmehr bestimmt von der jeweils geeigneten und passenden Führungskompetenz. Führungskräfte stehen heute besonderen Ansprüchen gegenüber. Sie werden »schneller« als in früheren Zeiten mit dieser Position, Aufgabe und Verantwortung betraut. Dies bezieht sich erstens auf den Einstieg in die Führungsarbeit, wobei man vielfach nicht mehr ein bestimmtes Lebensalter oder spezifische Erfahrungen voraussetzt. Zweitens betrifft dies die eigene Entscheidungssituation zu dieser Aufgabe. Eine Führungsposition wird oftmals offeriert, obgleich man selbst noch gar nicht damit gerechnet hat, trotzdem nimmt man die damit einhergehende Anerkennung und das Zutrauen zur Kenntnis und stellt sich der Verantwortung - oft mit der Haltung, “das Unternehmen wird sich schon etwas dabei gedacht haben“.
Das Dilemma ist indessen, dass so Führungskräfte in eine Managementposition kommen, obschon sie für die Führung nicht ausgebildet sind. Die vorhandene und bisher erforderliche Qualifikation resultiert eher aus Fach-Wissen und dem Können auf einem jeweiligen fachlichsachlichen Arbeitsfeld. Das Handlungsfeld eines Managers ist nicht mehr fachlich, es fordert das Denken in Strukturen und Zusammenhängen und den Umgang mit Unbestimmtheit und Komplexität. Management erfordert mithin andere Talente. Angesichts mehrdeutiger Ziele bietet Manager-Sein die Kompetenzerfahrung, unter solch anspruchsvollen Bedingungen sich als handlungsfähig zu erleben, den gegebenen und absehbaren Anforderungen gewachsen zu sein. Im Umgang mit Mitarbeitern tritt hinzu, dass Führungskräfte bestimmen, mit welcher Stimmung, Laune und Selbstwertgefühl Mitarbeiter ihre Arbeit tun und in ihrem Zuhause Stimmung, Laune und Selbstwertgefühl prägen. »Gute« Führung schafft einen Rahmen, eine Welt, der man angehören möchte und in der Mitarbeiter ihre Begabungen und Fähigkeiten entwickeln und wachsen lassen können.
Eine weitverbreitete Ansicht bezüglich spezifischer Kompetenzen, die notwendig sind, um einen Führungsjob »gut« zu machen und erfolgreiche Arbeit als Führungskraft zu leisten, ist, »gut« managen sei allein eine Frage der Persönlichkeit, die Kompetenzen seien mithin »von Natur aus« bereits vorhanden sind und deshalb nicht lernbar. Wesentlich sei der Wille zur Dominanz, Macht und Einfluss als notwendiges Streben, Einfluss auf die Umgebung zu nehmen. Weil solche quasi angeborenen Talente rar sind, wird ein »gut« ausgeübter Führungsjob mit Achtung, Ansehen, Status und Prestige als erstrebten Begleitumständen belohnt, hohe Managereinkommen gelten geradezu als symbolische Messgröße für Kompetenz und Leistungserfolg. Die andere anzutreffende Auffassung ist, Managerfähigkeiten könne und müsse man sich “on the job“ erarbeiten und entwickeln “so quasi nebenbei“ - ein Ding der Unmöglichkeit. Dies läuft darauf hinaus, dass jegliche Führungskompetenzentwicklung in das Belieben der einzelnen Mitarbeiter gelegt ist. Als Führungskraft ist man dann so auf sich alleine gestellt. Schließlich kursiert die Ansicht, eine Führungsausbildung bestehe ohnehin größtenteils aus Selbstverständlichkeiten, ja Binsenweisheiten und sei deshalb entbehrlich. Nachdenkliche, um sich besorgte Führungskräfte räumen immerhin ein, dass sie sich in ihrer Führerrolle eher »durchwursteln« statt führen.
Führungskräfte sollen vor allem für das stete Funktionieren der Unternehmung sorgen und zudem Wegbereiter der Unternehmungszukunft sein. Sie müssen ihren eigenen jeweiligen Beitrag für die Resultate der Unternehmung definieren, und weil sie Führungskräfte sind, müssen sie auch bestimmen und dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter in diesem Sinne für die Unternehmung handeln. Bezugsgrößen und Erfolgsfaktoren beim »Managen« sind deshalb immer die Themen: Richtung geben – Gefolgschaft erzeugen – für Veränderung begeistern.
Die fundamental wichtige Frage ist folglich, wie lässt sich persönliche Führungskompetenz selbstständig und effizient entwickeln. “Führen kann man nicht lernen – Führen ist lernen“. Diese Aussage enthält ein Führungsverständnis, dass es im Management und beim Führen nicht genügt, sich rezeptartig anzuwendende Führungstechniken anzueignen. Im Umgang mit Anderen merkt man, dass man nicht so einfach sein Verhalten ver-ändern kann, ohne als Voraussetzung dafür «sich selbst» als Person zu verändern. Um im kommunikativen und emotionalen Bereich an Kompetenz zuzunehmen, muss zunächst eine erhöhte Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion aufgebaut werden. Denn wenn ich mein Verhalten zu anderen Menschen »optimieren« möchte, muss ich zunächst einmal wissen, wie ich mich verhalte und warum. Was ich wirklich tue, weiß ich indessen nur zu einem Bruchteil; das liegt daran, dass ein großer Bereich des menschlichen Handelns unbewusst geschieht und sich damit der Wahrnehmung und der bewussten Selbstreflexion entzieht. Das gilt auch für die Haltungen, Einstellungen und Werte einer Führungskraft und daraus resultierende Konzepte und Vorstellungen, an denen sich das Interaktionsverhalten - und damit das konkrete Führungshandeln - orientiert: das Menschenbild, das Selbstbild, das Selbstverständnis als Führungskraft, Vorstellungen zu Bedingungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, Annahmen über die Bedeutung der eigenen Person für eine erfolgswirksame Unternehmenskultur, Ansichten darüber, wie Mitarbeiter motiviert werden müssen, Auffassungen über die Relevanz von Zielorientierung, Führungsinstrumenten, der Wirkung des persönlichen Kommunikationsverhaltens etc. Mit dem Wissen, dass man viele Aspekte der Interaktion zwischen sich und anderen Menschen nicht selbstverständlich wahrnimmt und schon gar nicht reflektiert, ist es naheliegend, sich genau dies verstärkt vorzunehmen. Bedauerlicherweise können wir nur das achtsam wahrnehmen und reflektieren, was für uns bedeutsam erscheint. Unumgänglich sind, um zu entscheiden, ob bestimmte Daten Relevanz haben, folglich neue oder besser geeignete »Verstehensmodelle«, die das jeweils bisher gelebte Realitätsmodell erweitern.
Zusätzlich geht es natürlich auch um konkretes, kognitives Lernen und Erlernen bezogen auf Themen wie: Führungsinstrumente, Organisationsentwicklung, Führen mit Kenndaten, das Gestalten und Weiterentwickeln von Unternehmenskulturen, Leiten und Moderieren von Gruppenprozessen, Gesprächsführung, Konfliktmanagement, Changemanagement, Projektmanagement, Arbeitsorganisation, Mitarbeiterbeurteilung und -entwicklung und vieles mehr. Aber auch wenn diese Themen hauptsächlich mit dem Erwerb von Wissen zu tun haben, so müssen die konkreten Wege der Umsetzung und alle Instrumente und Techniken auch zur Persönlichkeit passen und in den konkret-individuellen Kommunikations- und Führungsstil integriert werden.
Viele Führungsseminare und eine große Anzahl von Managementratgebern sind deshalb nicht hilfreich, weil sie sich auf Verhaltenstechniken beziehen. Hinzu kommt, dass sie in ihrer Verallgemeinerung die individuelle Realität der Führungskraft unberücksichtigt lassen und damit reduzieren und die Führungskraft mit dem doppelten Transferproblem alleine lassen. Doppelt, denn erstens müssen die neuen Betrachtungen auf die persönliche Führungsrealität »angepasst« werden und zweitens müssen die neuen Verhaltensstrategien und das damit einher-gehende konkrete Verhalten, um authentisch zu sein, in die Persönlichkeit der Führungskraft - bzw. ihr Selbstbild - integriert werden.
Das heißt aber nicht, dass man eine kognitive Auseinandersetzung mit Theorien, Konzepten und Modellen nicht braucht - im Gegenteil. Selbstverständlich muss eine Führungskraft sich mit praxistauglichen »Verstehensmodellen« aus der Kommunikationstheorie, Führungsstilen, -techniken usw. auch theoretisch auseinandergesetzt haben. Führen ist ein eigenes Wissensgebiet - wie jedes andere Fachgebiet auch. In der Führungsrolle kann nur glaubwürdig sein, wer zumindest die Grundlagen gestalterischen Einwirkens kennt und einen Überblick über Ansätze, Ergebnisse und kritische Bewertungen der Führungsforschung hat. Sonst bleibt jedes Führungshandeln und Führungs-Erfolg ein unsicheres Unterfangen.
“Manager-Karriere . . – warum man im Führungsjob »mehr« braucht als bereichsspezifische Fachkompetenz“ - will das Lern- und Übungsbuch zum Thema Management und Menschenführen sein - zum Studium, als Ratgeber und Trainingsleitfaden - für Menschen mit dem innerhalb ihres Berufslebens entwicklungsspezifischen Orientierungsmuster »Aufwärtsmobilität« und einer entsprechend erstrebten Karriere. Es präsentiert die Führungsthematik dem Praktiker, - sei er noch Mitarbeiter, zeitbegrenzt Projektteamleiter oder gestandener Chef - das unumgängliche taugliche ProfiWissen - die ‘basics‘ - für den Beruf als Führungskraft. Dieses Basiswissen umfasst aus Forschung und Lehre gewonnene »Verstehensmodelle« und führungsbezogene Erkenntnisse mit einer Bewertung ihrer Tauglichkeit für die reale Führungspraxis.
Ein anderes Entwicklungsmuster gilt zum Beispiel für den Mitarbeitertyp, der die Herausforderung eines Spezialgebietes besonders schätzt. Die berufliche Orientierung ist die Fachkarriere, die Expertenlaufbahn und erscheint besonders dann als erstrebenswert, wenn sie sich innerhalb des Spezialgebietes vollzieht mit möglichst wenigen gänzlich »fachfremden« Aufgaben. Weitere Karriereanker für mögliche Karrierepfade können »Varietät« in horizontaler Entwicklungsrichtung sein, funktions- bzw. bereichsübergreifende Kompetenz, »Autonomie« gepaart mit hoher Engagementbereitschaft, einsetzbare Kreativität.
Das Orientierungsmuster »Aufwärtsmobilität« lässt einen deutlichen Bezug zu persönlichen und dementsprechenden Bedürfnis- bzw. Motivstrukturen erkennen. Damit einhergehende Karrierepfade äußern sich vorrangig in dem Wunsch, Führungsrollen zu übernehmen. Diese erfordern neben interpersoneller Kompetenz und analytischen Fähigkeiten die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung, geht es doch gerade vielfach darum, Gruppenprozesse zu lenken sowie Problemlagen zu identifizieren, zu analysieren und situationsspezifische Lösungen zustande zu bringen.
Kurzbeschreibung der Themen je Kapitel
Im 1. Kapitel - Führung und Führungsverhalten - werden Grundfragen und bereits mehrere Aufgaben gestellt: warum es der Führung als »personaler« Management-Funktion bedarf, dass Führung in Organisationen sich stets in einer konkreten Situation abspielt und deshalb von Rahmenparametern mitgeprägt wird, wie in einer Führungsbeziehung die Führer- und Geführtenrolle entsteht, dass die Interaktion wohl wechselseitig, wenngleich zumindest temporär asymmetrisch ist, und was beim Führungsverhalten als sozial akzeptierter Verhaltensbeeinflussung den Führungserfolg ausmacht.
Im 2. Kapitel - Motive des Individuums und Motivation - geht es um die Ausrichtung einer Führungsbeziehung. Da das Verhalten der Geführten zielgerichtet beeinflusst werden soll, ist ein intensiver Einblick in die Beweggründe menschlichen Handelns angebracht. Dieses menschliche Verhalten ist auf Motive zurückführbar und ist auf Ziele orientiert. Führung ist darauf angewiesen, dass die Beteiligten ihre Aufgaben mit Schwung und Begeisterung erfüllen, das heißt fähig, motiviert und willens sind.
Ein besonderes Augenmerk gilt der inhaltlichen Beschreibung einzelner Motive. Motivierende Führungsbeziehungen sollen ja produktive Effekte haben, die indes vielfach als unzureichend angesehen werden. Oftmals wird einem einfachen Menschenbild folgend an der monetären »Motivationsschraube« gedreht. Eine Fülle empirischer Befunde belegt, dass Geld kein nachhaltiger Motivator ist und sich zudem als höchst ungeeignet erweist, Mitarbeiter zu einem besseren Problemlösen oder gar zu einem kreativeren Verhalten zu animieren. Die Erforschung angestrebter Zielzustände, motivinhaltlicher Strukturen und kognitiver Prozesse hat verdeutlicht, dass die Motivation an einen Faktor gebunden ist, der sehr gut mit dem Stichwort der »intrinsisch motivierenden Tätigkeit« überschrieben werden kann. Hinzu kommen der Arbeit förderliche Rahmenbedingungen und Respekt vor dem arbeitenden Menschen. Wer sich hiervon »freikaufen« möchte, handelt nicht nur unter ethischen Gesichtspunkten bedenklich, sondern verschenkt Leistungsvorteile.
Motivation ist alltäglich beobachtbar, ist aber nicht einfach zu erklären und noch schwieriger zu prognostizieren. Dennoch sind wir in der Lage, diesen Prozess annäherungsweise zu verstehen, und Führungskräfte können motivierendes Verhalten trainieren.
Die jeweiligen Abschnitte des Kapitels geben der Führungsperson führungspraktische Anleitungen mit einer Auswahl besonders beachtenswerter Verhaltensvorschläge: wie sie Leistungsmotivierte erkennt, welche Führungsmittel die Leistung erhöhen und welche Zufriedenheit bewirken, wie der Vorgesetzte den geistig ablaufenden Motivationsprozess beim Mitarbeiter und schließlich noch den Willensakt positiv beeinflussen kann.
Das 3. Kapitel - Zusammenarbeit, Gruppeneffekte und Gruppendynamik - widmet sich der Alltagssituation, dass Führungsbeziehungen sich in den seltensten Fällen auf eine Führungsdyade beschränken. Für die Führung einer Mehrzahl von Geführten ergibt sich deshalb die Frage nach den führungsbezogenen Besonderheiten. Der Leser gewinnt Einsichten - auch anhand gestellter Übungsaufgaben - in das Zustandekommen der Gruppe, die häufig unterschätzten Effizienz- und Motivationseffekte und gruppentypische soziale Positionen in der Gruppe. Da Gruppeneffekte unabhängig von den Wünschen des Vorgesetzten, also emergent auftreten, kommt es darauf an, ihre positiven Wirkungen zu unterstützen und ihre negativen klug abzuschwächen. Der Umgang mit typischen Rollen in einer Gruppe ist hierzu ein gutes Übungsfeld. Erkenntnisse über die Eigenheiten von Gruppen sind heute speziell hilfreich, da gruppenorientierte Arbeitsformen quantitativ zunehmen und Teamarbeit sich als erfolgreich erweist. In Organisationen firmieren - besonders eng - zusammenarbeitende Gruppen unter dem Begriff »Team«.
o
Inhaltliche Gliederung
Die Ausgangslage - für wen ist dieses Buch nützlich und lesens-wert?
Kurzbeschreibung der Themen je Kapitel
Kapitel 1: Führung und Führungsverhalten
1 Führung als »personale« Management-Funktion
1.1 Menschen-führen im Gefüge von Managementprozessen
1.2 Warum und wozu braucht man Führung überhaupt?
1.3 Führung steuert und lenkt Sachleistungen
1.4 Sachaspekt und personaler Aspekt des Managements
1.5 Führung mobilisiert menschliche Leistungspotenziale
1.6 Führungsdefinitionen
2 Führung in Organisationen
2.1 Referenzrahmen für Analyse und Beschreibung der Führung in Organisationen
2.2 Systemisch-strukturelle Führung
2.3 Wechselwirkungen zwischen struktureller und personaler Führung
2.4 Methodenarsenal der Handlungsbeeinflussung in/von Organisationen in einer Zusammenschau
2.5 Führung durch Menschen
3 Führungsverhalten
3.1 Charakteristika des Führungsverhaltens
3.2 Erklärungsansätze zum Führungsphänomen
3.3 Attribute der Prägung des Führungsverhaltens
3.4 Messung des Führungserfolgs
Kapitel 2: Motive des Individuums und Motivation
4 Psychologische Grundlagen der Motivation
4.1 Persönliches Wollen: Motive und Motivation
4.2 Motivanalyse
4.3 Primäre und sekundäre Motivation
4.4 Werte und Einstellungen
4.5 Nicht-motivationale Verhaltenseinflüsse
4.6 Motivkonflikte
4.7 Frustration und Abwehrmechanismen
5 Inhaltliche Klassifikation angestrebter Zielzustände
5.1 Kompetenzmotiv
5.2 Kontaktmotiv
5.3 Leistungsmotiv
5.4 Dominanz- bzw. Machtmotiv
5.5 Status- bzw. Prestigemotiv
5.6 Sicherheitsmotiv
5.7 Geldmotiv
6 Motivinhaltliche Strukturen
6.1 Motivations- und Führungsziele
6.2 Individuelle Arbeitsmotive
6.3 Hierarchie der Bedürfnisse
6.4 Motivation zur Aktivierung von Leistung
6.5 Motivation zum Herbeiführen von Zufriedenheit
6.6 Motivation und Menschenbild
6.7 Harmonisierung der Motivationsziele
7 Kognitive Prozesse im Motivationsablauf
7.1 Entstehung von Motivationstendenzen
7.2 Entstehung motivgeprägter Willensakte
7.3 Motivationsrelevante Bewertung von Handlungsergebnissen
8 Praktische Empfehlungen zur Gestaltung einer motivierenden Situation
Kapitel 3: Zusammenarbeit – Gruppeneffekte und Gruppendynamik
9 Die Gruppe als soziales Gebilde
9.1 Merkmale der Gruppe
9.2 Gruppenentstehung
9.3 Gruppen und Organisation
9.4 Formelle und informelle Gruppen
9.5 Kontaktformen und Gruppenstrukturen
10 Effizienz- und Motivationseffekte in Gruppen
10.1 Interaktionsprozesse der Gruppe
10.2 Gruppenzusammenhalt und Zufriedenheit
10.3 Gruppenzusammenhalt und Leistung
11 Soziale Positionen und deren Kriterien
11.1 Macht und Autorität, Quellen der Macht
11.2 Status
11.3 Gruppennormen
11.4 Rolle
Selbst – Check - Antworten
Literaturverzeichnis
Thematischer Ausblick
Kapitel 1: Führung und Führungsverhalten
Führungskräfte sollen vor allem für das stete Funktionieren der Unternehmung sorgen sowie zudem Wegbereiter der Unternehmungszukunft sein. Sie müssen ihren eigenen jeweiligen Beitrag für die Resultate der Unternehmung definieren, und weil sie Führungskräfte sind, müssen sie auch bestimmen und dafür sorgen, dass ihre Mitarbeiter in diesem Sinne für die Unternehmung handeln. Menschen führen ist mithin eine der Aufgaben der Führungskraft, des Vorgesetzten, des Managers.
Die Führung als »Phänomen« menschlichen Wirkens äußert sich im Führungsverhalten. Welches sind die Tätigkeiten eines Managers und wodurch zeichnen sie sich aus? Inwieweit stehen diese Tätigkeiten im Verhältnis zu anderen Tätigkeiten in den organisierten Gemeinschaften? Ist Führung notwendig und wie kann man sie erklären? Welche Faktoren beeinflussen das Führungsverhalten und wann ist Führung effektiv?
1 Führung als »personale« Management-Funktion
Unternehmungen sind komplexe produktive soziale Systeme, die in eine wiederum komplexe und dynamische Umwelt integriert sind und mit ihr in vielfältiger Weise in Wechselbeziehung stehen. Aus dieser engen Verflechtung zwischen Umwelt und Unternehmung ergibt sich, dass nur die Institutionen langfristig wettbewerbsfähig und bestandsfähig bleiben können, denen es gelingt, sich möglichst gut an zunehmend turbulentere Umweltentwicklungen anzupassen.
In Organisationen ist Führung kein Selbstzweck, sie soll vielmehr der Erreichung organisationaler Ziele zur Erhaltung und Stärkung der organisationalen »Fitness« (vgl. Withauer 2000, S. 8 f) dienen. Diese Ziele orientieren sich an der existenziellen Aufgabe, den Fortbestand der Organisation zu regulieren, sich den äußeren und inneren Wechsellagen anzupassen und auf Turbulenzen jedweder Art intelligent zu reagieren sowie die Entwicklungsfähigkeit tempo- und richtungsbestimmend zu kanalisieren.
Aus der Führungsforschung lassen sich drei grundsätzliche Perspektiven zur Betrachtung des Führungsphänomens identifizieren. Zum einen wird Führung als die Ausübung bestimmter Management-Funktionen aufgefasst (vgl. Withauer 1974), wobei in sachbezogene (z.B. Planung, Organisation, Kontrolle) und personenbezogene Funktionen (Menschen-führen) untergliedert wird. Der handlungsorientierte Ansatz richtet das Interesse auf die Aktivitäten der Führungskräfte und fasst diese zu beobachtbaren Management-Rollen zusammen (vgl. u.a. Mintzberg 1991), die durch empirische Beobachtung die in der Realität stärker vorhandenen kommunikativen, interpersonalen Aktivitäten im Führungshandeln belegen. Institutionell werden unter dem Begriff Management oder Führung die Personen oder Personengruppen bezeichnet, die Führungstätigkeiten bzw. -rollen wahrnehmen - die Führungskräfte.
Die nachstehenden Betrachtungen richten sich auf die Führung in Organisationen, die als gruppenstrukturierte Leistungsgemeinschaften »Betriebs«charakter oder Institutionen-Charakter besitzen. Führung ist erforderlich in Unternehmungen, Schulen, Verwaltungsbehörden, im Polizeidienst, in Kliniken, Sportvereinen. Dies muss mitgedacht werden, auch wenn im Folgenden beispielhaft in erster Linie die Führung in Unternehmungen betrachtet wird.
1.1 Menschen-führen im Gefüge von Managementprozessen
Das Kernproblem im Management besteht nach Stafford Beer und Ross Ashby darin, die für das Funktionieren der Unternehmung relevante Komplexität unter Kontrolle zu bringen. Die Autoren vergleichen hierbei die prinzipiellen Zusammenhänge zwischen der Unternehmung und ihrer Umwelt mit einem lebenden Organismus und den komplexen Einflüssen seiner Umwelt (vgl. Beer 1981, S. 270 ff; Ashby 1984, S. 282 ff).
Gleichzeitig wird das Problem Komplexität zu der zentralen Managementherausforderung. Wie Probst ausführt, ist "Komplexität ... für den Manager ein zentrales Phänomen, bedeutet Management doch weitestgehend Komplexitätsbewältigung." (Probst 1985, S. 187). Kirsch sieht dies ähnlich und stellt fest, dass "...die Handhabung komplexer Probleme die »eigentliche« Funktion einer Führung..." (Kirsch 1984, S. 308) ist, und er sieht in der Untersuchung dieser Führungsfunktion den zentralen Gegenstand der »Lehre von der Führung«. Und auch Malik äußert sich übereinstimmend: ˝Management kann man möglicherweise viel besser verstehen als das ständige Bemühen, ein sehr komplexes System unter Kontrolle zu bringen und zu halten...˝ (Malik 2015, S. 46).
Auch die Innenwelt von sozialen Systemen ist überaus komplex. Zunächst ist das interaktionelle Handeln keinesfalls kohärent und gleichgerichtet, sondern folgt verschiedenen subjektiven Intentionen. Vor allem ist die sprachliche Kommunikation als wichtigster Ausschnitt der menschlichen Interaktionen niemals eindeutig im Sinne einer deterministischen Aussage, es lassen sich bestenfalls temporär gültige Muster beschreiben, welche bezogen auf die gegebenen Randbedingungen eine gewisse Aussagefähigkeit besitzen. Dieses kaum vorhersehbare und mithin nicht fassbare menschliche Interaktionsverhalten charakterisiert humane soziale Systeme als nichtlineare dynamische Systeme. Damit gelten für diese in der Chaosforschung als »dissipative Systeme« bezeichneten Systeme die beobachteten Prozesse zur Musterbildung und -veränderung. Die sprachliche Kommunikation im Rahmen der personalen Führung ist daran wesentlich beteiligt. Dem Gedanken der Selbstorganisation folgend wirken zudem die Rahmenbedingungen prägend auf die Struktur- und Musterbildung eines Systems.
Inwieweit Unternehmungen in der Lage sind, mit dem Wandel in ihrer Umwelt und Innenwelt umzugehen, sich den äußeren und inneren Wechsellagen anzupassen und auf Turbulenzen jedweder Art intelligent zu reagieren, ist Ausdruck der Führbarkeit, und je besser dies einer Unternehmung gelingt, desto größer ist ihre »Fitness« (vgl. Withauer 2000, S. V ff). Ist überhaupt die Möglichkeit gegeben, aktiv gestaltend und lenkend in das Geschehen der Unternehmung einzugreifen? Das Erhalten bzw. Schaffen von Erfolgspotenzialen und damit verbunden die Erhaltung bzw. Verbesserung der nachhaltigen »Fitness« kann als zentrale Aufgabe des Managements gesehen werden. Die zunehmende Dynamik und Vernetzung und damit verbunden die ansteigende Komplexität machen diese strategische Entwicklungsaufgabe jedoch zunehmend schwieriger, und es ist keineswegs klar, ob überhaupt geeignete Konzepte oder Strategien verfügbar sind, welche die Absicht zu managen erfüllen können.
Eine Unternehmung führbar machen und funktionieren zu lassen ist im Kern die Aufgabe des Managements einer Unternehmung oder irgendeiner anderen Institution: und dies heißt, sie so zu gestalten, zu lenken und zu entwickeln, dass sie »unter Kontrolle ist und bleibt«. Die Lehre des Managements widmet sich der Gestaltung und Lenkung einer besonderen Kategorie dynamischer Systeme, den Unternehmungen (vgl. Ulrich 1984, S. 66). Mit »Gestalten« ist die Organisation der Strukturen und Abläufe gemeint, die Bestimmung des grundlegenden Kurses und die Festlegung von dauerhaften Regelungen und Normen, »Lenkung« ist die ständige, kontinuierliche Steuerung und Regelung aller Aktivitäten.
Der Begriff »Managementlehre« ist mit dem Ausdruck »Führungslehre« keineswegs synonym verwendbar. Während mit »Führung« zumeist der personenbezogene Aspekt als »Menschen führen« gemeint ist, der englischsprachig mit »Leadership« bezeichnet wird, fehlt dem Ausdruck Management dieser Bezug. »Gemanaged« werden nämlich nicht Menschen, sondern eher ganze Institutionen. »Management« im Sinne von H. Ulrich richtet die Perspektive auf die Gestaltung, Lenkung und Entwicklung gesellschaftlicher Institutionen. Während die Führungslehre durch ihre Hinwendung zum personalen Aspekt vorwiegend verhaltenswissenschaftlich ausgerichtet ist, wird die Managementlehre systemorientiert gedacht und verstanden.
Es wird offenkundig, dass man gleichfalls unterscheiden muss zwischen personaler Führung und Personal-Führung. Die erstgenannte Bezeichnung entspricht dem Begriff »Menschen führen« und man meint damit die intentionale unmittelbare interaktionelle Beziehung zwischen einem oder mehreren Führern und einem oder mehreren Geführten. Personal-Führung dagegen hat einen weiteren Rahmen, sie geht über den unmittelbaren Vorgesetzten-Mitarbeiter-Kontakt hinaus und erfasst auch die strukturellen Bedingungen der Zusammenarbeit, weil nicht mehr nur einzelne Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen, sondern das Personal. Sie umfasst als Aufgabenfeld die Verfügbarkeit, Nutzung, Entwicklung der humanen Ressourcen der jeweiligen Organisationsmitglieder. Der Unterschied zum Begriff »Management« ist erkennbar fließend.
1.2 Warum und wozu braucht man Führung überhaupt?
Führung erscheint als Phänomen der Alltagswelt als etwas so Selbstverständliches, dass nur selten die Frage gestellt wird, warum es Führung überhaupt gibt bzw. warum es im Zusammenleben und Zusammenwirken von Menschen der Führung schlechthin bedarf. Warum bilden sich in menschlichen Gemeinschaften Führungsstrukturen heraus, womit sind diese zu rechtfertigen und warum gibt es Führer und Geführte? Weil Führung eine soziale Tatsache ist und Alternativen zu ihr möglich und vorhanden sind, ist die Institution Führung begründungsfähig und, weil Führung systematisch mit Vorteilen und Belastungen verbunden ist und damit fundamental in die Lebenswirklichkeit von Menschen eingreift, auch begründungspflichtig. Wird nämlich begründungslos eine existierende soziale Einrichtung als bestmögliche, alternativenlose oder einzig normale, gesunde oder natürliche Gestaltungsform hingestellt, liegt Ideologieverdacht nahe (vgl. Neuberger 2002, S. 63 ff). Ideologien beschreiben nämlich nicht, was ist, sondern rechtfertigen, warum es so ist bzw. sein muss oder sein soll.
Die Begründungskonzepte für das Instrument Führung fußen auf zwei Argumentationsmustern: zum einen werden anthropologische Gegebenheiten herausgestellt, zum anderen funktionale Gründe genannt.
Die anthropologische Begründung setzt argumentativ bei den unterschiedlichen Begabungen und Bereitschaften von Personen an, andere Menschen in ihrem Handeln zu koordinieren und Problemlösungsbeiträge für Gemeinschaften zu erbringen bzw. Führungspositionen überhaupt besetzen zu wollen. Aus dieser Logik heraus bedarf es einer Führung, weil Menschen geführt werden müssen bzw. geführt werden wollen (vgl. Neuberger 2002, S. 59 f).
Aus der vorgenannt angenommenen Ungleichverteilung von Fähigkeiten und Begabungen von Menschen wird als notwendig abgeleitet, dass einige Personen die Verantwortung dafür übernehmen müssen, um ungeordnete Zustände zu vermeiden. Die Alternative zum Chaos ist in diesem Begründungszusammenhang die Hierarchie (griechisch: heilige Ordnung), was die Vorstellung impliziert, eine ungeordnete Gesellschaft sei in der Regel nicht wünschenswert.
Zum zweiten Begründungsaspekt, dass Menschen geführt werden wollen, wird argumentiert, dass die Bedürfnisstrukturen von Menschen hinsichtlich Führen und Geführt-werden verschieden sind. Die meisten Menschen haben danach das Bedürfnis, von starken Persönlichkeiten den Weg gewiesen zu bekommen und diesen nicht selbst verantworten zu müssen.
Die funktionale Begründung geht im Unterschied zur vorstehenden elitär-personalistischen Argumentation von rational-praktischen Notwendigkeiten aus: Mit steigender Größe, Komplexität und Differenzierung von Organisationen hat der Einzelne nur einen beschränkten Einblick in die Zusammenhänge und kann sein Handeln nicht mit dem Anderer wirksam koordinieren, selbst wenn er dies beabsichtigte. Zur Handlungskoordination eignen sich zwei Formen: Kooperation und Führung. Der Koordinationsmechanismus der Kooperation ist Diskussion und Konsensfindung, was prinzipiell zwischen gleichberechtigten Akteuren geschieht.
Führung löst das Koordinationsproblem durch eine asymmetrische Einflussstruktur. Die Favorisierung der Führung als bessere Koordinationsform basiert auf der Annahme, dass sie hinsichtlich Effektivität und Effizienz ein Optimum ermöglicht, das heißt von allen effektiven Koordinationsformen ist Führung die effizienteste und/oder von allen effizienten Koordinationsformen ist Führung die effektivste (vgl. Weibler 2016, S. 12).
Die beiden Begründungszusammenhänge erscheinen jeweils plausibel. Es soll deshalb unterstellt werden, dass sowohl anthropologische als auch funktionale Gründe dafür sprechen, dass sich beim gemeinschaftlichen Handeln von Menschen Führungsstrukturen herausbilden. In Organisationen sind primär funktionale Gründe maßgebend. Die notwendige Führung kann indessen nur dann erfolgreich sein, wenn anthropologische Aspekte bei der Art und Weise der Ausübung berücksichtigt werden.
1.3 Führung steuert und lenkt Sachleistungen
In Betrieben als organisierten Leistungsgemeinschaften erbringen Menschen entsprechend dem Zweck dieser Leistungsgemeinschaft Sachleistungen in Form materieller Güter oder immaterieller Dienstleistungen. Diese Leistungen sind sachlich sehr verschieden. Der Arbeiter in einer Fabrik bedient beispielsweise eine Drehbank, der Verkäufer in der Verkaufsabteilung eines Industrieunternehmens gibt Angebote ab, er diktiert, telefoniert, verhandelt. Der Architekt entwirft ein Layout für den Bau eines Lagergebäudes. Vom Gesichtspunkt der Schwierigkeit kann man sie zwei Kategorien zuordnen, es können einerseits Routinetätigkeiten sein oder andererseits sich auf die Lösung von Problemen beziehen.
Führungsaufgaben und Führungsfunktionen müssen unterschieden werden einerseits von den sachlichen Funktionsbereichen einer betrieblichen Organisation - in einer Unternehmung, beispielsweise Vertrieb, Produktion etc. -, andererseits auch von den technischen bzw. fachlichen Funktionen des Managers. Der Manager in einer Unternehmung erfüllt in seinem sachfunktionalen Tätigkeitsbereich (z.B. Produktion) fachliche Funktionen und Management-Funktionen. Die Tätigkeit des Managers auf seinem Fachgebiet (z.B. Marketing, Maschinenbau) zählt zu seiner technischen oder fachlichen Funktion.
Fragt man nun nach der Funktion der Führung für diese Leistungsprozesse, dann werden in der Regel die Planung, Koordination und Kontrolle der Aufgaben einer Unternehmung als dispositive Faktoren in den Mittelpunkt gestellt. Die meisten Führungstheorien basieren auf Annahmen darüber, wie Führer Geführte anleiten sollten, um intendierte Zwecke zu verwirklichen. Hierbei tritt Führung zutage als eine mehr oder weniger rationale Form der hierarchischen Arbeitsteilung. Die Grundidee besteht darin, dass in Unternehmungen komplexe Aufgaben zu bewältigen sind. Entsprechend gibt es in dieser Organisation Personen, die die Erfüllung jener Aufgaben gedanklich vorbereiten, Entscheidungen treffen und die Konsequenzen dieser Entscheidung bestimmen und anordnen. Hierarchisch nachgeordnete Funktionsträger koordinieren und delegieren ihrerseits die gedanklich nachbereiteten Entscheidungen. Die Management-Funktionen ergeben sich aus der formalen Struktur des Managementprozesses (vgl. Hahn 1971, S. 163; Withauer 1974, S. 18 ff, ähnlich Richter 1999, S 36 ff).
Abbildung 1.1 Phasenstruktur der Führungstätigkeiten
Der Prozess des Managements wird initiiert durch eine Problemsituation. Daraus resultiert die Zielsetzung zur Überwindung der Problemsituation, woraus sich ein Handlungsprogramm ableitet. Dieses muss in zielgerechte Handlungsergebnisse transformiert werden. Spätestens jetzt müssen andere Menschen veranlasst, überzeugt, verpflichtet werden, sich entsprechend zu entscheiden und die Handlungen durchzuführen. Die Durchführung ist eine unproblematische, dem Führungsprozess nicht unmittelbar zuzurechnende Aktionsphase.
Die Kontrolle der Handlungsergebnisse ist wiederum Führungsaufgabe, sie informiert über die Zielerreichung, macht eventuell eine neue Problemsituation sichtbar und leitet somit erneut einen Managementprozess ein. In dieser Betrachtungsweise ist Management ein Steuerungsbzw. Regelungsprozess, wobei die darin enthaltenen Führungsfunktionen einen Handlungskreis bilden, den Management-Kreis. Ausgeübt werden diese kybernetischen Funktionen durch die kontinuierlichen Funktionen Kommunizieren, Analysieren und Entscheiden und sie sind auch Ausdruck von Beziehungen als Interdependenzen und Rückkopplungen zwischen den kybernetischen Funktionen.
Abbildung 1.2 Management-Kreis
In einer anderen Modelldarstellung können die Funktionen Ziele setzen, Planen, Organisieren als sach-, prozess- und strukturbezogene Bestandteile eines umfassenden Planungs- oder Entscheidungsprozesses aufgefasst werden (vgl. Withauer 2000, S. 32, Bleicher 2011, S. 54 f). Die Funktion »Führen/Einwirken« kann im Zuge der Notwendigkeit des personalen Ingangsetzens, des Bewirkens von Handlungen zu einer Ballung menschlicher und sozialer Fragen führen: Hier geht es in besonderem Maße um die vielfältigen und unmittelbaren Beziehungen zwischen Führungskräften und Mitarbeitern einerseits, zwischen gegebenen Zielen und menschlichem Handeln andererseits.
1.4 Sachaspekt und personaler Aspekt des Managements
Jedes Führungsgeschehen beinhaltet einen Sachaspekt und einen personalen Aspekt (vgl. Richter 1999, S. 2 ff; Bröckermann 2016, S. 243; Olfert/Steinbuch 2001, S. 235). Der Sachaspekt kommt in der Sachentscheidung über Handlungsziele, intendierte Leistungs-Ergebnisse, Ressourceneinsatz, Aufgaben und Prozesse zum Ausdruck. Ohne ein Sachziel kann es keine Führung geben. Der sachrelevante Teilbereich des Führungsprozesses ist der informationelle, im Wesentlichen auf die Entscheidungsfindung über wirtschaftlich-technische Sachziele und Sachfragen gerichtete Bereich. Der personale Aspekt bezieht sich auf die Beeinflussung von bzw. Einwirkung auf Menschen mit der Absicht, den Wertschöpfungsprozess der Mitarbeiter für die zentralen Bezugsgruppen der Unternehmung (Kunden, Kapitalgeber, Lieferanten, Gesellschaft und der Mitarbeiter selbst) zu erhöhen oder zu sichern (vgl. Wunderer 2009, S. 4). Der Begriff »Wertschöpfung« ist hierbei nicht nur finanziell gemeint, sondern umfasst soziale Kriterien wie Kunden- oder Mitarbeiterzufriedenheit, diese zeigt sich in mehr Lebensqualität, insbesondere in der Arbeits- und Beziehungsqualität für die Mitarbeiter, aber auch für andere Bezugsgruppen. Die soziale Effizienz beeinflusst zugleich ökonomisch-technische Erfolgsgrößen (Output, Wirtschaftlichkeit, Produktivität, Gewinn, Produkt- und Dienstleistungsqualität). Deshalb ist eine positive Gestaltung der personalen Führung sowohl ein Mittel als auch eine eigenständige Wert- und Zielgröße zur Optimierung der Arbeits- und Lebensqualität. Sachaspekt und personaler Aspekt sind mithin aufs engste miteinander verwoben. Die Unzulänglichkeit herkömmlicher Deutungen des Führungsphänomens liegt darin, dass entweder nur der Sachaspekt oder nur die personale Problematik behandelt worden ist.
Management ist nicht identisch mit Betriebswirtschaftslehre; sie widmet sich den Fragen des rationalen und effizienten Wirtschaftens und beachtet den sachlich-wirtschaftlichen Aspekt der Entscheidungsfindung. Management ist aber auch nicht gleichbedeutend mit Behandlung, Betreuung oder gar Manipulierung von Menschen; sie ist keine »angewandte Psychologie«. Allerdings: Was tun denn Manager anderes als »wirtschaften«? Eine praxisorientierte Betriebswirtschaftslehre, die sich zugleich als Managementlehre versteht, verbindet in einem erweiterten Verständnis des Ökonomischen den entscheidungsbestimmten Sachaspekt und dessen Verwirklichung durch Konsensfindung und kommunikatives personales Handeln. Grundlage des Managements ist mithin eine Synthese von verhaltenswissenschaftlichen Einsichten und gutem betrieblichem Wirtschaften.
Der Führungsleistung käme in dieser Perspektive jedoch eine ganz besondere und spezifische Bedeutung zu. Eine Verbesserung der Führungsleistung wirkt sich aus auf jegliches Leistungsverhalten in der Organisation. Die Sachleistungen in einer Leistungsgemeinschaft wären dann die Antwort auf Führungsleistungen. Wenn man Führung in diesem Sinne versteht, dann lautet die Definition für Führung: "Führen heißt, zielorientiert auf Mitarbeiter einwirken, um sie .. zu … Leistungen zu bringen" (Withauer 1973, S. 9). Dahinter steckt ein Einfluss- oder Machtansatz, bei dem davon ausgegangen wird, dass eine Person (die Führungskraft) über Ressourcen verfügt (Eigenschaften, Erfahrung, Positionsmacht, Verhaltensweisen usw.), die es ihr erlauben, das Handeln anderer zu lenken. Nichts ausgesagt wird über die historische und gesellschaftliche Situation und den formellen (institutionellen oder organisatorischen) Rahmen, in denen ein solcher Versuch stattfindet. Es wird ferner der Eindruck erweckt, die Beziehung sei einseitig (von der Führungskraft zu den Geführten) und nicht etwa gegenseitig; es wird weiterhin unterstellt, dass klar sei, was zielorientiert heißt (die Ziele der Geführten, die Ziele der Führungskraft, die Ziele der Organisation usw.?) und schließlich, dass es ums Handeln





























