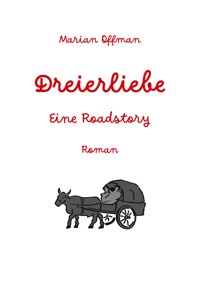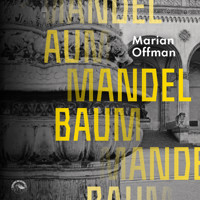16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Volk Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf dem Münchner Odeonsplatz marschiert eine Gruppe von Rassisten, Antisemiten und anderen rechten Schreihälsen auf. Umringt werden sie von Polizei und Gegendemonstranten, unter ihnen der jüdische Stadtrat Felix Mandelbaum. Dann ein Zusammenstoß in der Menschenmenge – ein Anschlag? – und der Anführer der Rechten liegt im Koma. Mandelbaum wird festgenommen und inhaftiert. In einer kargen Zelle steht ihm die längste Nacht seines Lebens bevor. Die Situation ist beängstigend, sogar bedrohlich, und Mandelbaum weiß nur einen Ausweg: Er flüchtet sich in Erinnerungen. Die Szenen seines Lebens führen ihn in seine Kindheit, über den Atlantik nach Kanada und zurück ins dunkle München, in eine unverständliche Welt der Erwachsenen, in der viel gelacht, aber noch mehr über ein geheimes, schier unfassbares Grauen geweint wird. Schule, Studium, Familie, Arbeit und politischer Aufstieg … In jeder Lebensphase gehen Hoffnung, Glück und zerstörerische Erfahrungen von Antisemitismus Hand in Hand, während über allem die Frage schwebt: Kann eine deutsch-jüdische Existenz gelingen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Marian Offman
MANDEL
BAUM
Roman
Volk Verlag München
Handlung und Charaktere basieren teils auf wahren Begebenheiten und realen Personen, sie wurden jedoch für diesen Roman fiktionalisiert.
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
© 2022 by Volk Verlag München
Neumarkter Straße 23; 81673 München
Tel. 089 / 420 79 69 80; Fax: 089 / 420 79 69 86
Coverbild: Fotografie von Marian Offman, aufgenommen mit einer Leica
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH
Alle Rechte, einschließlich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks sowie der photomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.
ISBN 978-3-86222-469-2
www.volkverlag.de
Inhalt
Mandelbaum wird verhaftet
Ozeanüberquerungen
Mein trauriger Onkel Bernstein
Pepperell-Street
DC-3
Eine unmögliche Ehe
Onkel Oskar
Meran
Jom Kippur
Wir sind Juden und feiern kein Weihnachten
Judenkind
Die dunkle Turnerschule
Fest einer ungewöhnlichen Familie
Jom Kippur und viel Trauer
Dem Tode nahe
Der einzige jüdische Schüler
Sebastian
Jugoslawien
Sebastian geht nach Berlin
Berlinreise
Italien per Autostopp
Von der Bundeswehr zurückgestellt
Pelzmäntel für ältere Damen
Firmenpleite
Geburt
Überleben
Getrübte Existenzen
Neues Geschäftsmodell
Die Amerikanerin
In der Lokalbaukommission
Gemeindepolitik
Auschwitz
Ist mein Weg Verrat?
Mittagessen im Landtag
Die konservative Partei
Rücktritt vom Rücktritt
Kandidatenaufstellung
Kauft nicht bei Juden
Immobilienhai
Kanonendonner im Libanon
Einen Pflock einschlagen
Pressesprecher
Ein Kinderlächeln, selten wie ein Junikäfer im Winter
Tacheles
Mein Vater stirbt
Grab mit schlechter Aussicht
Im Mittelpunkt
Es schneit und Rot-Grün schaut zu
Volksverhetzung
Ein umgeworfener Tisch
Attentat
Die unscheinbare Lydia Miller
Da wird dem Mandelbaum noch das Lachen vergehen
Im Reinen
Münchens neues Antlitz
Stolpersteine
Magische Fügung – ein Nachwort
Danksagung
Für meine Eltern Hilda und Avram
Aber ich bin nicht gefangen (…) Weil ich die Zaubermacht besitze, die allen Schriftstellern eigen ist. Ich kann mühelos durch Wände gehen.
Ahmet Altan
Mandelbaum wird verhaftet
Es ist kalt und laut am Odeonsplatz. Ich stehe vor der Absperrung an der Feldherrenhalle und bin Teil der Demonstration gegen den Aufmarsch von Pegida. Wir sind wütend über das rechte Gegröle, die rassistischen Parolen und die Hetze auf den Plakaten. In der Mitte der Meute steht grinsend ihr Münchner Vorsitzender Heinz Müller. Plötzlich steigt der Lärmpegel noch einmal an und es wird bedrohlich eng auf dem Platz. Ich dränge mich weiter nach vorn und sehe eine Gruppe von Neonazis, die, eskortiert von der Polizei, zur Absperrung vor der Feldherrnhalle laufen. Sie kommen von der U-Bahn und tragen ein etwa zehn Meter langes Stoffband vor sich her: „Wir sind das Volk“ ist in großen Buchstaben aufgepinselt. An der Spitze geht der bekannte Neonazi Adolf Hintermoser. Ich fotografiere diese gut gespielte Inszenierung.
Hintermoser ist der Kopf der Nazibande, der einen Anschlag auf die Grundsteinlegung des jüdischen Zentrums in München plante und deshalb länger einsaß. Kurz treffen sich unsere Blicke und ich zittere vor Kälte und Wut. Feixend und im Schutz der Polizei gelangen die Neonazis auf den Odeonsplatz und werden von den Pegida-Aktivisten umarmt. Hinter der Absperrung sind wir fassungslos über dieses Schauspiel. Unsere Wut steigert sich und die dumpfen Parolen über eine drohende Islamisierung und eine angeblich von Rothschild inszenierte Asylindustrie gehen im Lärm unserer Gegendemo unter.
Ich dränge mich zum Absperrgitter und will den Neonazis gegenüber als jüdischer Stadtrat Gesicht zeigen, sie auch fotografieren. Die Leica baumelt vor meiner Brust und stößt gegen das Metallgitter.
Müller von der Pegida und Hintermoser stehen zusammen, nur wenige Meter entfernt, und grinsen verächtlich. Wie soll ich reagieren? Ich werde keinesfalls mit ihnen sprechen.
Sie kommen näher zur Absperrung. Nun hebe ich die Kamera ans Auge, sehe die beiden im Sucher auf mich zukommen. Während des Fokussierens ist das Bild plötzlich dunkel. Ich sehe über den Rand der Kamera: Hintermoser steht direkt vor mir. Er schiebt meinen Arm mit der Leica zur Seite und streift meine Hände. Ich rufe: „Keine Berührung! Widerlich, du Nazi!“
Demonstranten drängen und schieben gegen das Gitter, die Polizei hält dagegen, es wird unerträglich laut. Der Neonazi kann mich im Schutz der Polizei demütigen.
Ich ziehe den Lederriemen der Kamera über meinen Kopf und hebe sie nach oben, um aus der Höhe zu fotografieren. Unversehens werde ich von hinten gestoßen, ein mächtiger Ruck, die schwere Leica entgleitet, fliegt im hohen Bogen und trifft den glattrasierten Schädel von Hintermoser seitlich, am Ohr. Sein wütender, von Schmerz erfüllter Blick streift mich. Er blutet am Kopf und sackt langsam zu Boden.
Nach einer Schrecksekunde gehe ich in die Knie und greife vergebens durch die Absperrung nach meiner Kamera. Ihr Verlust macht mich wütend.
Hintermoser liegt am Boden, umringt von Gesinnungsgenossen, die hysterisch nach einem Arzt rufen. Sirenengeheul übertönt die Sprechchöre der Gegendemonstranten um mich herum. Aus ihren Gesichtern strahlt Schadenfreude. Die Wut und die Aggression auf beiden Seiten schwellen an. Aus der Residenzstraße kommt eine Hundertschaft der Polizei, um die Absperrgitter zu schützen. Im Chaos des Gedränges ergreife ich die Flucht nach hinten zum Odeonsplatz. Ein Fortkommen ist schwer. Nach wenigen Metern bin ich wieder in einer Gruppe von Gegendemonstranten gefangen.
Was ist geschehen? Es ist absurd. Der Verlust meiner Leica berührt mich mehr als der Anblick des blutenden Kopfes von Hintermoser. Was habe ich getan?
Ich spüre ein Klopfen an der Schulter. Eine junge Polizistin mit blondem Pferdeschwanz spricht mich an, während ich von mehreren Polizeibeamten umringt werde. Sie blicken streng. Meine Knie zittern, dabei bin ich eher irritiert als verängstigt. Eine Polizistin sagt mit heller Frauenstimme: „Herr Mandelbaum, gegen Sie wurde Anzeige erstattet wegen gefährlicher Körperverletzung oder wegen versuchten Totschlags. Wir müssen Ihre Personalien aufnehmen und Sie zur Sache befragen.“
Ein anderer Polizist ergänzt: „Sie haben doch eine Kamera nach Hintermoser geworfen? Er erlitt Kopfverletzungen, hat sein Bewusstsein verloren, der Notarzt ist angefordert, er wird ins Krankenhaus Rechts der Isar verbracht. Sie müssen mit uns zur Aufnahme Ihrer Personalien und zu einer weiteren Befragung zum Bus kommen.“
Das ist unerträglich! Was erlauben die sich? Das Klingeln in meinen Ohren hört nicht auf. „Das ist doch lächerlich. Jemand hat mich von hinten geschubst und die Kamera flog über die Absperrung. Sie wollen mir doch nicht einen Mordanschlag auf Hintermoser unterstellen! Sie wissen, ich selbst stehe auf den Todeslisten der Nazis. Sie sollten sich schämen. Ich will jetzt sofort gehen.“
Die Polizei drängt mich stattdessen in die Residenzstraße. Dort stehen mehrere Polizeibusse mit laufenden Motoren. Einer der Polizisten deutet auf das erste Fahrzeug: „Begeben Sie sich bitte in den Bus, damit Sie nicht die Abgase einatmen müssen.“
Sprachlos klettere ich hinein, setze mich an einen kleinen Tisch, an dem zwei Beamtinnen auf mich warten. Der Lärm vom Odeonsplatz dringt bis hierher. Sie verlangen meine Ausweisdokumente und befragen mich ausführlich zu meiner Person.
Nach etwa 20 Minuten eskaliert die Situation. „Herr Mandelbaum, wir haben über Funk erfahren, dass Herr Hintermoser nach wie vor bewusstlos ist und nunmehr auf die Intensivstation verlegt wurde. Der Verdacht einer schweren Körperverletzung erhärtet sich. Vielleicht auch versuchter Totschlag. Oder alles klärt sich auf und Sie können gehen. Auf jeden Fall müssen Sie mit in die Ettstraße zur weiteren Befragung.“
Wie oft in schwierigen Situationen werde ich hellwach und ruhig. Die wollen mich einsperren?
Die Bustür wird von außen zugezogen und von innen verriegelt. Wir fahren langsam in Richtung Rathaus, sind in wenigen Minuten in der Löwengrube an der rückwärtigen Einfahrt zum Polizeipräsidium und gelangen schnell in den Hof des weitläufigen Gebäudes.
Die Erinnerung an meinen Vater wird wach. Vor Jahrzehnten musste ich ihn in der Ettstraße abholen, weil er in einen Streit im Hotel Bayerischer Hof verwickelt gewesen war. Genaues habe ich nie erfahren, jedenfalls war sein weißer Hemdkragen mit Blut befleckt. Ihn dort in dieser Verfassung zu treffen, machte mir damals Angst und ich empfand die Situation als traurig, zumal er leicht angetrunken war. Gleichzeitig bemitleidete ich ihn. Er war knapp dem Tod in den Konzentrationslagern entronnen und nun wurde sein Sohn gerufen, um ihn an einem Ort abzuholen, in dem vor nicht allzu langer Zeit die Gestapo gewütet hatte. Es muss für ihn sehr erniedrigend gewesen sein.
Die Bustür öffnet sich automatisch. Beim Aussteigen drückt eine der Polizistinnen meinen Kopf leicht nach unten, damit ich mich nicht stoße. „Wie im Tatort“, sage ich, „wenn ein Verhafteter in den Polizeiwagen geschoben wird.“ Es ist der Versuch, die Kontrolle über die Situation zurückzuerlangen.
Wir treten durch den Hintereingang in den Vorraum des Treppenhauses des Präsidiums. Es riecht nach Bohnerwachs und Desinfektionsmitteln.
Die behandeln mich wie einen Verbrecher, weil die Nazis mich angezeigt haben. Weil ich als jüdischer Stadtrat gegen sie Gesicht gezeigt habe. Meine Gegner sind mächtiger als ich? Wie viele Juden wurden von Polizei und Gestapo schuldlos in die Ettstraße gezerrt, verhört, gefoltert, getötet?
Doch darf ich meine Situation hier mit 1933 vergleichen? Wäre das nicht relativierend und anmaßend zugleich, überlege ich. Zudem gab es unlängst in der Ettstraße eine Ausstellung über die unrühmliche Rolle der Münchner Polizei in der Nazizeit mit schonungsloser Offenheit.
Die Polizisten gehen wortlos zurück zu ihrem Bus.
Ein Beamter in Zivil nimmt mich in Empfang. Er trägt Jeans und ein lindgrünes Hemd. Wohl aus Zeiten der alten Polizeiuniformen übriggeblieben, denke ich und überlege, wie überflüssig dieser Gedanke angesichts meiner aktuellen Probleme ist. „Ich bin Hauptkommissar Stadler“, stellt sich der Mann vor, „und werde Sie zur Sache befragen. Kommen Sie bitte mit in das Vernehmungszimmer. Es ist im dritten Stock.“
„Zur Sache werde ich mich nicht äußern, Herr Stadler, außerdem möchte ich einen Anwalt sprechen.“
Der Beamte geht auf meinen Einwand nicht ein und wir fahren mit dem Paternoster in den dritten Stock. Stadler öffnet die Türe zum Vernehmungszimmer. Der Raum hat ein vergittertes Fenster mit Milchglasscheiben und einen längeren Tisch mit vier Stühlen. Ein Polizeibeamter in Uniform kommt noch dazu, schließt die Türe von innen und bleibt davor stehen. Stadler weist mir einen Platz ihm gegenüber zu. Er setzt sich, legt sein Handy in die Mitte des Tisches und drückt auf den Aufnahmebutton. „Ich konnte leider zur späten Stunde keinen Staatsanwalt mehr erreichen. Wollen Sie nun Ihren Anwalt anrufen?“
Das ist ein Albtraum.
21:10Das Handy steckt in meiner Tasche. Ich ziehe es heraus und suche nach der Nummer eines Stadtratskollegen, der ein bekannter Strafverteidiger ist. Die Anrufe an seine Privatnummer und an die Kanzlei sind vergebens. „Der Anwalt ist leider nicht zu erreichen. Ich habe nur auf seinen Anrufbeantworter gesprochen. Sie können mich jetzt nicht befragen. Deshalb möchte ich gehen. Morgen ist auch ein Tag, wir können dann im Beisein meines Anwalts reden. Es ist schon nach 21 Uhr und ich möchte endlich nach Hause.“
Stadler lächelt, steht auf und rückt seinen Stuhl unter den Tisch. Er stoppt die Aufnahme unseres Gesprächs, nimmt sein Handy und liest darauf Nachrichten. Er ist groß, blickt auf mich hinab. Ich erhebe mich schnell.
„Das Opfer – Herr Hintermoser – ist nach wie vor bewusstlos und wurde in ein künstliches Koma versetzt. Es besteht der Anfangsverdacht auf mindestens schwere Körperverletzung. Wir müssen Sie vorläufig festnehmen und morgen dem Haftrichter vorführen. Sie können dann selbstverständlich Ihren Anwalt hinzuziehen. Aber nach Hause – nein,Herr Mandelbaum, nach Hause können Sie nicht. Ihre Kamera haben wir sichergestellt. Wir haben Blutspuren gefunden, wahrscheinlich von Herrn Hintermoser. Sie ist nun in der Forensik, morgen wissen wir mehr.“
Ich bin verhaftet, meiner Freiheit beraubt!
Das ist Willkür und Kumpanei mit den Nazis. Am besten schweigen, denke ich, jedes Wort kann falsch sein. Es fällt mir schwer, nicht nach Beweisen zu fragen und nicht die bekannte Nähe von Beamten zu den Rechten auszusprechen. Das ist nicht mehr mein Land, das ist Täterland. Eine große Kälte kommt in meine Gedanken.
Wir verlassen den Vernehmungsraum und Stadler begleitet mich zum Gefängnistrakt. Zunächst ist da der Raum für die erkennungsdienstliche Behandlung. Eine Beamtin erwartet mich. Wir sitzen über Eck an einem Tisch. Unsere Oberschenkel berühren sich kurz. Sie nimmt über einen Scanner meine Fingerabdrücke ab und fotografiert mich. Gürtel, Schnürsenkel, Handy und Geldbeutel muss ich abgeben. Sie unterzeichnet die Empfangsquittung für meine Sachen, ohne sie mir auszuhändigen.
Stadler verabschiedet sich und die Polizistin begleitet mich zur Zelle. Sie öffnet die Türe. Ziemlich benommen betrete ich den Raum. Er ist fast quadratisch mit einem vergitterten Fenster, einem Waschbecken, einer Metalltoilette und einer Liege. Das Waschbecken hat eine breite Umrandung. Darauf liegen Zahnbürste und Zahnpasta. Fahles, kaltes Licht kommt von der Deckenleuchte. Die Polizistin lächelt und verschließt dann schnell die schwere Metalltüre von außen. Warum ist sie so freundlich, wenn sie mich dann doch einsperrt?
Ich setze mich auf die Liege und starre an die Decke. Bilder von Häftlingen, die am Morgen tot in ihrer Zelle aufgefunden werden, füllen meinen Kopf, werden immer plastischer. Um sie zu vertreiben, stehe ich auf, trinke Wasser aus dem Hahn am Waschbecken und verrichte meine Notdurft. Das Wasser gurgelt in der Toilettenschüssel, dann wieder Totenstille.
Die Lampe wird während der ganzen Nacht leuchten. Es gibt keinen Schalter.
Ist alles ein dummer Zufall? Oder tatsächlich der Versuch, mich mundtot zu machen, mich aus der Politik und der medialen Aufmerksamkeitzu tilgen? Stecken meine politischen Gegner von der rechten Seite mit Hintermoser und seinen Schergen unter einer Decke? Habe ich die Beherrschung verloren?
Der Nazi liegt im Koma. Er ist noch nicht tot, könnte aber sterben. Dann würde ich zum Mörder.
Mein Vater war in deutschen Konzentrationslagern eingesperrt, wurde dort gefoltert und geschlagen – von SS-Schergen, aber auch von Polizisten. Dass einer von ihnen meinen Vater an einem denkwürdigen Tag rettete, geschah nicht aus Humanität, sondern allein als Gegenleistung dafür, dass er – der Kürschner – für die polnische Freundin des Polizisten einen Persianermantel genäht hatte. Diese Geschichte spielte vielleicht im Warschauer Getto, vielleicht an einem anderen Ort. Mein Vater konnte mir die Rettung nie plausibel erklären, wie vieles andere aus dieser schrecklichen Zeit auch.
Nun, etwa 80 Jahre später, bin ich selbst in einem deutschen Gefängnis eingesperrt. Weil ich mich mit den Neonazis angelegt habe, einen von ihnen angegriffen haben soll.
Mein Kopf schmerzt und ich fühle meinen Puls rasen. Mir wird schwindelig. Also lege ich mich auf das behelfsmäßige Bett und hülle mich in die graue grobe Decke, die am Fußende ausgebreitet ist. Sie riecht nach Seife und altem Schweiß.
An Schlaf ist nicht zu denken. Ich spüre meinen schnellen Herzschlag auf die Matratze klopfen. Erst durch bewusstes tiefes und langes Ein- und Ausatmen werde ich ruhiger.
Ich lasse in Gedanken helle und leuchtende Farben an mir vorüberziehen und suche nach Erinnerungen aus meiner Kindheit. Sie halten mich wach und geben mir die Kraft, diese Nacht durchzustehen.
Ozeanüberquerungen
Als Kind überquerte ich den Atlantik bis zu meinem fünften Lebensjahr sechs Mal. Der Familie des Bruders meines Großvaters war es gelungen, vor der Schoa von Polen nach Kanada auszuwandern. Nach dem Krieg ermöglichten sie meinen Eltern und mir den Aufenthalt in ihrem Land und boten Unterstützung. Den Lebensstil meines Vaters missbilligten sie.
Die Eltern waren im Streit mit sich und der Familie in Kanada, entwurzelt zwischen den Kontinenten, unfähig, an einem Ort zu verweilen. Wir lebten in München, in Halifax und Toronto. Ein Bild aus meiner frühen Kindheit, das immer wiederkehrt, zeigt mich in einer Wohnung in Toronto, die in einem Mehrfamilienhaus aus Klinkersteinen lag: ein kleiner und trauriger Junge mit dunklen Augen.
Mutter griff in dieser Wohnung zum Telefon und wählte die Vorwahl von München. Nicht, um über den Ozean hinweg zu telefonieren – das wäre viel zu teuer gewesen –, sondern um die leise Melodie des „Alten Peter“ und die aus großer Entfernung kaum vernehmbare Ansage „Hier ist München, hier ist München …“ zu hören. Das wiederholte sich fast jeden Abend.
Wir hatten München, meine Geburtsstadt, verlassen müssen, weil für Vater der Boden dort zu heiß geworden war. Schwarzmarktgeschäfte. Die örtliche Polizei hatte bereits mehrere Juden verhaftet. Zudem war ich als Säugling mit nur sechs Monaten an Tuberkulose erkrankt. Mein Onkel Bernstein hatte mich angesteckt, der mit dieser schweren Erkrankung aus dem Lager gekommen war. In Kanada gab es damals ausreichend Penicillin und so wurde ich, kaum mehr als ein halbes Jahr alt, dorthin verschifft und geheilt.
Ich sollte ein krankes und schwaches Kind bleiben.
21:33Mein Herz schlägt langsamer, ich liege wohl seit etwa einer halben Stunde auf diesem Bett. Ich sehe mich im Hof des Hauses aus Klinkersteinen, im tiefen Schnee mit meinem Schlitten aus Metallrohren in knallroter Farbe. Das muss während unseres dritten und letzten Aufenthalts in Kanada gewesen sein.
Ich suche nach weiteren Bildern aus meiner kanadischen Kindheit: Wir sind am Hafen von Halifax. Meine Mutter, meine jüngere Schwester und ich verabschieden uns vom Vater, weil wir zurück nach Europa fahren und er allein zurückbleibt. Ich sehe durch die Gitterstäbe der Reling nach unten. Der Blick tief hinunter auf den Quai ängstigt mich. Nahe der Landungsbrücke erkenne ich meinen Vater. Weit entfernt erahneich nur, wie er zittert und weint. Auch mir kommen die Tränen und kindliche Schuldgefühle.
Später erfuhr ich, dass wir nicht die erste Familie meines Vaters waren. Er war in Polen bereits verheiratet gewesen, hatte eine kleine Tochter. SS-Schergen oder deutsche Polizisten waren in sein Haus gekommen, hatten seine Frau erschossen und das Kind gegen die Wand geworfen, bis es tot war.
Diese Geschichte erzählte mir mein Onkel Bernstein. Die ermordete Frau meines Vaters war seine Schwester gewesen. Mein Vater verlor nie ein Wort darüber. Gemeinsam hatten die beiden Männer das Inferno der Konzentrationslager durchlitten und überlebt. Wie sie das geschafft hatten, erfuhr ich nie.
Mein trauriger Onkel Bernstein
Als ich älter war und unsere Familie Kanada längst endgültig für München verlassen hatte, traf ich meinen Onkel Bernstein gelegentlich in seinem kleinen Pelzladen in der Sonnenstraße. Wir saßen dann im dunklen Lagerraum voller Pelzmäntel im Souterrain und jedes Gespräch begann er mit einem schrecklichen Satz: „Eigentlich bin ich längst tot.“ Seit der Ermordung seiner Frau, Schwester und Eltern vegetiere er nur noch. In diesem Mörderland dürften wir nicht mehr bleiben.
Dann sprachen wir oft über die Schulden, die mein Vater bei ihm hatte, auch über seine Zukunftspläne für mich und meine Schwester. Er war von beiden Männern stets der Vernünftige, nicht so schillernd wie mein Vater. Dafür war er immer flüssig.
Vater hatte bald nach unserer Rückkehr nach München eine kleine Pelzwerkstatt eröffnet. Er hätte es wie die anderen Pelzhändler zu großem Wohlstand bringen können. Doch ihm zerrann das Geld zwischen den Fingern. Vielleicht suchte er so, das Geschehene zu vergessen. Er war ein Lebemann, war großzügig, trug teure Maßanzüge und finanzierte seinen aufwendigen Lebensstil mit den Einnahmen aus der Firma. Die Einkünfte wurden sofort für Rohware, seine Familie oder den Kauf von wertvollem Schmuck ausgegeben – ein funkelnder, leicht beweglicher Notgroschen für Flucht und Vertreibung. Oft musste er Geld leihen, um am Freitag die Löhne bezahlen zu können. Onkel Bernstein sah dies mit Argwohn, zumal er der erste war, den Vater anpumpte.
In Onkels Gegenwart wurde ich stets sehr traurig. Seine Todessehnsucht erdrückte mich.
21:45Ich habe keine Uhr. Wie lange ich hier schon liege? Allein der Schmerz in meinem Rücken zeigt das Vergehen der Zeit, an Schlaf ist nicht zu denken. Ich fühle meinen Puls am Handgelenk. Er läuft sehr schnell. Das einzig vernehmbare Geräusch ist das gelegentliche Schlagen von Türen. Es hallt in den Fluren des Gefängnistraktes.
Vorher habe ich Schritte vor meiner Türe vernommen und ein leises, metallisches Kratzen. Vielleicht die Abdeckung vor dem Guckloch meiner Zelle? Kontrollieren sie mich?
Wie überstehe ich diese fürchterliche Nacht.
Gedenken und Erinnern ist jüdische Tradition. An Pessach erinnern wir uns an den Auszug aus Ägypten und an die Befreiung aus der Sklaverei. Jedes Jahr trinken wir mit erhobenen Häuptern dazu mehrere Gläser roten Weines und danken Gott für die Befreiung. Das Lichterfest Chanukka feiert das spirituelle Überleben der Juden und Jüdinnen.
Und so erinnere ich mich an meine frühe Jugend mit schönen farbigen Bildern. Ich suche nach Sicherheit, zumindest in meinen Gedanken. Welcher Junge hat schon sechs Mal den Atlantik überquert? Auf einem schwedischen Dampfer zurück nach Deutschland wären wir beinahe untergegangen. Ich sehe noch die vielen Seile, die auf Deck und im Inneren des Schiffes gespannt waren, um sich bei hohem Seegang daran festhalten und fortbewegen zu können. Der ständige Geruch des Erbrochenen im Inneren des Schiffes blieb in meiner Nase.
Nach einer Ozeanüberquerung in die andere Richtung landeten wir in Halifax und wohnten in der Pepperell-Street in einem Armenviertel nahe am Hafen. Es war ein kleines, blau angestrichenes Holzhaus mit Veranda. Ich sehe mich als kleinen Jungen auf dieser Straße laufen.
Die Zellentüre wird geöffnet. Sofort hellwach, stehe ich auf. Vielleicht hat sich alles aufgeklärt und ich kann gehen. Ein Beamter betritt den Raum, blickt mich an und ich blinzele. Er sieht, ich lebe, und er willmöglichst schnell die Zelle wieder verlassen. Ich trete einen Schritt auf ihn zu: „Ich habe keine Schuld. Nur weil Neonazis mich angezeigt haben, wollen Sie mich hier weiter eingesperrt halten? Das hat Tradition in diesem Land!“
Das geht dem Vollzugsbeamten zu weit. Sein Gesicht ist – soweit ich das im fahlen Licht erkennen kann –leicht gerötet. „Sie hoffen wohl, Sie bekämen als jüdischer Stadtrat eine Sonderbehandlung! Immerhin besteht Verdacht auf gefährliche Körperverletzung oder sogar versuchten Totschlag.“ Schnell bewegt er sich zur Türe, verlässt die Zelle und dreht den Schlüssel im Schloss. Alle Hoffnung schwindet. Ich öffne den Hahn über dem metallenen Waschbecken und trinke das lauwarme Wasser. Es riecht leicht nach Chlor.
Das Wort „Sonderbehandlung“ war für die Nazis eine Tarnbezeichnung für die Ermordung von Juden. Kann ich davon ausgehen, dass der Beamte die grausame Bedeutung des Wortes nicht kennt? Es ist ein Unwort – wie „Endlösung“. Wie oft muss ich diese Vokabeln noch hören und das Leid spüren, das sie auslösen.
Meine Knie zittern. Ich lege mich wieder hin und suche nach den schönen Bildern in Kanada.
Pepperell-Street
Welch ein aufregender Ort meiner frühen Kindheit! Schon damals verteilte ich Flugblätter, kleine Zettel, an Passanten. Darauf prangten von mir gemalte buchstabenähnliche Zeichen. Die Vorübereilenden freuten sich, einige tätschelten mich am Kopf. Ich genoss die Sympathie der Passanten. Ein kleiner Junge in Stoff-Latzhosen mit einem Kopf voll blonder Locken und dunklen Augen. Wer konnte ihm widerstehen?
Ich stand oft vor einer rötlich-braun angestrichenen Holzhütte unweit unseres Hauses, weil es spannend war, die vielen Matrosen mit ihren weißen runden Mützen zu beobachten. Ich fragte, warum dort so viele Männer ein- und ausgingen. Meine Mutter erwiderte kurz: „Sie feiern nur Geburtstag.“ Künftig durfte ich nicht mehr in die Nähe der Hütte gehen. Zettel verteilen allerdings schon.
21:51Irgendwann erfuhr ich aus einer historischen Abhandlung über Halifax, dass dieses Haus nahe am Hafen – die rot-braune Holzhütte – einst das bekannteste Bordell der Stadt war.
Die Miete für unser kleines Haus im Hafenviertel finanzierte mein Vater auf ungewöhnliche Weise, wie mir meine Mutter später erzählte. Er hatte auf dem Münchner Schwarzmarkt in der Möhlstraße drei Leica Kameras eingetauscht. Es waren Vorkriegsmodelle, damals wie heute wertvoll, und meine Eltern konnten mit dem Erlös die Miete für ein halbes Jahr zahlen. Jetzt sitze ich im Gefängnis, weil ich mit meiner Leica einen Nazi ins Koma geschlagen haben soll.
DC-3
Einmal wählten wir das Flugzeug für unsere Atlantiküberquerung, eine DC-3. Wir landeten für einen Tankstopp in Neufundland und als die Maschine wackelnd aufsetzte und nach dem Rollen zum Stehen kam, öffnete sich die Kabinentüre. Das laute, dumpfe Brummen der Motoren verstummte. Ich hörte den pfeifenden Wind auf dem Flugfeld und Männer mit Schnee auf ihren Schultern und Pelzmützen kamen ins Cockpit. Dunkle, angsterregende Figuren.
Sie waren harmlos, sammelten Müll ein, brachten Essen und bewegten sich dabei geschickt im steil nach oben verlaufenden Kabinengang.
Nach langem Flug landeten wir in London und das Hotel, in dem wir die Nacht verbrachten, erlebte ich als alt und dunkel im Gegensatz zum hellen Kanada. Ein penetranter Geruch nach Mottenkugeln durchzog das ganze Gebäude. Mit dem Zug fuhren wir weiter nach München. Die Nachtbeleuchtung tauchte unser Abteil in blaues Licht und ich sah die am Fenster vorüberziehenden Ortschaften mit ihren fernen Häusern als rötliche, flackernde Lichtpunkte. Sie erweckten in mir die Sehnsucht nach einem geborgenen Zuhause.
In München holte uns ein Bekannter am Hauptbahnhof ab. „What an old car“, bemerkte ich beim Anblick seiner schwarzen Mercedes Limousine. Ich war aus Kanada die amerikanischen Straßenkreuzer gewöhnt. Er nahm es humorvoll und lächelte, dann fuhren wir über die mit dickem Ruß bedeckte Hackerbrücke zu ihm nach Hause.
22:11Der Rücken schmerzt weiter auf der harten Pritsche. Fast unerträglich. Mein Blick richtet sich zur Türe, weil ich auf dem Gang Schritte höre. Vermutlich steht ein Vollzugsbeamter vor dem Türspion und sieht nach mir.
Da ist ein Bild aus Halifax, das mein Gedächtnis über 50 Jahre nicht freigegeben hat. Ich sitze allein auf der Veranda eines Holzhauses in dieser kleinen Hafenstadt und warte auf den Milchmann. Er kommt jeden Morgen, der Anblick des von einem dürren Gaul langsam gezogenen Wagens ist vertraut. Er bringt die gefüllten Flaschen zum Haus und grüßt freundlich.
An diese weißen Milchflaschen musste ich später denken, als ich in München die Milch vom Laden in einer klapprigen, verbeulten Blechkanne holte. Die Bilder sind belanglos und dennoch treiben sie mir Tränen in die Augen.
Unsere Habseligkeiten wurden über den Ozean stets per Schiff verfrachtet und brauchten teils Monate bis zur Ankunft in Halifax oder Toronto. Ich wartete sehnsüchtig auf mein Spielzeug, bis endlich der Lastwagen vor unserem Haus anhielt. Es war ein sonniger Tag. In einer Transportkiste aus rohem Holz kamen die schon fast verloren geglaubten Schätze aus München an. Für die Eltern Porzellan und Decken und für mich mein Teddybär, verpackt in Holzwolle.
22:12Ein angenehmes Gefühl von Freude und Ruhe erfasste mich damals und berührt mich auch jetzt, nach so vielen Jahren, eingesperrt in der Ettstraße. Ein Gefangener nahe meiner Zelle poltert gegen die Türe. Ein unverständliches Schimpfen mündet in einen lauten Weinkrampf. Er schlägt gegen das schwere Eisen.
Wieder Schritte auf dem Gang. Die Beamten versuchen, ihn zu beruhigen. Doch er schreit, weint. Es wird lauter. Dieser Mann – vielleichtein Dieb oder ein Dealer oder ein Unschuldiger – wurde wie ich seiner Freiheit beraubt.
Ich muss an den blutenden Kopf von Hintermoser denken. Die Nazis werden sich rächen wollen. Als die Kamera über die Absperrung flog, war es schon dunkel. War es tatsächlich Hintermoser, der mit blutendem Kopf zu Boden stürzte? Ich wurde so schnell verhaftet, mit mir wurde so rüde umgegangen. Wollte die eine freundliche Polizistin mich mit ihrem Lächeln in Sicherheit wiegen? Nicht auszuschließen, dass man mir einen geplanten Anschlag auf Hintermoser anhängen will.
Mit diesen wilden, paranoiden Fantasien steigt meine Angst. In dieser Zelle bin ich nicht sicher.
In wissenschaftlichen Abhandlungen habe ich gelesen, dass im Phänomen des Lebensfilms mehr als nur ein wahrer Kern stecken soll: Menschen sehen kurz vor dem Tod ihr Leben wie in einem Film an sich vorüberziehen. Ähnlich empfinde ich jetzt die Bilder aus meiner Kindheit. Bilder, die seit Jahrzehnten verborgen waren.
Als meine Eltern entschieden, ihre Zelte in Kanada endgültig abzubrechen und nach München zu fahren, um dort zu bleiben, weinte ich tagelang. Unsere vorherigen Deutschlandbesuche waren mir in schlechter Erinnerung geblieben. München sah ich nur in Grau und Schwarz und verstand die Menschen dort nicht. Ich hatte bis dahin fast nur in Kanada gelebt, sprach nur Englisch.
Mein Onkel Saul in Halifax, ein Möbelhändler, erwog meine Adoption. Der kleine Junge mit dem blonden Lockenkopf sollte nicht dem Täterland zurückgegeben werden. Die Eltern verließen Halifax jedoch überraschend und schnell mit meiner Schwester und mir, ohne die Verwandten zu unterrichten. Natürlich kam eine Adoption nicht in Frage.
Die folgenden Jahre sollten vom Drama der Scheidung meiner Eltern überschattet sein. Und wie so häufig litten wir als Kinder unter den Folgen ganz besonders.
22:35Ich höre den Atem einer Person vor meiner Zelle. Will sie reinkommen oder nur durch den Spion nach mir sehen? Wenn sie mit bösenAbsichten käme, ich könnte mich nicht wehren. Weder mit bloßen Händen noch mit einer schweren Kamera.
Für einige Sekunden steht mein Herz still. Dann höre ich in der Stille kleine, leise Schritte, die sich langsam entfernen. Die Gefahr scheint gebannt und ich versuche, mich mit der unglaublichen Geschichte der ersten Begegnung meiner Eltern abzulenken. Erfahren habe ich sie von meinem traurigen Onkel Bernstein in seinem Pelzladen in der Sonnenstraße, als ich älter war und die Zeit in Kanada schon sehr fern schien. Meine Eltern selbst haben nie ein Wort darüber verloren.
Eine unmögliche Ehe
Sie trafen sich in München, genau ein Jahr vor meiner Geburt, im schönen Garten einer im Krieg unzerstört gebliebenen Villa in Laim am Fröbelplatz. Bekannte meiner Mutter waren gemeinsam mit meinem Vater geschäftlich unterwegs, sie wollten im Keller des Anwesens Mehl aus Beständen der US-Army lagern. Also traf mein Vater meine Mutter in diesem schönen Garten, er sah sie an, sein Gesicht wurde kreidebleich, er sackte zusammen. Sie glich seiner ersten von den Nazis ermordeten Frau bis aufs Haar. Diesen Anblick konnte er nicht ertragen.
Die unglaubliche Ähnlichkeit bestätigte mein Onkel Bernstein. „Sie ist ein Abbild meiner gottseligen Schwester und so schön, wie sie es war.“
Wenige Monate nach ihrer ersten Begegnung heirateten sie. Dabei hätte das Paar nicht ungleicher sein können: Mutter, die in der Kriegszeit versteckt worden war, sah in Vater einen Prinzen, der ihr zur Flucht aus dem Täterland verhalf. Sie war noch so jung, keine 18 Jahre alt. Vater war gutaussehend, er liebte die Frauen, und sie liebten ihn. Er wollte sich ein von den Nazis genommenes Leben zurückholen – und weit schlimmer: Er sah in seiner jungen Frau eine Verbindung zu seinem Vorleben. Das alles war absurd. Diese Ehe konnte nicht gut gehen.
23:00Einige Gefangene rufen aus ihren Zellen. Sie klingen verzweifelt. Kirchenglocken läuten. Kommt der Klang vom Turm der Frauenkircheoder vom Alten Peter? Ich zähle elf Schläge. Oder waren es zwölf? Die Zeit vergeht unendlich langsam, verschwimmt.
Von fern höre ich wieder Schritte auf dem Gang. Ich stehe schnell auf, mir schwindelt, und stelle mich in eine Ecke der Zelle neben das Waschbecken. Es ist die größtmögliche Entfernung zur Türe und ein hilfloser Versuch, mich gegen einen möglichen Angriff zu wehren.
Zögerlich dreht jemand den Schlüssel im Schloss und öffnet die Metalltüre. Von außen fällt ein schmaler Lichtstreif in meine Zelle. Der Beamte fragt, ob alles in Ordnung sei, und ich nicke mit unbewegter Miene, denke: In der momentanen Situation hilft nur, unterwürfig zu schweigen, bevor sie auf mich losgehen. Der Mann dreht sich wieder zur Türe, verlässt den Raum und schließt sie von außen. Für mehrere Sekunden halte ich den Atem an, bis seine Schritte sich weiter entfernen und verklingen. Warum diese ständigen Kontrollen? Wollen Sie mich in die Raserei oder den Suizid treiben? Es wird ihnen nicht gelingen.
Nun sollten wir also in München bleiben. Meine Schwester und ich wohnten bei Verwandten in Laim, nicht in der schönen alten Villa am Fröbelplatz, sondern in einer kleinen Zweizimmerwohnung im fünften Stock eines Genossenschaftsbaus. Meine Eltern lebten in Scheidung. Mutter hatte einen neuen Mann kennengelernt und war mit ihrem Künftigen nach Süditalien gezogen, Vater lebte mit seiner Lebensgefährtin und ihrem Sohn in Neuhausen.
Ich litt und fühlte eine tiefe Trauer über die verlorene Mutter, suchte sie auf den Straßen und wartete ständig auf ihre Rückkehr.
23:04Diese Angst vor einem unwiederbringlichen Verlust, ein Gefühl der großen Hilflosigkeit, habe ich bis heute nicht verloren. Es überwältigt mich auch in diesem Augenblick in meiner Gefängniszelle in der Ettstraße.
Unsere Eltern versuchten, ihr schlechtes Gewissen mit süßen Geschenken zu erleichtern – aus dem fernen Italien oder bei Besuchen in der Neuhauser Wohnung. Die Trauer von mir und meiner Schwester konnten sie damit nicht aufhellen.
Gelegentlich nahm mein Vater mich mit zu Freunden. Er war stolz auf seinen Sohn und wollte diesen Stolz mit anderen teilen.
In der kleinen Wohnung seiner Freunde spielte jemand auf einer Geige und fast alle Männer und Frauen hatten Tränen in den Augen oder weinten offen. Sie redeten mit mir wie mein Vater. Sie sprachen Jiddisch, nannten mich Jingele, umarmten mich und fuhren zärtlich durch mein Haar. Einige sangen zur Melodie der Geige, leise und langsam, und blickten dabei auf den Boden. Plötzlich begann eine junge Frau laut zu schreien. Dann ein bebendes Schluchzen, sie rief fortwährend nach dem gleichen Namen und sank zusammen. Mein Vater führte mich schnell in ein anderes Zimmer. Welches Geheimnis wollten sie vor mir verbergen? Ich musste an meine Mutter denken, die verschwunden war und mir fehlte. Warum war sie nicht hier? An wen dachten diese unglückliche Frau und die Freunde meines Vaters? Eine Dame in einem bunten Kleid kam, brachte mir Schokolade und küsste meine Wangen. Sie nahm mich in den Arm und bat uns, bald wieder zu kommen. Sie war schön und warmherzig und ich sah sie leider nie wieder.
Im Alter von fünf, vielleicht auch schon sechs Jahren kam ich dann in die Volksschule an der Fürstenrieder Straße. Mir erschien die Schule im Vergleich zu den Gebäuden in Kanada wie eine uralte Bruchbude. Die Wände waren dunkel, die Holztreppen knarzten laut und die Schulbänke im großen Klassenzimmer waren mit unzähligen Tintenklecksen beschmiert. Die Kinder und Lehrer waren mir überaus fremd und der schönste Augenblick war der laute Gong zum Unterrichtsende. Meine Gedanken kreisten um den Verlust der Mutter und nicht um das ABC oder das Kleine Einmaleins.
Gelegentlich verließ ich die Wohnung. Nicht, um mit den anderen Jungs zu spielen, sondern um meine Mutter in den umliegenden Straßen und auf dem Fröbelplatz zu suchen.
Sie kam nicht wieder, doch mein Vater nahm uns zu sich. Seine neue Frau – die dritte, die er geheiratet hatte – sollte nun meine neue Mutter sein. Sie war einfühlsam, konnte aber die Sehnsucht nach meiner richtigen Mutter nicht verstehen. Weshalb trauerte ich einer Frau nach, die mich in ihren Augen herzlos verlassen hatte?
Ich kam auf eine neue Volksschule in Neuhausen, sie lag in der Südlichen Auffahrtsallee. Auch dort vermochte ich dem Unterricht kaum zu folgen, zumal die Umschulung kurz vor Ende des Schuljahres erfolgte. Meine seelischen Qualen setzten mir auch körperlich zu. Die Klassenlehrerin empfahl der Stiefmutter in einem Gespräch meine Versetzung in die Sonderschule.
23:10Ich suche nach guten Bildern aus dieser Zeit … Da war das nagelneue Opelkabrio in Kanariengelb mit schwarzem Verdeck. Für mich war es ein Stück Kanada und mein Vater parkte den Wagen auf der gegenüberliegenden Straßenseite. So konnten wir das Kabrio von der Erdgeschosswohnung aus immer gut sehen und bewundern. Ich freute mich über die neidvollen Blicke der Nachbarn, die mit uns und wir mit ihnen kaum ein Wort wechselten.
Onkel Oskar
Mein Lichtblick in diesen Tagen war Onkel Oskar. Er war klein und schmächtig, trug stets einen grauen Anzug und einen dazu passenden grauen, abgewetzten Hut, den er auch in der Wohnung aufbehielt. Sein Geld verdiente er als Kürschner bei meinem Vater. Er war oft pleite, denn seine Leidenschaft war die Pferderennbahn. Zweimal wöchentlich kam er zu uns in die Wohnung und unterrichtete mich in Hebräisch, Schreiben und Lesen. Mit einem Zahnstocher deutete er in seinen Büchern auf die Buchstaben, die ich lesen sollte. Dann nahm er den Zahnstocher wieder in den Mund und kaute mit seinen vergilbten und kaputten Zähnen darauf herum. Er war Kettenraucher und blickte immer nervös nach allen Seiten.
Leider war ich nicht wirklich verwandt mit ihm. Ich hatte in Deutschland keine Verwandten, weil sie ermordet worden waren, wie ich später erfuhr, und wenn jemand kam und mein Onkel sein sollte, so glaubte ich das. Ich wollte es glauben.
Onkel Oskar ging liebevoll mit mir um. Er stärkte mein Selbstbewusstsein, denn während ich in der Schule nur wenig behalten konnte, lernte ich an seiner Seite schnell das Hebräisch der Thora zu lesen und zu schreiben, mit allen Vokalen. Bei ihm fühlte ich mich geborgen, in der Schule war ich fremd. Seine Erzählungen aus der Bibel zogen mich in den Bann. In jüdischen Belangen war er gebildet, denn er kam aus einer polnischen Rabbinerfamilie. Wenn er von dieser Vergangenheit erzählte, blickte er dabei ins Leere. Wie die meisten Überlebenden war er gebrochen. Seine Hoffnung war Israel. Onkel Oskar war Zionist und sein Plan war auch meine Auswanderung ins gelobte Land. Ich teilte schnell seine Begeisterung und wähnte mich schon wieder im Flugzeug oder auf dem Schiff.
Einmal, nach dem Alef-Beth-Lernen, legte er feierlich ein in braunes Packpapier eingeschlagenes größeres Buch auf den Tisch. Es war mit einer groben Schnur umwickelt, die mehrfach zugeknotet war. Ich durchschnitt sie, entfernte das Packpapier und hatte ein Buch mit dickem Kartoneinband in der Hand, das einen seltsamen Geruch nach Druckerschwärze und Mottenkugeln verströmte. Auf dem Buchdeckel war ein Panzer mit aufgemaltem Davidstern abgebildet, der durch die Wüste fuhr. Die schweren Ketten wirbelten den Sand auf. In der offenen Luke stand ein junger Soldat mit nacktem Oberkörper. In seiner rechten Hand hielt er ein Gewehr, die linke spreizte er zum Victory-Zeichen.
Das Buch mit vielen Fotografien und wenig Text war eine hymnische Schilderung des israelischen Unabhängigkeitskrieges von 1948. Onkel Oskar erzählte mir von diesem Krieg, als wäre er dabei gewesen, die Fotos in schwarz-weiß waren der Beweis. Die jüdischen Kämpfer in Israel waren Helden und trotzten dem Feind. Ich lernte dank Onkel Oskar nicht nur Hebräisch, sondern auch eine Vision jüdischen Lebens, die nicht von Trauer und Tod gezeichnet war.
Das Buch wurde zu meinem ständigen Begleiter. Ich durchblätterte es, wann immer es ging. Meine Spielzeugautos wurden in meiner Fantasie zu Panzern, an denen ich kleine Papierfähnchen mit Davidstern befestigte. Zur Schule durfte ich das Buch nicht mitnehmen. Niemand sollte wissen, dass meine Familie jüdisch war.
Nach einem halben Jahr endete der Unterricht mit Onkel Oskar abrupt. Die näheren Umstände seines Todes erfuhr ich nicht. Mein Vater erklärte, er sei nun zu seiner Familie zurückgekehrt, was ich nicht verstehen wollte, weil auch ich Familie für ihn gewesen war. Ich vermisste ihn als Freund und Lehrer, am meisten aber seine Erzählungen über das Land Israel, das er nie hatte betreten dürfen.
23:15Auf dem Gang höre ich schon wieder Stimmen und Schritte. Das Bild meiner kleinen Matchbox-Autos mit Israelflagge weckt die Erinnerung an zwei junge Israelis, die sicherlich schon beim israelischen Militär unter der gleichen Flagge Dienst geleistet hatten und vor gar nicht langer Zeit hier in der Ettstraße eingesperrt wurden, weil sie im Kaufhof auf Diebeszug gewesen waren. Schnell hatten sich in der jüdischen Gemeinde Spender gefunden für die Bezahlung eines Anwaltes und der Kaution. Als Gemeindevertreter ging ich zum Gefängnis, leistete die Vorauszahlung für den Anwalt und übergab den Rest den Israelis. Sie blieben mehrere Tage eingesperrt, waren nicht unschuldig und vielleicht in der gleichen Zelle wie ich.
Warum werde ich nicht freigelassen? Bin ich hier sicher vor den Nazis? Wenn Hintermoser nicht mehr aus dem Koma erwacht, werden sie mir nach dem Leben trachten.
Das Schuljahr sollte bald zu Ende sein. Meine Versetzung in die zweite Klasse der Volksschule war gefährdet. Ich vermisste Onkel Oskar. Zwischen meinem Vater und seiner dritten Frau gab es fast täglich heftigen Streit. Sie war eifersüchtig und er gab ihr zu wenig Haushaltsgeld.
Die Wohnung in Neuhausen war inzwischen zu klein geworden. Wie es meinem klammen Vater gelingen konnte, eine stattliche Doppelhaushälfte in Lochham in der Röntgenstraße anzumieten, haben wir nicht verstanden. Sie war im Landhausstil der Dreißigerjahre errichtet worden, mit einem weit nach unten gezogenem Satteldach und langen Balkonen aus dunklem Holz. Der grobe Fassadenputz war weiß gestrichen, der Garten mit Steinterrasse weitläufig, aber ungepflegt.
Gelegentlich bekamen wir Besuch. Es waren nur jüdische Familien, zumeist Bekannte aus der Pelzbranche. Wir Kinder spielten im Garten und die Erwachsenen tranken Kaffee und aßen Kuchen und sprachen vom Geschäft. Einer von ihnen war Nathan Gleichman. Seine Frau kam aus Italien und sprach leise einige Worte in Jiddisch und dann wieder Italienisch. Sie hatten einen kleinen Pelzladen in der Dienerstraße. Leidenschaftlich gern erzählten sie von der guten Zeit vor dem Krieg in Polen, von wunderbaren Kantoren in den Synagogen von Warschau, vom Jiddischen Theater, von gemeinsamen Verwandten und Bekannten. Durften wir Kinder erst danebenstehen und zuhören, wurden wir doch bald wieder weggeschickt. Aus der Ferne sah ich dann die verweinten Augen der Erwachsenen und verstand nicht den Grund der immer wiederkehrenden Traurigkeit.
23:27Ich friere stark und ein Zittern befällt mich. Neben dem Waschbecken erkenne ich erst jetzt einen kleinen Heizkörper. Aber während der Nacht schalten sie die Heizung ab. Das ist wohl normal in Zeiten des Klimanotstands.
Meran
Anfang Juni fuhren wir nach Südtirol, nach Meran. In der Schule war ich krankgemeldet. Das milde Klima sollte meinen ständigen Husten vertreiben. Da Geld wie so oft knapp war, aßen wir unregelmäßig und wohnten in den billigen Fremdenzimmern einer kleinen Weinkelterei. Vor dem Wohn- und Geschäftshaus war ein weitläufiger, mit rötlichem Sand bedeckter Platz angelegt und neben dem Haus mit unseren Gästezimmern stand ein fensterloser Holzschuppen, in dem leere wie volle Weinfässer aus Holz gelagert wurden. Der kühle Raum schützte vor der Sommerhitze.
Nicht ein einziges Wölkchen zierte den blauen Himmel. Ich genoss die Wärme und spielte gern im flirrenden, hellen Licht auf dem staubigen Hof. Wehte ein kleines Lüftchen, trug es den Geruch von Wein. Im Holzschuppen durften die Erwachsenen diesen Wein kosten und selbst die Kinderlimonade hatte einen fruchtigen Traubengeschmack.
Einige Tage nach unserer Ankunft war italienischer Nationalfeiertag. Einige Gebäude waren mit Fähnchen in grün, weiß und rot geschmückt. Die Wirtin hatte einen großen Waschzuber vor dem Haus aufgestellt und kümmerte sich mit ihren Hilfskräften demonstrativ um die Wäsche. „Das ist heute nicht mein Feiertag“, verkündete sie und das sollte jeder sehen. Sie sprach Südtirolerisch und ich verstand sie nur schwer. Als das Geld ausging, fuhr mein Vater nach Bozen, um bei einer Bank den Betrag zu holen, den mein Onkel Bernstein per Express überwiesen hatte.
Monate später saß ich bei Onkel Bernstein in München und er bemerkte, das Schuldenkonto meines Vaters würde wohl ewig weiter ansteigen. „Ich nehme es gelassen, meine Tage sind ohnehin gezählt.“ Traurig und mit Schuldgefühlen verließ ich ihn an diesem Tag.
Nach unserem Urlaub in Südtirol sah ich meinen Vater nur selten. War er zu Hause, gab es Streit mit seiner Frau. Gelegentlich durfte ich ihn in die Pelzwerkstatt in der Lipowskystraße begleiten. Dort saßen junge Frauen an laut surrenden Maschinen und nähten die kleinen Pelzstücke zusammen. Die Kürschner standen in weißen Arbeitskitteln an langen Tischen und schnitten die Felle schnell und geschickt mit Spezialmessern in kleine, längliche Stücke. Die Werkstatt war spezialisiert auf Nerz- und Persianermäntel. Ich langweilte mich meist, aber die Angestellten behandelten mich liebevoll und mein Vater präsentierte mich mit Stolz seiner Belegschaft.
Wie fast alle Jungs meines Alters trug ich damals eine längst speckig gewordene Lederhose. Seit unserer Ankunft aus Kanada hatte ich Deutsch gelernt und einige bairische Redewendungen. Gelegentlich fiel ich ins Jiddische oder Englische. Die Jungs, mit denen ich spielte, verstanden mich und grinsten bei Worten, die ihnen fremd waren. Ich gehörte dazu – aber nicht ganz. Raufereien ging ich aus dem Weg.
Meist spielte ich mit jüdischen Kindern. Da war der Sohn eines Pelzhändlers, für den mein Vater Mäntel in Lohnarbeit fertigte. Sein Chauffeur holte mich eine Zeit lang jeden Sonntag ab und brachte mich ins Lehel in die Reitmorstraße. Ich hatte eine Tasche voller Spielzeugautos unter dem Arm. Der kleine Ben saß in einem Plüschsessel und hielt eine große Zeitung in seinen Händen. Das war für mich anfangs ein befremdlicher Anblick. Ich schob meine Autos auf dem Perserteppich umher und er las mit fünf oder sechs Jahren die Nachrichten oder tat zumindest so. Nach etwa zwei Stunden war die Spielzeit zu Ende und ich wurde wieder nach Hause chauffiert.
Als ich so an einem warmen Sommertag in Begleitung von Bens Vater und seinem Fahrer das Haus verließ, hörte ich Geschrei von der Straße. Auf dem Gehsteig stand ein Ehepaar, laut streitend. Die Frau weinte hysterisch und ihr Ehemann versuchte sie verzweifelt festzuhalten und zu beruhigen. Als ich näher hinsah, erkannte ich, dass die Frau schön und völlig unbekleidet war. Sie riss sich unversehens los und lief, wie Eva vor dem Sündenfall, schräg über die Straße. Ich konnte meine Blicke von ihr nicht abwenden, bis Bens Vater seine Hand vor meine Augen hielt und auf Jiddisch sagte: „Schau weg, die ist meschugge.“
Jom Kippur
Zu den hohen Feiertagen nahm uns Vater mit zum Gebet. An nur drei Tagen im Jahr, am Neujahrs- und Versöhnungsfest, gingen wir in die Synagoge. Ich mochte die feierliche Stimmung und den Geruch und die Wärme der unzähligen Gedenkkerzen.
Während die Erwachsenen an Jom-Kippur beim Jiskor-Gebet ihrer toten Angehörigen gedachten, verließen wir Kinder den Gebetssaal, spielten währenddessen draußen und standen am Gitter des rauschenden Stadtbaches, der durch den Hof floss. Das Bachbett war mit dichtem, glitschigem Moos bewachsen. Der Geruch des schnell fließenden grünen Wassers erinnerte mich an das brackige Meerwasser, das in den kanadischen und deutschen Häfen die Ozeandampfer umspült hatte.
Nach dem Jiskor gingen wir zurück in die Synagoge, zum Platz meines Vaters. Neben ihm stand Onkel Bernstein. Wir sahen, dass beide geweint hatten. Sie wischten sich die Tränen aus dem Gesicht und blickten verlegen nach vorn zum Thoraschrein. Ich verstand nicht, dass sie in die Synagoge gingen, um dort zu weinen.
Im späten Herbst war meine Mutter mit ihrem Mann von Italien nach München zurückgekehrt. Sie hatten eine Wohnung mit Büro in der Gotzinger Straße, im ersten Stock eines Eckhauses nahe der Großmarkthalle bezogen. Wir telefonierten nach ihrer Rückkehr nur einmal und das Gespräch war kurz und verlief sehr einsilbig. Sie erzählte, dass ich ein Brüderchen bekommen hatte.
Die Stimmung zu Hause wurde zusehend schlechter, die Streitereien zwischen meinem Vater und seiner Frau unerträglich. Er verließ am frühen Morgen das Haus und kam erst am späten Abend oder überhaupt nicht zurück. Wir aßen selten gemeinsam und wenn ich mit ihm sprechen wollte, musste ich das gleich nach dem Aufstehen tun, während er seine blütenweißen Hemden anzog und ich ihm die Manschettenknöpfe anlegen durfte. Dann schimpfte er über seine Frau, über meine Mutter und über die Deutschen. Häufig spuckte er vor Zorn auf den Boden. „Sie saugen mir das Blut aus den Adern und wollen nur mein Geld.“ Wenn er dann mein verstörtes Gesicht sah, lächelte er mich an, strich mir durchs Haar und gab mir eine Münze. „Mach dir damit einen schönen Tag.“ Anschließend verließ er grußlos das Haus und knallte die Türe zu.
23:40Als ich kurz vor dem Abitur stand, erzählte mir mein Vater, wie er im Lager – er wurde bei Kriegsende in Flossenbürg befreit – einen SS-Mann erschlagen hätte. Er redete sich dabei in Rage, beschrieb genau, wie er im Steinbruch mit seiner Spitzhacke auf den SS-Mann eingeschlagen hatte, bis er stark blutend zusammengesackt und tot war. Er sei nicht der Einzige gewesen und es stünden noch viele Rechnungen offen.
Das alles kann sich nur in der Fantasie meines Vaters abgespielt haben, denn wäre es während seiner Gefangenschaft geschehen, hätte er das Konzentrationslager niemals überlebt. Er aber glaubte an diese Morde, in ihm waren sie Jahrzehnte später zur Realität geworden. Den Gedanken, den Deutschen völlig hilflos ausgesetzt gewesen zu sein, konnte er nicht ertragen.
Wir sind Juden und feiern kein Weihnachten
Das Weihnachtsfest nahte. Die Kinder, mit denen ich um die Häuser zog, hatten nur ein Thema: Den Heiligen Abend und was das Christkind ihnen bringen würde. Sie übertrafen sich in ihren Hoffnungen nach vielen und großen Geschenken. Da ich beharrlich schwieg, fragten sie immer nachdrücklicher nach meinen Wünschen. Sollte ich erzählen, dass wir Weihnachten nicht feierten? Dass in unserem Wohnzimmer kein festlich geschmückter Baum stand und dass ich kein Christ war? Dass wir schon vor einigen Wochen die Kerzen der Chanukkia entzündet hatten und ich nur ein kleines Matchboxauto bekommen hatte?
Mein Desinteresse am Weihnachtsfest konnten und wollten sie nicht verstehen. Sie bohrten weiter, ob ich am Heiligen Abend nach der Bescherung mit in die Kirche kommen wollte?
Ich war in einer misslichen Situation. Natürlich wäre ich zu Weihnachten auch gerne reichlich beschenkt worden. Doch zu Hause war das Thema tabu. Dann dachte ich an unsere Synagogenbesuche. In der Kirche betete man sicherlich wie in der Synagoge. Ob man dort auch weinte?
Und dann platzte es aus mir heraus: „Wir sind Juden und wir feiern nicht Weihnachten, sondern Chanukka.“
Die Kinder starrten mich an. „Das kann nicht sein, dass ihr kein Weihnachten feiert. Alle feiern Weihnachten.“
„Nein, wir nicht.“
Weil sie es nicht verstanden, wurden die Kinder zornig. „Du weißt schon, dass die Juden Jesus Christus ans Kreuz genagelt haben!“
„Nein, haben sie nicht!“
Sie sahen mich immer noch wütend, aber auch mitleidsvoll an und ich wollte nur noch weg, lief wortlos davon, nach Hause, und sperrte mich in meinem Zimmer ein.
Am Weihnachtsabend saßen wir zusammen. Es gab Wiener Würstel mit Kartoffelsalat, keine Geschenke und keinen Christbaum. Mein Vater kam erst gegen elf Uhr abends. Hatte er Weihnachten mit der Kusine seiner Frau gefeiert? Hatte meine Stiefmutter Grund zur Eifersucht? Es gab wieder Streit und Geschrei. Eine Woche später, an Silvester, kam es zum nächsten unvermeidlichen Drama und wir Kinder waren einbezogen. Ohne Vater erwarteten wir den Jahreswechsel. Es gab Weißwürste und kurz vor Mitternacht Kuchen. Er kam spät, nachdem wir auf der Terrasse das Feuerwerk der anderen bewundert hatten. Er war angetrunken und seine Frau fragte, wo er gewesen sei. Er reagierte nicht und dann flogen und zerbarsten Gläser. Ein gläserner Lüster fiel von der Decke. Es gab körperliche Gewalt. Auf dem Boden war Blut zwischen den vielen Glassplittern.
In dieser chaotischen Situation rief mein Vater meine Mutter an und bat sie verzweifelt, uns Kinder abzuholen. Er hatte dabei Tränen in den Augen wie damals beim Abschied im Hafen von Halifax. Nach einer halben Stunde stand am frühen Morgen des neuen Jahres der Borgward meines Stiefvaters vor unserer Haustüre. Er holte uns zu sich, zu meiner Mutter und ihm in eine neue Wohnung in Sendling. Sie war deutlich beengter als die Doppelhaushälfte in Lochham, es gab keinen ruhigen Garten. Stattdessen ratterten die mit Obst beladenen schweren Lastkraftwägen Tag und Nacht über das Kopfsteinpflaster der Gotzinger Straße zur Großmarkthalle.
Mein Stiefvater Nicky betrieb mit einem Kompagnon einen Export- und Importhandel für Südfrüchte. Gemeinsam saßen sie in einem kleinen Büro an einem großen Schreibtisch mit mehreren Telefonen. Fasziniert war ich vom Fernschreiber. In einem Holzkasten von der Größe eines kleinen Schreibtisches drehte sich im oberen Teil eine Papierrolle, auf die über eine darunter liegende Tastatur wie bei einer Schreibmaschine Texte geschrieben werden konnten. Daneben war eine Wählscheibe installiert. Mit ihr wurden andere Fernschreiber kontaktiert.
Oft telefonierte Stiefvater mit Italien. Er sprach laut – es waren Ferngespräche – und fließend Italienisch mit seinen Geschäftspartnern in Süditalien, die er gut kannte. Er hatte schließlich mit meiner Mutter dort knapp zwei Jahre im Auftrag eines großen Münchner Importeurs verbracht, bevor er sich in die Selbstständigkeit gewagt hatte. Da Nicky und sein Kompagnon mit schnell verderblicher Ware handelten, gab es oft viel Hektik und Aufregung. Sie machten riskante Geschäfte und zockten mit hohen Einsätzen.
Judenkind
Ich musste erneut die Schule wechseln und besuchte nun die dritte Klasse in einem großen alten Gebäude an der Implerstraße, nahe unserer Wohnung. Mein Schulweg führte durch die Gotzinger Straße, wo es einen kleinen Tabakladen mit Schreibwaren gab. Ich durfte dort für meinen Stiefvater Zigaretten der italienischen Marke Muratti und für mich Stifte und Schulhefte kaufen. Der Ladeninhaber war nett zu mir und schenkte mir bei jedem Besuch ein kleines Papiertütchen mit Brausestangen, die ich liebte, weil sie im Mund so köstlich kitzelten. Wir kannten uns, denn er saß in der Synagoge nur wenige Bänke entfernt. In seinem Laden fühlte ich mich wohl, vor allem gab es keine merkwürdigen Fragen.
Woher kommst du? Wo bist du geboren?
Ich sprach mittlerweile Bairisch, sah aber nicht so aus. Ein Junge, mit dem ich gelegentlich den Schulweg teilte, meinte einmal, ich erinnerte ihn an ein altes Foto von einem Judenkind mit großer Nase.
Mein Stiefvater war nicht jüdisch, er war Atheist und kannte meinen Vater aus Zeiten, in denen sie gemeinsam Schwarzmarktgeschäfte betrieben hatten. Sie konnten sich gut leiden. Selbst als der Scheidungskrieg zwischen meinen Eltern entbrannt war, sprachen sie noch miteinander und vereinbarten, nachdem wir zu Nicky und unserer Mutter nach Sendling gezogen waren, an den Anwälten vorbei, dass wir Kinder jedes zweite Wochenende bei unserem Vater sein sollten.
Daddy hatte sich von seiner dritten Frau getrennt und wohnte nun bei ihrer Kusine mit deren beiden Söhnen, ungefähr in meinem Alter. Ihre Wohnung lag in der Kolumbusstraße. Sie war zuvor mit einem amerikanischen GI verheiratet gewesen, hatte die amerikanische Staatsangehörigkeit. An den Besuchstagen holte mein Vater mich mit seinem neuen hellblauen Mercedes ab. Ich wollte nicht zu ihm. Zu frisch waren meine Erinnerungen an die schreckliche Silvesternacht und an den ständigen Streit. Er minderte mein Unbehagen, indem er den Traum eines jeden Jungen erfüllte. Ich durfte sein neues Auto mitlenken, saß zwischen seinen Beinen auf dem Fahrersitz, drückte mit meinen Füßen das Gaspedal und spürte, wie sich der Wagen durch mein Zutun beschleunigte.
Ich hatte nun also einen Stiefvater, den ich oft als strengen zweiten Vater wahrnahm, ich hatte eine Mutter, die sich überwiegend um ihren Jüngsten, meinen Stiefbruder, kümmerte, meinen Vater und seine neue Frau, meine neue Stiefmutter. Der Kontakt zur jüdischen Gesellschaft war dagegen abgebrochen. Meine Mutter verband mit ihrem Judentum nur Leid und Verfolgung. Für sie war die atheistische Haltung ihres Mannes ein sehr pragmatischer Weg, den auch sie beschritt.
Gelegentlich durfte ich meinen Vater in ein Café nahe des Königsplatzes begleiten. Es war ein runder, flacher Nachkriegsbau auf einem Eckgrundstück, auf dem einst ein Wohnhaus gestanden hatte. Dort saßen sie über Stunden – Männer und Frauen, die leise Jiddisch und Polnisch redeten, Tee und Wodka tranken.
Eine der Frauen fragte mich freundlich, wie es meiner Mutter ginge, die sie wohl kannte. Dabei lächelte sie gewinnend, während mein Vater seinen Arm um ihre Hüfte schwang. Was sollte ich sagen? Leise antwortete ich der elegant gekleideten Frau, dass meine Eltern in Scheidung lebten. Darauf löste sie sich aus der Umklammerung meines Vaters und schimpfte auf ihn ein: „Du schlechter Mensch, was hast du nur getan?“ Mein Vater war verärgert: „Rachele, wie redest du mit mir?“ Er ließ uns stehen und ging zu seinen Freunden, sie unterhielten sich angeregt. Nach einer halben Stunde holte er die Mäntel und wir gingen. Im Wagen meinte er, man dürfe Rachele nicht böse sein. „Sie hat mir erzählt, du würdest sie an ihren Sohn erinnern. Sie hat ihn im Lager verloren.“ Ich verstand nicht, wie sie ihren Sohn dort verlieren konnte. Vielleicht war er gestorben? Ich hatte Mitleid mit ihr, auch weil sie hinkte.
Die Welt meines Vaters war oft traurig und sein Handeln widersprüchlich. Er hob mich in den Himmel, wenn wir in jüdischer Gesellschaft waren. In Gegenwart seiner neuen Frau lobte er deren Söhne und meinte, ich solle mir an ihren schulischen Erfolgen ein Bespiel nehmen. Jedes Mal kamen mir dabei die Tränen.
Zu Hause bei Nicky und meiner Mutter gab es keine Trauer. Mein kleiner Bruder und der Obsthandel standen im Vordergrund. Nicky und sein Geschäftspartner hatten inzwischen einen Stand in der Großmarkthalle und ein Büro im Kontorhaus. Es gab keine Geldsorgen, gute Laune bei guten Geschäften und schlechte Laune, wenn in den Waggons verdorbenes Obst oder überhaupt keines ankam, weil der italienische Zoll am Brenner wieder streikte. Gelegentlich besuchte ich Nicky nach der Schule in der Halle an seinem Stand. Er war fast täglich ab fünf Uhr morgens dort, saß im kleinen Büro und addierte die Verkäufe mit einer mechanischen Rechenmaschine. Seine Kollegen waren freundlich, viele sprachen Italienisch und Bairisch mit Münchnerischem Klang. Obst gab es reichlich und an einem der hinteren Stände bis Mittag frische Weißwürste mit großen Brezen. Die Italiener in der Halle sprachen mit mir Italienisch, weil ich südländisch aussah. Wenn ich dann fragend Nicky ansah, meinte er: „Felix ist ein echter Bayer, sprecht Deutsch mit ihm.“
In dieser Welt fühlte ich mich wohl und unbeschwert. Es wurde gelacht, es flossen keine Tränen. Schwierig wurde es nur, wenn die Sprache auf meinen Vater kam.
Er schimpfte über meine Mutter und meine Mutter über ihn. Oft kam er am Freitag zu uns, der Tag, an dem er Löhne bezahlen musste und nicht flüssig war. Nicky gab ihm dann ohne großes Aufheben, was er benötigte, und meist zahlte mein Vater seine Schulden bald zurück. Wenn nicht, überließ er Nicky zur Sicherheit einen Nerzmantel, den der dann wiederum verkaufte, wenn er nicht im Kleiderschrank meiner Mutter landen sollte. Nicky gab und Daddy nahm. Er war der Schwächere.
Beide waren meine Väter. Ich wusste nicht, auf wessen Seite ich mich schlagen sollte, und fürchtete stets die Ablehnung und Ausgrenzung von beiden.
00:00Von fern höre ich einen Glockenschlag. Ich muss aufstehen und pinkeln gehen, wie jede Nacht. Der Strahl trifft hörbar auf die metallene Kloschüssel. Mein Rücken schmerzt.
Die Miniatur einer zweirädrigen hohen sizilianischen Pferdekutsche aus Holz stand auf dem Dach von Nickys Obststand. Sie wurde von einer weiblichen Puppe mit großem Busen und langen farbigen Bändern in den Haaren gelenkt – grün, weiß und rot in den Farben der italienischen Trikolore. Geschäftspartner aus Palermo hatten die Kutsche als Geschenk mit nach München gebracht, das kleine Kunstwerk war schon von Weitem sichtbar.
Zu Hause gab es neben dem Geschäft ein neues Thema: Meine Eltern hatten ein freistehendes Haus mit großem Garten und Pool in Waldtrudering in der Von-Trotha-Straße gekauft. Nun galt es, die in der Vorkriegszeit errichtete Villa mit viel Holz an der Fassade in eine zeitgemäße Form zu bringen. Rundungen an der Fassade und helle Pastellfarben sollten dem dunkel wirkenden Bau einen Anschein von Avantgarde verleihen. Ein junger Architekt aus Nickys Abiturklasse wurde mit der Planung und Bauleitung beauftragt.
Die Fahrt von Sendling nach Waldtrudering war für mich wie eine Weltreise. Wir fuhren mit Straßenbahn und Bussen, mussten mehrfach umsteigen und gelangten nach eineinhalb Stunden zur Endhaltestelle „Waldesruh“. Dort gab es eine einsame Gaststätte und absolute Stille.