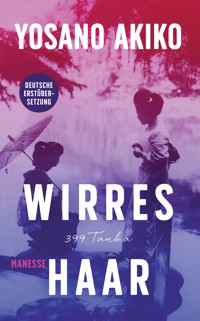16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Eine Entdeckung: Die große japanische Dichterin und Vorkämpferin für Frauenrechte erstmals überhaupt auf Deutsch!
Warum hält sich das Vorurteil des substanziellen Geschlechterunterschieds derart hartnäckig? Woran liegt es, dass Frauen in der Gesellschaft immer noch chronisch unterschätzt und benachteiligt werden? Und wie kriegen wir endlich veraltete Rollenbilder aus den Köpfen? – Diese eminent wichtigen Fragen stellte Yosano Akiko vor hundert Jahren mit unverhohlener Klarheit – und gab Antworten, die noch heute ins Schwarze treffen.
Stichhaltig und luzide plädiert die japanische Frauenrechtlerin für die überfälligste Sache der Welt: für die Gleichstellung der Geschlechter. Ihre Essays tragen programmatische Titel wie «Männer und Frauen» («Otoko to onna», 1915), «Die essentielle Gleichheit von Mann und Frau» (1916), «Frauen und politische Aktivitäten» (1915) oder «Die japanische Politik aus der Perspektive der Frauen betrachtet» (1917). Daneben erfährt man in diesem Band Essentielles zum literarischen Selbstverständnis der Dichterin Yosano Akiko und bekommt in «Aufzeichnungen aus dem Wochenbett» (1911) intime Einblicke ins Privatleben der dreizehnfachen Mutter. Den Abschluss machen zwei Fundstücke. «Aus der Grippe-Station» (1918) und «Angst vor dem Tod» (1920) schildern Pandemieerfahrungen während der Spanischen Grippe, die vor hundert Jahren auch in Japan wütete.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 133
Ähnliche
Warum werden Frauen von der Gesellschaft chronisch unterschätzt? Warum sollen sie Steuern zahlen, in der Politik aber keine Rolle spielen? Was könnten sie, die den Strapazen von Geburt und Kindererziehung gewachsen sind, nicht alles leisten, würde man ihnen dieselbe Ausbildung zubilligen wie Männern!
Mit Elan und klugen Argumenten schrieb die Dichterin und Frauenrechtlerin Yosano Akiko vor über hundert Jahren über Liebe und Politik, Mutterschaft und Macht. Selbstbewusst stellte sie auch heute noch drängende Fragen zur Gleichstellung von Mann und Frau.
Yosano Akiko (1878–1942, eigentlich Shō Hō) stammte aus einer Kaufmannsfamilie aus Sakai nahe Osaka, führte bereits mit elf Jahren die Geschäfte der Familie und begann früh mit dem Schreiben. Als Verfasserin von Tanka-Gedichten, Essayistin und Übersetzerin klassischer Literatur wurde sie zu einer Schlüsselfigur des kulturellen Lebens im Japan des frühen 20. Jahrhunderts.
YOSANO AKIKO
MÄNNER UND FRAUEN
EssaysDeutsche Erstausgabe
Ausgewählt, aus dem Japanischen übersetzt und mit einem Nachwort von Eduard Klopfenstein
MANESSE VERLAG
I.
Persönliches
Mein literarisches Leben
Ich stehe unter fortwährendem Arbeitsdruck. Jeden Tag des Monats, von Anfang bis Ende, verbringe ich mit dringenden Schreibarbeiten – ein Leben, das zwar nicht von körperlicher Arbeit geprägt ist, aber noch mehr Anstrengung und Ungemach verursacht als diese. In jungen Jahren, noch zu Hause bei meinen Eltern, stellte ich mir vor, es sei nichts so einfach und erstrebenswert wie die Existenz als Literatin. Diese sah in meiner Vorstellung jedoch deutlich anders aus als heute, da sie für mich Wirklichkeit geworden ist. Wenn ich damals neben meiner Arbeit im Geschäft unserer Familie zum Pinsel griff, gelang es mir, mit ähnlichen Gefühlen wie ein vor sich hin zwitschernder Vogel meine Tanka-Gedichte zu Papier bringen. Ich war zufrieden, wenn ich einfach dichten konnte. Es gab nicht die geringste Notwendigkeit, dabei an meinen Lebensunterhalt zu denken. Jetzt aber ist die Situation eine andere. Den Schreibpinsel in die Hand zu nehmen ist nun zu meinem Beruf geworden, zur unmittelbaren Grundlage, mich und meine Familie durchzubringen. Das Vergnügen zu dichten, wie es mich gerade überkommt, ist mir zwar geblieben. Aber allein damit wäre ich nicht einmal in der Lage, für meinen eigenen Lebensunterhalt zu sorgen, geschweige denn eine Familie zu ernähren. Deshalb sehe ich mich gezwungen, den Pinsel für allerhand Auftragsarbeiten in die Hand zu nehmen, selbst dann, wenn ich keine große Lust dazu habe oder es sich gar um Texte handelt, deren Niederschrift mir nicht besonders dringlich erscheint. Populäre Inhalte lassen sich eben leichter in Geld für den Lebensunterhalt verwandeln als Texte mit eigenem künstlerischem Anspruch. Das ist auch der häufigste Grund, warum Literaten mit anfangs vielversprechenden Talenten, aber schwachem Willen irgendwann scheitern und ins Fahrwasser der Unterhaltung geraten.
Ich selbst habe, was das betrifft, gelegentlich ein ungutes Gefühl. Die Autorinnen des Genji-Romans1 und des Kopfkissenbuchs2 kannten keine solche Bedrängnis. Im Leben der talentierten adligen Damen waren Kunst und Liebe innig verschmolzen. Es war ein traumhaftes Zeitalter, ein Zeitalter, in dem sie diese irdische Welt gleich dem Paradies des Buddha genießen konnten. Gewiss, es gab auch eine Kehrseite, ein heftiges Auf und Ab im täglichen Leben als Folge der Wechselfälle in Politik und Regierungsgewalt. Dennoch traf dieses Auf und Ab die Menschen nicht so direkt oder entschied gar über Leben und Tod, wie das heute der Fall ist.3 Man war souverän genug, solche Wechselfälle als Unbeständigkeit und Vergänglichkeit dieser Welt zu beweinen, aber auch zu akzeptieren. Die heute geborenen Literaten aber werden – in einer Zeit, da sie die Literatur zur unmittelbaren Grundlage des Lebensunterhalts einsetzen müssen – wohl bedauerlicherweise nicht darum herumkommen, das Wichtigste, ihre Selbstentfaltung, zu vernachlässigen und ihr Leben, ihre Kräfte ungewollt im Interesse des populären Geschmacks zu verschwenden. Ist das, was man reine Literatur nennt, mit dem Existenzkampf dieses Jahrhunderts womöglich nicht vereinbar und zum Untergang verurteilt? Werden in einer Welt, die in jeder Hinsicht nur auf materiellen Fortschritt setzt, aus Liebe, Traum und Mysterium entsprungene zarte Gedichte keinen Platz mehr haben?
Nach erneuter Überlegung rufe ich deutlich: «Nein!!» Solche unnötigen Zukunftssorgen sind wie der Schatten eines alten Denkmusters, der mich streifte, als mir gerade für einen Augenblick das Bewusstsein abhandengekommen war, eine Frau der Gegenwart zu sein. Tapfere Leute, die in der Gegenwart leben wollen, müssen in dieser Gegenwart siegreich bestehen. Du sollst nicht vor der Menge davonlaufen! Handle wie Zarathustra: Begib dich hinein in die Menge! Auch wenn sie den Übermenschen nicht zu fassen vermag, schleiche dich wenigstens ein in die Menge!4 Das gebietet dir deine Weisheit! Damit gewinne ich meinen Mut zurück und raffe mich auf, beharrlich, soweit meine Kräfte reichen, in alle möglichen Richtungen hin meinen Pinsel walten zu lassen. Reine Literatur der überlieferten Art kann es heutzutage kaum mehr geben. Wir müssen vom gegenwärtigen «Ich» ausgehend eine Literatur mit neuen Denkweisen, in einem neuen Stil hervorbringen. Es liegt auf der Hand, dass wir heute eine dem eigenen Wesen angemessene Arbeit – das heißt literarische Produktion – zur Grundlage unseres Lebensunterhalts machen müssen. Dies in Zweifel zu ziehen hieße, dass Literatur für immer ein hohles Produkt aus früheren Zeiten bleibt – «mit Kirschblüten bekränzt/auch heute spielend»5.
Jemand hat einmal gesagt, man müsse in einer Zeit wie der heutigen zwei, drei Leben gleichzeitig führen. Damit meinte er, man solle ein Leben mit aufgesetzter Maske führen und sich damit abfinden, auch ohne Herzblut zu schreiben, um sich im Alltag durchzuschlagen. Aber auch, man solle die Literatur als Berufung zuoberst stellen und den Lebensunterhalt durch andere Tätigkeiten absichern, wie das viele zweit- oder drittrangige Künstler im Westen tun, die hauptberuflich als Anwälte, Ärzte, Bankangestellte oder Beamte arbeiten. Das ist ein wohlfeiler Rat! Wenn andere das so halten wollen, habe ich absolut nichts dagegen. Und es gibt ja wirklich nicht wenige junge Leute, die die Literatur im Auge haben, aber hauptsächlich journalistisch für Zeitungen und Zeitschriften tätig sind. Ich denke, das ist eine durchaus achtenswerte Einstellung. Aber was mich betrifft, widerstrebt es mir einfach von meinem Naturell her, mich zu maskieren. Ich hasse es, ohne Herzblut zu schreiben. Dieser Widerspruch hat mich während der letzten zwei, drei Jahren insgeheim umgetrieben.
In meiner gegenwärtigen Gemütslage halte ich mich an das Folgende und bewahre so mein inneres Gleichgewicht: An ein zweifaches, dreifaches Leben zu denken wäre für mich unbefriedigend und Anlass zur Unruhe. Was immer ich anpacke, für mich kommt nur ein simples, eindimensionales Leben in Frage. Auch in nur einer einzigen Dimension ist eine vielfältige, abwechslungsreiche Lebensweise möglich – davon jedenfalls gehe ich aus. So möchte ich selbstverständlich dann, wenn ich spontan aus mir selbst heraus etwas schaffe, aber auch wenn ich passiv, von anderer Seite aufgefordert, zum Pinsel greife, alles aufbieten, was meine Begabung hergibt, und hier wie dort dem Ergebnis meinen der Sache angemessenen «Ich»-Stempel aufdrücken. Das reine lyrische Gedicht hüte ich zwar wie den eigenen Augapfel, aber die Zeit, da es von der Menge gekauft wird, liegt in ferner Zukunft, die ich selbst nicht erleben werde. Für mich drücken Hände, Mund und Füße gleichermaßen substanziell mein Ich aus – ich überlasse das Urteil dem jeweiligen Publikum. Ich hoffe, dass es in allen meinen Schriften absolut nichts Unechtes, Unwahres gibt. Nicht nur meine Schriftstellerei, auch das Zusammenleben mit meinem Mann, die Erziehung der Kinder, alle Bereiche, die mit mir zu tun haben, sind Kategorien meiner Lebenswirklichkeit.
Selbst die Klage, ich lebte unter ständigem Arbeitsdruck, ist in Wahrheit anmaßender Luxus. Ich schaffe es trotz fehlender Zeit, pro Jahr ein-, zweimal auf Reisen zu gehen. Einen Tag und eine Nacht in einem Thermalbad – und man fühlt sich wie von Fesseln befreit, körperlich und geistig erlöst. Doch schon nach zwei, drei Tagen habe ich genug vom ländlichen Nichtstun und wünsche mich sehnlichst zurück in die Stadt mit ihren Verpflichtungen. Das leere Gefühl des Müßiggangs versetzt mich in eine trübe Stimmung, und ich verstehe, dass Leute mit empfindlichen, angespannten Nerven, besonders Frauen meines Schlages, die sich schnell einsam fühlen, das Landleben mit dem tagein, tagaus gleichen Ausblick auf die Natur nur schwer ertragen. Da kommt einem das hektische Stadtleben eben doch besser zustatten, selbst wenn man ständig von beruflichen Anforderungen bedrängt wird und kaum einen Blick rechts oder links werfen kann. Wie bedrückend – und zugleich welche Freude! Hätte ich in der Stadt keinen Beruf, wäre ich wohl noch um ein Vielfaches einsamer als auf dem Land. So betrachtet ist die Hektik ein Glück!
Die Literatur ist heutzutage zum Beruf geworden, doch ob man ihn jemandem empfehlen soll, ist eine andere Frage. Ich möchte jedenfalls meinen eigenen Kindern nicht dazu raten. In den meisten anderen Berufen findet sich jeder halbwegs gebildete Mensch irgendwie zurecht, sofern er dem ursprünglichen Denkansatz und den Gewohnheiten seiner Vorgänger folgt. Für die Kunst (des Schreibens) aber trifft das nicht zu. Hier geht es um den reinsten Ausdruck der Persönlichkeit, und es gibt nichts Erbärmlicheres als die Existenz eines unbegabten, oberflächlichen Künstlers. Nach außen hin lässt sich das vielleicht überspielen, aber die innere Qual des Betroffenen dürfte kaum zu übersehen sein. Selbst bei einer einigermaßen talentierten Person kommt es vor, dass ihre spontanen geistigen Quellen zeitweise versiegen. Sie muss dies immer wieder durch Übung und Studium wettmachen, was nicht leicht ist für jemanden, der dem Geld nachjagen muss, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Außerdem lässt sich in egal welchem Gesellschaftssystem die heftige Konkurrenzsituation zwischen Kollegen nicht vermeiden; und dann ist da auch noch etwas so Furchteinflößendes wie die öffentliche Reputation. Wer einen schwachen Willen oder einfach Pech hat, kann aufgrund der Reputation für immer in der Versenkung verschwinden. Zeigt jemand nicht schon aus innerem Antrieb eine ungewöhnliche Liebe zur Literatur, kann ich ihm, selbst wenn es sich um mein eigenes Kind handeln sollte, diesen Weg nicht empfehlen. Andererseits käme es mir nie in den Sinn, deswegen jener barbarischen Erziehungsmethode zuzustimmen, die jungen Leuten die Literatur ganz verbieten will. Mein Wunsch wäre es vielmehr, dass in allen Familien Kinder von klein auf Gelegenheit haben, Gelehrsamkeit und Künste zusammen mit frischer Luft einzuatmen.
(Januar 1912)
1Das Genji monogatari wurde zu Beginn des 11. Jahrhunderts von der Hofdame Murasaki Shikibu verfasst. Es ist das bedeutendste erzählende Werk der klassischen jap. Literatur und wird aufgrund seines Umfangs und der psychologischen Durchgestaltung seiner Figuren als erster echter Roman der Weltliteratur bezeichnet. Deutsche Ausgabe: Murasaki Shikibu. Die Geschichte vom Prinzen Genji. Übersetzt von Oscar Benl. Ergänzende Bemerkungen zur Neuauflage von Eduard Klopfenstein. 2 Bde. Manesse Verlag, Zürich 2014.
2Das Makuranosōshi wurde von der Hofdame Sei Shōnagon um das Jahr 1000 verfasst. Es handelt sich um essayistische Aufzeichnungen, die ein für die jap. Tradition typisches, bis heute nachwirkendes Literaturgenre begründeten. Deutsche Ausgabe: Sei Shōnagon. Kopfkissenbuch. Erstmals vollständig aus dem Japanischen übersetzt von Michael Stein. Manesse Verlag, Zürich 2015.
3Die Autorin denkt hier ohne Zweifel an den nur ein Jahr zurückliegenden sogenannten Hochverratsprozess gegen die Anarchistengruppe um Kōtoku Shūsui, in dessen Gefolge am 24. und 25. 1. 1911 auch offensichtlich unbeteiligte Literaten und Aktivisten verurteilt und hingerichtet wurden. Vgl. den nachstehenden Essay Aufzeichnungen aus dem Wochenbett und den Fall des dort erwähnten Arztes und Dichters Ōishi Seinosuke.
4Die erste, in klassischer Schriftsprache abgefasste Übertragung von Nietzsches Also sprach Zarathustra erschien, mit einem Vorwort von Mori Ōgai versehen, im Jahr 1911. Der Übersetzer Ikuta Chōkō lebte in der Nachbarschaft des Hauses Yosano. Akiko war von dem Werk wie von der Übersetzung offensichtlich beeindruckt. Ein Gedicht mit dem Titel Nach der Lektüre sowie einige Tanka zeugen davon. Die vorliegende Stelle nimmt auf die Vorrede des Zarathustra Bezug, ist aber kein Zitat, sondern eine auf sich selbst bezogene Ausdeutung der Autorin.
5Poetische Formel in Anspielung auf einen Vers des Manyōshū-Dichters Yamabe no Akahito (8. Jh.), überliefert in der klassischen Gedichtsammlung Shinkokin-shū alsNr. 104.
Aufzeichnungen aus dem Wochenbett
Ich liege noch immer im Entbindungszimmer des Krankenhauses Gegen Abend wird hier drinnen der Gasofen angefacht. Doch solange die Sonne scheint, ist es warm. Denn ein schöner Tag folgt auf den anderen. Zudem ist dieses Zimmer nach Süden ausgerichtet und die Veranda mit Glasschiebetüren abgeschlossen, sodass man sich nicht vor dem Wind in Acht nehmen muss, selbst wenn die mit Papier bespannten Shōji-Schiebefester teilweise offen stehen. Zwar blenden einen die Sonnenstrahlen, aber die Krankenschwester stellt dann jeweils einen kleinen Faltschirm schräg gegen die Shōji. Auf den noch neuen, duftenden Tatami steht auf einem Tischchen eine Glasvase mit Schnittblumen aus den Gewächshäusern des Botanischen Gartens Myōkaen, und etwa zehn Zeitschriften, die jüngsten Ausgaben dieses Monats, sind nebeneinander aufgereiht. Sonst liegt überhaupt nichts herum. Ein wohlgeordnetes, sauberes und ruhiges Zimmer!
Die Pflegerin hält sich im Nebenzimmer auf. Da gibt es offenbar ein Kohlenbecken, Teeutensilien, einen Handtuchständer, Wandschränke für allerhand Gerätschaften des täglichen Gebrauchs sowie einen Behälter für das Essgeschirr. Alle Besucher legen dort ihre Hüte, Überwürfe und Mäntel ab. Wenn sie vor mir erscheinen, haben sie sämtliche derartigen Hüllen zurückgelassen. Nur wenige treten in prächtiger, formeller Tracht auf, in Haori und Hakama. Die übrigen tragen Alltagsgewänder und kommen herein, ohne sich irgendwie in Szene zu setzen. Auch vermeiden sie langatmige Besucherfloskeln. Meist sagen sie nur so etwas wie: «Okusan – gnädige Frau, wie geht’s?» und beginnen gleich mit Geschichten um das kaiserliche Theater oder lassen sich über neu erschienene Romane und dergleichen aus – um sich bald darauf wieder zu verabschieden. Die offenherzige, warme Vertraulichkeit und Freundschaft dieser Menschen, die sich nicht um Formalitäten kümmern, bereiten mir große Freude.
Das sind alles Leute, die ihr Leben nicht einfach nur in einem eng begrenzten Bekanntenkreis zubringen. Und es sind auch keine Leute, die sich in einer Zeit wie der unseren, da man allein von der Kunst leben kann, bequem eingerichtet haben. Kaum haben sie sich wieder ins Nebenzimmer zurückgezogen, setzen sie sich Studentenhüte auf, andere schlüpfen in Mäntel mit Fischotterpelzkragen, und wieder andere klemmen sich ein Bündel mit Notizen für ihre Anwaltsprüfung unter den Arm und machen sich so auf den Heimweg. Sie treten aus dem Tor dieses Krankenhauses und mischen sich unter die Menge gewöhnlicher Leute. Ich kann sie in meiner Lage zwar nicht draußen verabschieden, aber ich kann mir im Großen und Ganzen vorstellen, mit welcher Verhüllung gewappnet ein jeder meiner Freunde aus dem Tor hinaustritt und sein gesellschaftlich «maskiertes» Leben fortsetzt. Da es Leute sind, die sich nicht für die Armee eignen, werden sie vom Vaterland wohl nicht überaus hoch eingeschätzt. Wenn mir solches durch den Kopf geht, muss ich unwillkürlich lächeln.
Vor dem Nebenzimmer zieht sich der Korridor hin – ein langer Korridor von vierundzwanzig oder fünfundzwanzig ken1 der sich vom Eingang bis hierhin zwei-, dreimal um Ecken windet und zu Krankenzimmern führt, die ans hügelige Gelände angepasst errichtet wurden. Das heißt, es geht überdies zwei-, dreimal steil hinauf und hinunter. Alle Personen, die ihn passieren, bemühen sich, ihre Haussandalen behutsam aufzusetzen. Denn dieser Ort hat eine Abneigung gegen alles, was tönt. Mancherorts kleben Zettel mit der Aufschrift: «Bitte leise auftreten!» Und vor gewissen Krankenzimmern soll sogar in hartem sinojapanischem Stil zu lesen sein: «In Anbetracht schwerkranker Patienten gebe man ganz besonders acht, jegliches laute Auftreten zu vermeiden!»