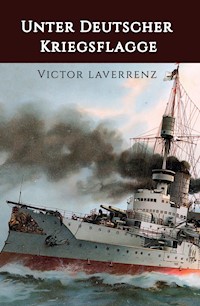Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Seiner Majestät Schiff, der Panzer "Kaiser Otto der Große", wiegte sich in den azurblauen Fluten des Mittelmeeres, wo er unweit der marokkanischen Küste der Meerenge von Gibraltar zusteuerte. Der "Kaiser Otto der Große" ist eines jener gewaltigen, modernen Kriegsschiffe, an denen die deutsche Schiffsbaukunst alle ihre neuen Erfindungen und Hilfsmittel verschwendet hat. Schwere Panzertürme und zwei eiserne Gefechtsmasten mit jenen unheimlichen, reich armierten Marsen zieren das gewaltige Deck, das in zahllosen Aufbauten in- und übereinandergeschachtelt wie ein Konglomerat stählerner Häuser emporsteigt, und ein mächtiger Rammbug springt kühn in das Wasser vor. Es ist ein trotziger und stolzer Anblick, den solch ein eisernes Ungetüm bietet, und welches Deutschen Herz schlüge nicht höher, wenn er die deutsche Kriegsflagge über dem Heck eines so stattlichen Schiffes sich wiegen sieht. schwarze Rauchmassen wirbeln aus den kolossalen Schornsteinen, und die drei Schrauben wühlen ein brausendes Kielwasser auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marinesekt
Marine-Humoresken
von
Victor Laverrenz
______
Erstmals erschienen im:
Verlag der Lustigen Blätter (Dr. Eysler & Co.) G.m.b.H., Berlin, 1918
__________
Vollständig überarbeitete Ausgabe.
Ungekürzte Fassung.
© 2020 Klarwelt-Verlag
ISBN: 978-3-96559-241-4
www.klarweltverlag.de
Inhalt.
Titel
Vorwort
Marinesekt.
Ein Salut mit Hindernissen.
Zu Wasser und zu Lande.
Durchgebrannt.
Eine folgenschwere Skatpartie.
Vorwort
Wir Deutschen haben das Glück, sie paarweise zu besitzen, die uns Heer und Flotte in bleibenden Werken verherrlichen und das Leben des Landsoldaten wie des Seemanns in eindrucksreichen, im Gedächtnis haftenden Bildern spiegeln. Neben dem glutvoll brausenden Soldatenepos Walter Bloems steht der innige Hymnus Gorch Focks, des in der Seeschlacht vor dem Skagerrak Gefallenen, „Schifffahrt ist not“. Und neben den breit behaglichen Musketier-Humoresken A. von Winterfeldts stehen die köstlichen Kabinettstücke unseres Viktor Laverrenz. Sie haben längst unser Herz zu finden gewusst, diese wahrheitsechten Schilderungen des Marinelebens. Gibt es doch ihrer nicht allzu viele, die sich an Stimmungsgehalt mit ihnen messen können, die so von frischem Humor durchsonnt sind, die in seligen Friedenszeiten entstanden, auch heute noch, und heute erst recht, ihre aufheiternde Wirkung ausüben. Deshalb rechnen wir auf den Dank unserer Leser und Leserinnen, wenn wir den „Lustigen Fahrten“ von Viktor Laverrenz, die es in einem halben Jahr auf 25 000 Auslage brachten, jetzt diesen neuen Band „Marinesekt“ folgen lassen.
Der Verlag.
Marinesekt.
Motto: Der Wein erfreut des
Menschen Herz.
Gleim, Trinklied.
Im Hafen von Sidney lag damals der deutsche Kreuzer „Friederike“ vor Anker, an einer Boje vertaut, welche ungefähr 500 Meter vom Lande entfernt war, denn Sidney hat einen schönen, großen Hafen, der den deutschen Seeleuten schon deshalb sympathisch ist, weil er eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Kieler hat; an Räumlichkeit ist er demselben freilich bedeutend überlegen.
Die „Friederike“ ist einer von jenen Auslandskreuzern, welche einen eigenen Typ in der Schiffbaukunst repräsentieren; sie ist als Schonerbark getakelt, das heißt, sie hat drei Masten, von denen nur der Fockmast mit Raaen versehen ist, und jenen weißen Tropenanstrich, der einem Schiff sozusagen ein festliches Aussehen verleiht. Wie elegant wölben sich trotz aller Rücksicht auf Tüchtigkeit im modernen Feuergefecht, ihre Linien, und wie sauber hebt sich der rote Strich der Wasserlinie von dem weißen Schiffskörper ab, die feine Zeichnung verratend, welche der schlanke Bau des Kreuzers aufweist.
Es war ein schöner, sonniger Nachmittag, als ein großer englischer Panzer in den Hafen von Sidney einlief, eines jener Hochseepanzerschiffe, welche die Engländer in aller Welt zum Besuche ihrer Kolonien umherschicken. Der Name des englischen Fahrzeugs war natürlich „Triumph“. Natürlich ist nämlich bei den Engländern das sehr stark ausgeprägte Selbstbewusstsein, das man Arroganz zu nennen versucht sein würde, wenn man sich nicht als deutscher Schriftsteller der Vermeidung von Fremdwörtern befleißigen müsste. Schiffsnamen wie „Triumph“, „Fürchtenichts“ (Dreadnought), „Sieg“, „Der Unbesiegbare“, „Der Unbezwingbare“, „Der Donnerer“, „Der Zerstörer“ sind bei ihnen gang und gäbe.
Der „Triumph“ war den Mannschaften der „Friederike“ wohlbekannt, denn man hatte sich schon öfter in den ostasiatischen und australischen Gewässern getroffen und begrüßte sich nun durch ein dreimaliges Hurra, welches von den in die Wanten geenterten Mannschaften ausgebracht wurde, sowie durch das Spielen der beiderseitigen Nationalhymnen. Die Engländer bliesen „Heil dir im Siegerkranz“, und die Deutschen antworteten sofort mit „God save the Queen“ oder, wie es jetzt längst heißt, „the King“.
So war zunächst den freundschaftlichen Gefühlen beiderseits Luft gemacht, und man wartete nun, bis der „Triumph“ zu Anker gegangen, um den weiteren Anforderungen der internationalen Etikette zwischen den beiden Marinen gerecht zu werden.
Gegen 2 Uhr hatte der Panzer festgemacht, und Korvettenkapitän von Sparwitz, der Kommandant der „Friederike“, beeilte sich, den englischen Kollegen in Sidney zu bewillkommnen. Er beorderte dazu den äußerst patenten, für solche Zwecke wie geschaffenen, hochfeinen Leutnant zur See Lackner, der in der Gig des Kapitäns einen Besuch an Bord des „Triumph“ machen und den Kommandanten des Panzers namens seines Kapitäns begrüßen sollte.
Das war ein Auftrag für Lackner! Seit einer halben Stunde hatte er sich in seiner Kabine eingeschlossen und bearbeitete mit Hilfe des für diese Zwecke sorgfältig dressierten Burschen seinen Körper, um sein Äußeres Ich in einer der deutschen Marine würdigen Weise in Stand zu setzen. Er war sich der politischen Wichtigkeit seiner internationalen Mission völlig bewusst und felsenfest überzeugt, dass die Augen des gesamten Deutschen Reiches augenblicklich an seinen Lippen hingen, um zu beobachten, ob er der fremden, aber befreundeten Nation gegenüber die Kaiserlich deutsche Flotte und somit sein ganzes Vaterland würdig vertrete. Er fühlte ordentlich, wie Se. Majestät der Kaiser sein Auge prüfend auf ihn richte, und es kam ihm vor, als hörte er den obersten Kriegsherrn sagen: „Lackner, ich bin fest davon überzeugt, Sie werden Mir und Meiner Marine Ehre machen.“
Ja, er wollte es! Und darum musste in erster Linie mit einer Sorgfalt Toilette gemacht werden, welche die denkbar höchsten Anforderungen in jeder Beziehung befriedigte. Leutnant Lackner wusch sich zunächst — man verzeihe mir diese intimen Details — von oben bis unten.
Es folgte nun die Auftakelung des Offiziers, indem zunächst die Leinwand gesetzt wurde. Ein ganz neues Paradehemd wurde herbeigefiert und aufgeheißt.
Dann kam die neueste Garnitur Hosen mit gestickten, noch nicht gebrauchten Hosenträgern, und nun ging es an die nachdrückliche Bearbeitung des Kopfes. Nachdem die Zähne mit Kalodont einer gehörigen Reinigung unterzogen, wurden sie zunächst mit Odol, dann mit klarem Wasser nachgespült. Windich, der Bursche, hatte alle Hände voll zu tun, die erforderlichen Utensilien zuzureichen, sowie die gebrauchten Töpfe, Bürsten, Kruken, Tuben, Büchsen, Flaschen, Pinsel, Gläser usw. abzunehmen und wegzustellen.
Nussextrakt (von Schwarzlose) diente dazu, dem durch das Seewasser etwas ausgesogenen Schnurrbart eine wohltuende dunkelbraune Farbe zu geben; darauf kam die Brennschere an die Reihe, welche den Barthaaren jenen feinen Schwung verlieh, der am deutschen Offizier so sehr imponiert, sodann wurde die Schnurrbartbinde über das ganze Haargebäude gelegt. Es war dies eins der schwierigsten Toilettenkunststücke, welche Lackner auszuführen hatte, und fünfmal musste er die sauber gearbeitete Gazebinde neu legen, ehe jedes Haar darunter auch wirklich den gewünschten Sitz hatte.
Nachdem der Schnurrbart so weit gediehen war, kam das Kopfhaar an die Reihe, welches zunächst mit Eau de Quinine eingesalbt und dann sorgfältig abgetrocknet wurde. Der Scheitel, der genau von der ideal halbierten Stirn nach der hinteren Naht des Rockkragens ging, wurde mit Creme festgelegt, das Haar nach beiden Seiten, vertikal zum Scheitel, weggekämmt, gebürstet und über den Ohren zu kühnen Leesegeln gewölbt.
Der Leutnant ging nun an das Einlegen der weißen Wäsche, welche ebenfalls tadellos und unglaublich steif gestärkt war. Der Wäschevorrat Lackners war so groß, dass er gar nicht in der freilich etwas beschränkten Kabine hätte untergebracht werden können, und der „feine Anton“ hatte deshalb den Zahlmeister gebeten, ihm einen Teil seiner Garderoben- und Wäschestücke aufzubewahren.
Nun folgten Rock, Säbel, Schärpe und Dreimaster, dann konnte die Schnurrbartbinde abgenommen und als letzte Krönung ein Paar weiße Handschuhe, von denen Leutnant Lackner heute zur Feier des Tages das letzte Dutzend angebrochen hatte, aufgestreift werden.
Als sich der Offizier im Spiegel, besah — Windich musste einen zweiten Spiegel im Rücken des Beschauers halten, damit er auch die Achterseite einer Kontrolle unterziehen konnte —, überzeugte sich Lackner, dass der selige Adonis von den ollen Jriechen ein wahrer Waisenknabe gegen ihn gewesen sein müsse. Nun konnte der Leutnant getrost an Deck gehen und die Gig besteigen; die für das Boot kommandierten Matrosen, welche am Fallreep des Vorgesetzten harrten, waren schon ganz dösig geworden von der langen Warterei.
Das Bild, welches Leutnant Lackner nun aber auch dem Hafen von Sidney bot, war ein großartiges. Die Lackstiefel stritten sich mit den Hosen um die Schneidigkeit des Sitzes, und der Rock warf nicht eine einzige Falte mit Ausnahme an der Innenseite der Ärmel, wo sich an jeder Seite die drei vorschriftsmäßig gestatteten Falten bildeten. Die neuen Handschuhe saßen tadellos, und der Paradesäbel, den der Leutnant gelegentlich eines Kommandos an Bord der Kaiserlichen Jacht „Hohenzollern“ erhalten hatte, strahlte in seinem vollen Glanze.
In wenigen Minuten war die Gig längseit des Panzers, und die Eleganz, mit der Lackner sich erhob und die Fallreepstreppe erklomm, suchte auf der ganzen Welt, soweit sie von Kriegsschiffen aller Nationen befahren wurde, ihresgleichen. Er betrat mit seinen feinen deutschen Lackstiefeln, die aber leider aus französischem Chevreaux gearbeitet waren, das Deck des englischen Schiffes — jeder Zoll ein Kavalier, jeder Schritt Eleganz, jede Bewegung Schick.
Kapitän Macintyre, der Kommandant des „Triumph“, ein alter Seebär, wie man sie in der englischen Marine so häufig findet, war ein jovialer Herr, eine sogenannte gemütliche Haut, die nicht viele Faxen machte und immer gleich auf den Kern der Sache einging. Feine Phrasen zu gebrauchen, war nicht seine Art, und auch hinsichtlich seines Anzuges war er das absolute Gegenteil des wie aus dem Ei gepellten deutschen Leutnants.
Dieser hatte ihm mit seinem elegantesten Honneur, die Rechte mit dem neuen Handschuh am Dreimaster und den Säbel in der Linken, die Meldung gemacht, dass S. M. S. „Friederike“ seit soundsolange im Hafen von Sidney liege, soundsoviel Besatzung habe, von da und daher gekommen sei und dann und dann dort und dorthin zu gehen gedenke, und dass der Kommandant des deutschen Kreuzers Korvettenkapitän von Sparwitz sei.
Macintyre freute sich sehr über den Bericht, namentlich über die Nennung des Korvettenkapitäns von Sparwitz, den er in seiner kordialen Weise als „dear friend“ und „old boy“ bezeichnete. Er forderte den Leutnant auf, seinen lieben Kriegskameraden zu grüßen und ihm zu melden, dass er den Gegenbesuch an Bord des deutschen Schiffes persönlich machen werde, um dem alten Jungen die Hand zu drücken. Auf die übliche Frage des Leutnants Lackner, ob man mit irgendetwas, Proviant, Kohlen, Wasser oder dergleichen gefällig sein könne, erwiderte der Engländer, wie das ebenso üblich war und nicht anders erwartet wurde, dass er mit allem versehen, und so konnte der deutsche Offizier sich empfehlen, nachdem der Seebär ihm noch kordial die Vorderflosse geschüttelt.
Lackner begab sich an Bord der „Friederike“ zurück und erstattete seinem Kommandanten Bericht über den Erfolg seiner Sendung.
Sparwitz war sehr angenehm davon berührt, in Kapitän Macintyre einen alten Bekannten wiedergefunden zu haben, denn draußen. in der Welt freut man sich über jedes Gesicht, das man schon einmal gesehen hat, noch dazu in Australien, welches beinahe zu unsern Antipoden gehört. Er beeilte sich daher, für den angekündigten Besuch des englischen Kameraden eine kleine Vorbereitung zu treffen, denn er wollte das wiedersehen durch eine größere Feierlichkeit weihen, und zwar durch das Spendieren — einer Flasche Sekt.
Sparwitz war nämlich trotz aller seiner sonstigen menschlichen und nautischen guten Eigenschaften ein Mann, den man, wenn er ein gewöhnlicher Mensch gewesen wäre, mit dem Namen „oller Knickstiebel“ belegt haben würde. Er war von einer geradezu ungeheuerlichen Sparsamkeit, und wenn er sich heute dazu entschloss, eine Pulle Sekt zu schmeißen, so war dies schon ein Zeichen, dass ihm die Freundschaft des Mr. Macintyre ganz besonders ans Herz gewachsen war.
Kapitän von Sparwitz ging sofort ans Werk, um den würdigen Willkommentrunk höchst persönlich vorzubereiten. Er rief sich zunächst seinen Steward Döse, einen alten Matrosen, der früher bei ihm Bursche gewesen und den er sich als Steward hatte kommandieren lassen, da er aus Sparsamkeitsrücksichten sich keinen Zivilsteward hielt, und stieg mit diesem eigenbeinig in die unter seiner Kajüte belegene Weinlast, um die Vorräte zu mustern.
„O weh!“ Sie waren fürchterlich zusammengeschmolzen und befanden sich in einem sehr traurigen Zustande. Da die Reise der „Friederike“ auf zwei Jahre projektiert war, so hatte sich Herr von Sparwitz mit 24 Flaschen Sekt vorgesehen, indem er rechnete, dass er durchschnittlich jeden Monat eine gebrauchen wurde. Aber das Leben auf dem Achterdeck ist teuer, und man hat als Kommandant eines deutschen Kriegsschiffes allerlei repräsentative Rücksichten zu nehmen.
So war es gekommen, dass der sparsame Kapitän viel mehr gebraucht hatte als monatlich eine Flasche, und der Sektvorrat beschränkte sich lediglich auf zwei Flaschen.
Es half alles nichts, der Kapitän musste schon einmal in den sauren Apfel beißen und eine davon opfern.
Es war die vorletzte. Von Sparwitz betrachtete sie etwas wehmütig; er nahm sie höchst persönlich in die Hand, da er sie Döse, der etwas ungeschickt war, nicht anvertrauen mochte. Mit großer Vorsicht trug er sie nach oben in seine Kajüte, wo er sie mitten auf den länglich runden Mahagonitisch setzte und sie wie einen Augapfel hütete.
Aber es ist warm in Sidney, und der Wein liegt, wenn man kein Eis hat, in der Weinlast ziemlich mollig. Champagner jedoch muss kühl serviert werden, und es handelte sich daher um die große Frage: „Wie verschafft man sich auf die billigste Weise eine kalte Flasche?“ An Land schicken, um Eis zu holen, das war viel zu kostspielig; man denke, Eis in Sidney, das kostet ja mehr als der Sekt selber. Doch halt, der Oberstabsarzt. hat ja eine Eiskiste, deren Inhalt allerdings für Kranke bestimmt war. Aber wenn der Kapitän den Oberstabsarzt „bat“, dann musste dieser schon etwas herausrücken.
Gedacht, getan. Döse wurde hingeschickt, kam aber bald mit dem Bescheid zurück, dass seit lange alles Eis, welches vorhanden gewesen, geschmolzen sei. Nun war guter Rat teuer. Sparwitz sann und sann. Er betrachtete alles der Länge und Breite nach, ob es sich zum Kühlen eignete. Nichts wollte sich finden.
Halt, eine Idee! Wozu lag man aus dem Wasser? Das Wasser ist, so viel wusste er noch aus der Physikstunde, ein schlechter Wärmeleiter, das heißt, es hält sich lange kühl, und so wäre es das einfachste, die Flasche ins Wasser zu hängen.
Bon! Döse muss ein Schymannsgarn besorgen, und als sich der Steward entfernt hat, steckt der Herr Kommandant höchstselbst die Flasche an und lässt sie durch das Bullauge an der Backbordseite ins Wasser. Dann nimmt er sich etwas zu lesen vor und wartet die Zeit ab, bis Kapitän Macintyre an Bord kommt.
Ha! Das Garn bewegt sich! Dort müssen sich unberufene Hände zu schaffen machen. Wild springt er auf nach dem Fenster und schaut hinab; aber friedlich hängt das Tau ins Wasser, und nur sanft spielen die leise plätschernden Wellen mit der Champagnerflasche. Noch zweimal springt der Korvettenkapitän misstrauisch auf, aber zweimal überzeugt er sich, dass sein Verdacht grundlos war, und beruhigt ergibt er sich der Lektüre.
Inzwischen hat der Obermatrose Zinkweiß, der „Oberponze“ der Außenbordsreiniger, der sich auf Deck in seinem Takelpäckchen umhertreibt, erfahren, dass gegen Abend der Besuch des englischen Kapitäns zu erwarten sei, und es fällt ihm daher schwer auf die Seele, dass er heut Morgen einen großen braunen Fleck, der gerade auf dem roten Strich der Wasserlinie saß und über sowohl wie unter dieselbe hinausragte, zwar bemerkt, aber nicht beseitigt habe.
Er weiß, wie kritisch das Auge fremder Offiziere auf so einem Schiff ruht, und wie peinlich die eigenen Vorgesetzten darauf achten, dass alles auf das sauberste in Ordnung sei. Er beschließt daher, sich lieber der Mühe zu unterziehen, den Fleck wegzubringen, ehe er sich der Möglichkeit aussetzt, ein paar Strafwachen oder gar Bordarrest dafür aufgehalst zu bekommen. Wohl oder übel steigt er in seinen Scheuerprahm, der ebenso dreckig und fettig aussieht wie er selbst, und fiert denselben an Backbord nach hinten; Es achtet weiter keiner auf ihn als sein guter Freund Upzieher, der augenblicklich als Signalgast auf der Kommandobrücke steht. Es ist ja zwar nichts Unrechtes oder Verbotenes, was Zinkweiß tut, aber es braucht gerade auch keiner zu sehen, dass er jetzt, am späten Nachmittag, noch einmal anfängt, Außenbord zu reinigen.
Doch was ist das? Da hängt ein Schymannsgarn hernieder, denkt Friedrich August Gottlieb Zinkweiß, und fasst mit seinen schmierigen Händen vorsichtig nach dem Ende. Instinktiv vermeidet er jedes Geräusch und jede hastige Bewegung, denn er nimmt an, der Steward hat das Garn ausgehängt.
Siehe da! Eine Flasche Champagner! Das ist ein Gut, welches ihm der olle Meergott Ägir selbst in die Hand spielt, und mit seligen Gefühlen betrachtet er die willkommene Beute. Sein Gewissen regt sich nicht; denn dem Steward etwas wegzunehmen, das ist eine gute Tat, von der jeder echte Matrose hofft, dass sie ihm einst in der Seligkeit hoch angerechnet werde.