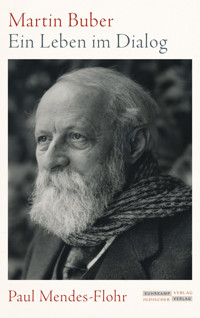
30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jüdischer Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine der prägenden Gestalten der deutsch-jüdischen Geschichte war Martin Buber, der Philosoph und politische Verfechter des Dialogs, der Verständigung, des Gesprächs von Ich und Du, wie sein Hauptwerk heißt. 1878 in Wien geboren, in Lemberg aufgewachsen, sammelte Buber früh Zeugnisse des chassidischen Lebens. 1902 war er einer der Mitbegründer des Jüdischen Verlags und der Monatszeitschrift Der Jude. Seine religionsphilosophischen Beiträge haben weit in die Wissenschaft und Literatur hineingewirkt. 1938 übersiedelte Martin Buber nach Jerusalem und lehrte an der Hebräischen Universität. Er setzte sich für die Verständigung zwischen Juden und Arabern in Israel ein und suchte nach 1945, gegen viele Widerstände, das Gespräch mit den Deutschen. Der christlich-jüdische Dialog verdankt ihm die wesentlichen Impulse.
Martin Buber starb 1965 in Jerusalem. Sein Werk wirkt bis heute im Dialog von Religionen und Kulturen, Nationen und Individuen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Martin Buber als Student in Wien
Titel
Paul Mendes-Flohr
Martin Buber Ein Leben im Dialog
Aus dem Englischen von Eva-Maria Thimme
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel Martin Buber. A Life of Faith and Dissent bei Yale University Press, New Haven and London.
eBook Jüdischer Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2022.
© Jüdischer Verlag GmbH, Berlin, 2022Copyright © 2019 by Paul Mendes-Flohr
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg
Umschlagfoto: Martin Buber (1958). Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Martin Buber Literary Estate
eISBN 978-3-633-77056-4
www.suhrkamp.de
Widmung
Für Rita, unsere Kinder und Enkelkinder – und für meine Studenten, einst und jetzt
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Einleitung
1. Eine mutterlose Kindheit
2. Herold einer jüdischen Renaissance
3. Ausfahrt aufs offene Meer
4. Der Journalist wird Autor
5. Prag: Mystische Frömmigkeit – und weit mehr
6. Erbe von Landauers Vermächtnis
7. Ein ehrfürchtiger
Apikores
: Freundschaft mit Rosenzweig
8. Die tragische Gnade des gelebten Alltags
9. Professor und politischer Aktivist
10. Trotz allem
11. Nicht dazugehören
Danksagung
Anmerkungen
Einleitung
1 Eine mutterlose Kindheit
2 Herold einer jüdischen Renaissance
3 Ausfahrt aufs offene Meer
4 Der Journalist wird Autor
5 Prag: Mystische Frömmigkeit – und weit mehr
6 Erbe von Landauers Vermächtnis
7 Ein ehrfürchtiger
Apikores
: Freundschaft mit Rosenzweig
8 Die tragische Gnade des gelebten Alltags
9 Professor und politischer Aktivist
10 Trotz allem
11 Nicht dazugehören
Bibliographie
Archive
Editionen der Werke Martin Bubers
Gesamtausgaben
Einzelausgaben
Briefausgaben
Monographien, Memoiren, Berichte, Artikel
Personenregister
Abbildungsnachweis
Informationen zum Buch
Einleitung
»Ich bin leider ein komplizierter und schwieriger Gegenstand«
Martin Buber
»Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Denkvorgang gibt, der ohne persönliche Erfahrung möglich ist. Alles Denken ist Nachdenken, der Sache nachdenken.«1 Dies bemerkte Hannah Arendt im Hinblick auf ihren persönlichen intellektuellen Werdegang.
Erfahrung und Denken in eine unmittelbare Wechselbeziehung zu setzen ist allerdings ein riskantes Unterfangen – Erfahrungen sind vielschichtig und nicht selten widersprüchlich, manche, die ihre Prägung auf das menschliche Denken hinterlassen haben könnten, sind »nicht wirklich bekannt« oder »gern vergessen worden«.2 Die Biographen müssen daher entscheiden, welche Erfahrungen für die intellektuelle und persönliche Entwicklung prägend waren, dabei die gebotene Vorsicht auch bei der Lektüre schriftlicher Zeugnisse – insbesondere der Hauptperson – walten lassen. Ein Text kann einen »stillschweigenden Autor« haben, der nicht mit dem tatsächlichen Verfasser identisch ist; auch kann die Art und Weise, wie ein Text geschrieben und aufgenommen wurde, das Bild eines Autors entwerfen, das von seiner oder ihrer »wahren«, umfassenden Persönlichkeit abweicht oder diese nur teilweise erfasst. Überdies kann es vorkommen, dass, wie Saul Bellow angesichts sämtlicher in ein Werk eingegangenen Überarbeitungen und stilistischer Korrekturen kurz und bündig feststellte, der Autor oder die Autorin in den Texten häufig ganz anders erscheint als im »wirklichen Leben«.3
Mit all diesen Herausforderungen sieht sich jeder Biograph Bubers unweigerlich konfrontiert. Schreiben fiel ihm nicht leicht; so gestand er einmal einem ungeduldigen Herausgeber einer Sammlung seiner auf Englisch publizierten Essays: »Ich möchte, dass Sie ein für alle Mal begreifen, dass ich kein Literat bin. Schreiben ist nicht mein Beruf, sondern meine Pflicht – eine fürchterlich schwere dazu. Wenn ich schreibe, dann unter schrecklichem Druck.«4 Meist schrieb er zahlreiche Entwürfe und revidierte ständig seine Schriften von einer Edition zur nächsten, wobei er ganze Passagen strich und andere umschrieb. Nicht immer wies Buber den Leser späterer Ausgaben auf seine Überarbeitungen hin – seinem Biographen können sie als Hinweise auf mögliche biographische Veränderungen und intellektuelle Korrekturen dienen.
In ihrer Sylvia Plath gewidmeten Monographie bemerkte Janet Malcolm, dass der Biograph naturgemäß von einer »epistemologischen Unsicherheit« verfolgt wird und, so möchte ich ergänzen, verfolgt werden sollte.5 Die Geschichte, die ein Biograph erzählt, kann naturgemäß nur interpretativ sein. Beim Zusammenstellen von Fakten und deren Bewertung hinsichtlich ihrer biographischen Bedeutung wählt der Biograph häufig jene aus, die das von ihm entworfene Narrativ bestätigen, um zusammenhängend zu erzählen.
Mir war daran gelegen, Anhaltspunkte und Stichworte von Buber selbst aufzugreifen. Die von mir erzählte Geschichte seines Lebens und Denkens fußt vor allem auf den Mitteilungen in seiner Korrespondenz – das Martin Buber Archiv in der Nationalbibliothek Israel bewahrt über fünfzigtausend Briefe, die zwischen Buber und Hunderten von Korrespondenten gewechselt wurden – sowie auf beiläufigen autobiographischen Anmerkungen, die sich da und dort in seinen Schriften finden. Häufig reagierte er auf bestimmte Ereignisse und Erfahrungen mit Gedichten, von denen bislang nur wenige veröffentlicht wurden.6 Gegen Ende seines Lebens schrieb er einen knappen Essay aus »autobiographischen Fragmenten«, in dem er eingangs bemerkte: »Es geht hier nicht darum, von meinem persönlichen Leben zu erzählen, sondern einzig darum, von etlichen, in meiner Rückschau auftauchenden Momenten Bericht zu erstatten, die auf Art und Richtung meines Denkens bestimmenden Einfluss ausgeübt haben.«7
Sollte man je seine Biographie verfassen, müsste sie sich, so betonte Buber nachdrücklich, auf sein Denken konzentrieren und dabei jene konstitutiven Elemente in Betracht ziehen: »Meine Philosophie … Ich habe keine Lehre. Ich zeige nur etwas. Ich zeige die Wirklichkeit. Ich zeige etwas an der Wirklichkeit, was nicht oder zu wenig gesehen worden ist. Ich nehme ihn, der mir zuhört, an der Hand und führe ihn zum Fenster. Ich stoße das Fenster auf und zeige hinaus, ich öffne das Fenster und zeige auf das, was draußen ist.«8
Dementsprechend nahm sich Buber vor jedweder Biographie in Acht, die die psychologischen Quellen seiner Ideen und Schriften zu sondieren unternahm, um damit diese – und zugleich ihn, den Autor – auf eine subjektive, idiosynkratische und folglich spekulative Deutung zu reduzieren. In einem Antwortbrief an einen amerikanischen Doktoranden, der an einer vergleichenden psychologischen Biographie von Buber und Kierkegaard arbeitete, erwiderte er:
Ich habe keinerlei Neigung, mich mit meiner Person als »Gegenstand« zu befassen, und ich fühle mich auch keineswegs dazu verpflichtet. Es interessiert mich nicht, ob die Welt an meiner Person interessiert ist. Ich möchte die Welt beeinflussen, aber ich möchte nicht, dass sie sich von »Mir« beeinflusst fühlt. Ich habe, wenn ich das so sagen darf, den Auftrag, den Menschen Wirklichkeiten zu zeigen, und ich suche das so getreu wie möglich zu tun. Darüber nachzudenken, warum ich beauftragt bin oder warum ich im Lauf meines Lebens zu zeigen fähiger geworden bin, was ich zu zeigen habe, hat für mich nicht nur keinen Reiz, sondern auch keinen Sinn. Es gibt Menschen, die den Wunsch haben, sich der Welt zu erklären; Kierkegaard hatte ihn; ich nicht – ich möchte mich nicht einmal mir selber erklären.9
Zu dieser Thematik waren Bubers Ansichten widersprüchlich. Um zu verstehen, weshalb er die Befolgung der traditionellen jüdischen Lebensweise ablehnte, »hätte ich […]mit einer Innengeschichte meiner Jugend antworten müssen, und etlichen Fragmenten aus deren Außengeschichte obendrein«, schrieb er einmal an Franz Rosenzweig.10 Gleichwohl würde, so betonte er stets, seine persönliche Auseinandersetzung mit dem traditionellen Judentum, in dem er aufgewachsen war, in der seiner jüdischen Altersgenossen ihren Widerhall finden, zumal, wenn diese ebenfalls aus Osteuropa stammten. Daher sollten so manche seiner Erfahrungen und Einstellungen nicht als Überempfindlichkeit oder individuelle Eigenart, sondern als durchaus repräsentativ für seine Zeitgenossen beurteilt werden, die dasselbe durchgemacht hatten – Äußerungen der persönlich erlebten komplizierten Problematik, wie man sich als jemand, der beim Übergang der Judenheit in die moderne Welt geboren wurde, weiter als Jude zu identifizieren vermöchte.
In diesem Sinne deckt sich meine Darstellung von Bubers Lebensgeschichte mit Edward Saids Vorstellung von Identität als »dem animierenden Prinzip der Biographie«. Dem Biographen geht es darum, ein Leben auf eine Art und Weise zu verstehen, »die das Wesen einer Identität nicht bloß mit sich selbst, sondern in Übereinstimmung mit der Geschichte eines Zeitraums, in dem sie bestand und aufblühte«, untermauert, bestärkt und erhellt.11
Zur Charakterisierung der Identität und der Probleme, die Buber zeit seines Lebens beschäftigten und den Verlauf seines intellektuellen Werdegangs bestimmten, habe ich mich an die von Arthur A. Cohen getroffene Unterscheidung zwischen dem »natürlichen und dem übernatürlichen Juden« gehalten.12 Der »übernatürliche Jude« ist der ewigen religiösen Berufung des jüdischen Volkes gemäß der von Gott offenbarten Torah sowie der rabbinischen Tradition verpflichtet; der »natürliche Jude« dagegen ist den Unwägbarkeiten von Geschichte und sozialen Gegebenheiten ausgesetzt. In der traditionellen jüdischen Gemeinschaft waren die tagtäglichen Anliegen des natürlichen Juden der übernatürlichen Bestimmung Israels untergeordnet. Doch mit der Emanzipation, der Öffnung der Ghetto-Tore und dem Zugang zu neuen sozialen und wirtschaftlichen Möglichkeiten erwarb der natürliche Jude eine Vorrangstellung – und der damit einhergehende Kampf gegen den Antisemitismus sowie für die vollständige politische Gleichberechtigung führten nicht selten dazu, dass der übernatürliche Jude in den Hintergrund trat.
Im Lauf seines Lebens, auch im Zuge der Entwicklung seiner Philosophie war und blieb es Bubers dominierendes Anliegen, den natürlichen und den übernatürlichen Juden wieder miteinander zu vereinen. Immer aufmerksam gegenüber dem jüdischen Ringen um politische und soziale Anerkennung, bestand er darauf, dass die politischen Aktivitäten des natürlichen Juden, wie sie insbesondere im Zionismus ihren Ausdruck fanden, von den ethischen und spirituellen Grundprinzipien des übernatürlichen Juden geleitet werden sollten. Diese Grundsätze entwickelte er unter der Rubrik Biblischer – oder auch Hebräischer – Humanismus weiter, wobei er ihr Verhältnis in einem dialektischen Ausgleich zwischen dem Besonderen und dem Universellen veranschaulichte.
Die fraglose Treue eines Juden zu seinem Volk musste, so Buber, keinesfalls seine kosmopolitischen und transnationalen Überzeugungen untergraben – und umgekehrt. In seinem Essay »Der Chassidismus und der abendländische Mensch« ging er ausführlich auf seine Überzeugung ein: »Es ist mir mehrfach nahegelegt worden, diese Lehre von ihrer, wie man gern sagt, ›konfessionellen Beschränktheit‹ zu befreien und als eine ungebundene Menschheitslehre zu verkündigen. Das Einschlagen eines solchen ›allgemeinen‹ Wegs wäre für mich die pure Willkür gewesen. Um das Vernommene in die Welt zu sprechen, bin ich nicht gehalten, auf die Straße zu treten, ich darf in der Tür meines angestammten Hauses stehen bleiben; auch das hier gesprochene Wort geht nicht verloren«.13
Die anspruchsvolle Aufgabe, partikulare und universelle Verpflichtung auszurichten und auszugleichen, kennzeichnete die Bahn von Bubers intellektueller Biographie. Unablässig modifizierte er sie, um zugleich jedwede ideologisch sanktionierte Positionierung zu vermeiden. Eben dies beeindruckte Hannah Arendt als eine seltene Tugend; anlässlich ihres Besuchs bei dem hochbetagten Buber zeigte sie sich tief beeindruckt von dessen Offenheit gegenüber unterschiedlichen Anschauungen: »… [Buber hat] eine wirkliche Neugier und Lernfähigkeit für die Welt, … und er ist mit seinen beinahe 80 Jahren lebendiger und empfänglicher als alle diese dogmatischen Rechthaber und Besserwisser. Er hat eine gewisse Souveränität, die mir gefällt.«14 Und Buber selbst bemerkte einmal: »Altsein ist ein herrliches Ding, wenn man nicht verlernt hat, was anfangen heißt …«15
Bubers Auffassung nach war es die Musik Johann Sebastian Bachs, die ihn gegenüber allzu simplen, vereinfachenden Ansichten gefeit sein ließ. Als 22-jähriger Student der Universität Leipzig besuchte er häufig Aufführungen Bachscher Kantaten in der berühmten Thomaskirche, zu welchen Konzerten er später einmal bemerkte: »… ich würde vergeblich zu sagen unternehmen, ja ich kann es nicht einmal mir selbst klarmachen, auf welche Weise Bach mein Leben beeinflusst hat; offenbar wurde der Grundton meines Lebens irgendwie modifiziert und erst von da aus auch der Gedanke.«16 Beim Hören der polyphonen, kontrapunktischen Musik Bachs »[wuchs] langsam, zaghaft, beharrlich […] die Einsicht in die Wirklichkeit menschlichen Daseins und in die spröde Möglichkeit, ihr gerecht zu werden. Bach half mir«.17 Sein Erlebnis der Bachschen Musik warf ein neues Licht auf das von ihm später als jugendliche Heldenverehrung bezeichnete Schwärmen für Ferdinand Lassalle, dessen Reden und Schriften ihn begeisterten: »Ich bewunderte an ihm die geistige Leidenschaft und die Bereitschaft, wie in dem öffentlichen so im persönlichen Leben die Existenz einzusetzen. Was an seiner Natur offenkundig problematisch war, fiel unter den Tisch; es ging mich eben nicht an.«18
In diesem autobiographischen Bekenntnis vernehme ich eine Warnung vor einer weihevollen oder seichten Darstellung von Bubers Leben und Denken seinerseits. Auch Buber hatte, wie wir alle, seine Schwächen. Von den in früher Kindheit zugefügten Traumata gezeichnet, konnte er narzisstisch und egozentrisch sein, was ihm häufig den Vorwurf einbrachte, dass sein Verhalten kaum mit seinen eigenen Grundsätzen übereinstimmte. So manche Anekdote kursierte im Jischuv, der jüdischen Gemeinschaft im britischen Mandatsgebiet Palästina, später im Staat Israel, über Bubers Unvermögen, wahrhaft dialogfähig, zu einer »Ich-und-Du«-Beziehung bereite Persönlichkeit zu sein. Anekdoten sind naturgemäß zweifelhaft – bekanntlich sagt »Peters Meinung über Paul mehr über Peter aus als über Paul«.19 Wie dem auch sei – Buber war eindeutig kein vollkommener Mensch, wohl aber vollkommen menschlich.
Buber war eine umstrittene Persönlichkeit. Er provozierte leidenschaftliche, häufig kontroverse Stellungnahmen zu seiner Person und seiner Philosophie. Gershom Schocken, der ehemalige Herausgeber der israelischen Tageszeitung Ha-Arets, erinnerte sich an einen Spaziergang mit dem hebräischen Romancier und lebenslangen Freund Bubers, Shmuel Yosef Agnon, bei dem sie die gerade in Israel ausgetragenen Kontroversen über Buber erörterten. »Unvermittelt blieb Agnon stehen, sah mich an und sagte: ›Ich will dir mal was sagen. Es gibt Leute, bei denen du dich irgendwann entscheiden musst, ob du sie liebst oder hasst. Ich entschied mich, Buber zu lieben‹.«20
1
Eine mutterlose Kindheit
Wenn Martin Buber – wie eine ihrer Quelle nach unklare und vielleicht nicht ganz glaubwürdige Anekdote will – durch die Straßen Jerusalems flanierte, seien ihm die Kinder mit dem Ruf nachgerannt: »Elohim, Elohim«! (Gott, Gott). Worauf er sich bedächtig umgewandt, über seinen seidig weißen Bart gestrichen und freundlich geantwortet habe: »Ja!«
Natürlich war Buber kein Gott, und ungeachtet seiner biblischen Züge hielt er sich auch nicht für einen Propheten. Tatsächlich hatte er sich seinen berühmten Bart zunächst wachsen lassen, um eine deformierte Unterlippe zu kaschieren, die Verletzung war durch die unsachgemäße Anwendung einer Geburtszange bei der Entbindung verursacht worden. Fotografien aus seinen frühen Zwanzigern zeigen ihn mit einem über die versehrte Lippe hängenden Schnäuzer, ein üppiger Vollbart sollte bald folgen, der, wie er meinte, eine gute Tarnung bot.1
Die entstellte Lippe war nicht die einzige Narbe, die ihm aus der Kindheit blieb. Als er drei Jahre alt war, trennten sich seine Eltern, dabei ging seine Mutter fort, ohne sich von ihm zu verabschieden. Er erinnerte sich, wie er zu einem Fenster im zweiten Stock der elterlichen Wohnung am Wiener Franz-Josefs-Kai am Ufer der Donau rannte. Von einem schmalen Balkon vor den imposanten Verandatüren aus mühte er sich verzweifelt, die Aufmerksamkeit seiner Mutter auf sich zu lenken, doch sie entschwand, ohne sich noch einmal umzusehen. Das traumatisierte Kind wurde kurz darauf zu seinen Großeltern väterlicherseits nach Lemberg – dem heutigen ukrainischen Lwiw – geschickt, damals die Bezirkshauptstadt der österreichisch-ungarischen Provinz Galizien, eine überwiegend polnische Region, die 1772 von der Habsburger Monarchie annektiert worden war. Adele und Salomon Buber, bei denen ihr Enkel bis zu seinem vierzehnten Lebensjahr aufwuchs, vermieden es im Allgemeinen, intime persönliche Beziehungen zu erörtern. Keiner der beiden verlor dem Kind gegenüber je ein Wort über die Trennung der Eltern oder über das Schicksal seiner Mutter, die mit einem russischen Offizier durchgebrannt war – später sollte die Eheschließung der Eltern von einem rabbinischen Gericht annulliert werden –, oder ob er seine Mutter einmal wiedersehen würde. Acht Jahrzehnte später schrieb er im Rückblick: »Das Kind selber erwartete, seine Mutter bald wiederzusehen; aber es brachte keine Frage über die Lippen.« Als der Vierjährige sich unvermittelt bei der um mehrere Jahre älteren Tochter eines Nachbarn nach dem erkundigte, was seine Großeltern zu fragen er sich scheute, erklärte ihm das ältere Mädchen klipp und klar, dass eine Versöhnung ausgeschlossen sei. »Ich höre noch, wie das große Mädchen zu mir sagt: ›Nein, sie kommt nie wieder zurück‹. Ich weiß, dass ich stumm blieb, aber auch, dass ich an der Wahrheit des gesprochenen Wortes keinen Zweifel hegte.« Von der groben Offenheit dieser Entgegnung wie betäubt, blieb ihm nichts anderes übrig, als zur Kenntnis zu nehmen, dass seine Mutter ihn im Stich gelassen hatte. »Ich wollte meine Mutter sehen. Und die Tatsache, dass dies nicht möglich war, hinterließ in mir ein maßloses Gefühl von Entbehrung und Verlust.«2
Gegen Ende seines Lebens gedachte Buber dieses schmerzvollen Gesprächs mit der Nachbarstochter und bemerkte nachdenklich: »Ich vermute, dass alles, was ich im Lauf meines Lebens von der echten Begegnung erfuhr, in jener Stunde auf dem Altan seinen ersten Ursprung hat.«3 Die Begebenheit klingt in Worten nach, die er kurz nach Hitlers Machtergreifung an die deutschen Juden richtete: »Kinder erleben, was geschieht, und schweigen, aber nachts stöhnen sie aus dem Traum, erwachen, starren ins Dunkel; die Welt ist unzuverlässig geworden … Es liegt an uns, den Kindern die Welt wieder zuverlässig zu machen. An uns, ob wir ihnen, uns zusprechen dürfen: Getrost, die Mutter ist da.«4 Dass es sich hier um eine unmittelbar aus dem persönlichen Leben gewonnene Einsicht handelt, wird noch einmal in einem Brief an Franz Rosenzweig aus dem Jahr 1922 betont, in dem es heißt: »Für mich haben die Psalmen immer die leibliche Zugehörigkeit bewahrt, die sie für meine Kindheit hatten (eine mutterlose Kindheit), aber eine von der – lebenden, nur unzugänglich fernen – Mutter träumende: ›Hast du von mir entfernt/Liebenden und Genossen …‹ [Psalm 88,19].«5
Die Sehnsucht, mit der »unzugänglich fernen Mutter« einst wieder vereint zu werden, sollte ihn für immer prägen, und in einem frühen Liebesbrief an seine zukünftige Frau Paula brachte er sie zum Ausdruck: »… Deine Briefe [sind] das Einzige, das mir Kraft gibt … Deine Briefe sind das Allereinzigste. Außer ihnen vielleicht noch der Gedanke, daß eine Mutter in Dir ist, der Glaube daran. Jetzt weiß ich es: ich habe immer und immer meine Mutter gesucht …«6 Knapp zwanzig Jahre später verglich er auf der Bar-Mizwa-Feier des Sohns einer befreundeten Familie den willentlichen Glaubensakt, sich ganz und gar Gott zu ergeben, mit dem Band zwischen dem Kind und seiner Mutter – »man mag es wünschen oder nicht«.7
Im Verlangen nach der mütterlichen Umarmung, zu der es nie kommen sollte, fiel dem Dreizehnjährigen ein ganz eigener Begriff ein – Vergegnung – »womit etwa das Verfehlen einer wirklichen Begegnung zwischen Menschen bezeichnet war«.8 Im weiteren Verlauf seines Lebens wurde er gewahr, dies »als etwas zu spüren, was nicht bloß mich, sondern den Menschen anging«.9 Mehr als dreißig Jahre später, mit der Veröffentlichung seines Werks Ich und Du im Jahr 1923, in dem er seine Philosophie der Zwiesprache vorstellte, sollte er dem existentiellen und religiösen Sinn von Begegnung auf den Grund gehen – dem zwischenmenschlichen Zusammenkommen von Menschen in einer Atmosphäre gegenseitigen Vertrauens: »Alles wirkliche Leben ist Begegnung.«10 Bubers Appell an die Welt – und an uns alle, die wir mit anderen zusammenleben –, in den Dialog zu treten, ging auch auf die bittere Wahrheit ein, wie mühsam dies zu erreichen sei, wie oft es im Lauf des Lebens zu fehlgeschlagenen Begegnungen komme und Ich-Du-Beziehungen scheiterten. Wachsam-sensibel hinsichtlich der Brüchigkeit menschlicher Verbindungen, sprach Buber vom ideologischen und psychologischen »Panzer«, den wir Menschen unweigerlich anlegen, wenn es gilt, uns vor derlei unseligen Begegnungen zu schützen.
Aufgrund seiner eigenen Erfahrungen reagierte Buber feinfühlig auf die Verletzlichkeit anderer sowie den Schmerz, den wir, nach einem Wort des französischen Romanciers des 19. Jahrhunderts, Jules-Amédée Barbey d'Aurevilly, vermittels »kultivierter Vergehen« so häufig einander zufügen – zwischenmenschliche »Untaten, welche die Gesellschaft tagtäglich begeht, insgeheim und ungestraft, geradezu faszinierend häufig und leichtfertig«, handelt es sich bei ihnen scheinbar doch um »geringfügige Verbrechen, da kein Blut vergossen wird und das Gemetzel sich innerhalb der Grenzen von Anstand und Sitte abspielt«. Diese »kultivierten Vergehen« sind oft ebenso schmerzhaft wie jene, die in der Gesellschaft als Verstöße gegen das Zivil- und Strafrecht gelten.11 Das Unvermögen, sich wahrhaft, ehrlich zu begegnen, was das Bedürfnis einer – und wenn nur indirekten – Antwort seitens einer leibhaftigen Gegenwart (also einer Ich-Du-Begegnung) signalisiert, hielt Buber für ein kultiviertes Vergehen. »Die menschliche Person fühlt sich zugleich als Mensch ausgesetzt in der Natur, wie man ein verleugnetes Kind aussetzt, und als Person isoliert mitten in der tosenden Menschenwelt.«12
Die Großeltern, die sich des emotionalen Bruchs bewusst waren, den ihr dreijähriger Enkel infolge des jähen Fortgangs seiner Mutter erlitten hatte, verwöhnten ihn und setzten alles daran, ihn vor jedwedem Unheil zu bewahren. So kam es, dass er selten mit anderen Kindern spielte. Mit ironischer Sympathie erläuterte Bubers Sohn Rafael später das gänzliche Unverständnis seines Vaters seinen eigenen Kindern gegenüber: »Mein Vater hatte keine ›normale‹ Kindheit, er spielte nie Völkerball auf der Straße oder zerschmiss das Fenster eines Nachbarn.«13 Bis zum Alter von zehn Jahren, als er in ein polnisches Gymnasium eintrat, besuchte er gar keine Schule, sondern wurde zu Hause unterrichtet. Dabei standen Sprachen und Literatur im Vordergrund; er erhielt Privatstunden in Englisch, Französisch und Deutsch sowie in den traditionellen jüdischen Fächern. Sein Großvater Salomon Buber, ebenso orthodox wie gebildet, lehrte ihn Hebräisch und führte ihn in die Grundlagen des klassischen Judentums ein. Allerdings war sein wichtigster Lehrer der rabbinischen Literatur der jüngere Bruder seines Großvaters, Rabbi Ze'ev Wolf (Wilhelm) Buber, ein Talmudgelehrter, der für seine innovative Auslegung des rabbinischen Rechts berühmt war.14
Im Sommer verbrachte Martin häufig eine Woche mit seinem Großonkel in Delatyn, einem idyllischen, am Ufer des Pruth gelegenen Marktflecken unterhalb der Karpaten, der sich als Sommerfrische bei den ostgalizischen Juden, zumal bei vielen führenden chassidischen Rebben, großer Beliebtheit erfreute. Da Ze'ev Buber lediglich ein bescheidenes Zimmer am Rande des nahe gelegenen Waldes mietete, wurde der Junge bei diesem oder jenem Freund seines Onkels untergebracht. Im Sommer 1899 teilte er ein Zimmer mit dem drei Jahre jüngeren Mosche Chaim Efraim Bloch. Dieser, der bereits an einer Jeschiva studierte, unternahm mit Martin weite Wanderungen durch den Wald, auf denen er dessen Naturverbundenheit bemerkte – wie auch eine rätselhafte Traurigkeit, die ihn dann und wann verstummen ließ und ihre Gespräche unterbrach.15
Da Bloch die deutsche Sprache noch nicht beherrschte, unterhielten sich die beiden wahrscheinlich auf Jiddisch, eine der Sprachen, die Martin seit früher Jugend geläufig war. So führte er als junger Erwachsener die Korrespondenz mit seinem Großvater auf Jiddisch.16 Seine Großmutter schrieb ihm gewöhnlich auf Deutsch, meistens allerdings in hebräischer Schrift. Als Tochter streng orthodoxer Eltern hatte Adele (Udel) Weiser heimlich Deutsch gelernt und damit gegen das traditionelle jüdische Gebot verstoßen, das die Lektüre »fremden Schrifttums« untersagte. Doch nachdem sie im Alter von siebzehn Jahren den zwanzigjährigen Salomon Buber geheiratet hatte, konnte sie offen ihrer Vorliebe für deutsche Literatur frönen.
Seiner Großmutter schrieb Martin seine Lust am Lesen zu. Sie war es, die ihn zuerst mit der gesprochenen deutschen Sprache vertraut gemacht hatte, wobei ihr Deutsch, das sie sich weitgehend durch Lektüre angeeignet hatte, so manche Nuance und Impulsivität der Umgangssprache vermissen ließ.17 Erstmals zu Beginn seines Studiums in Wien sah sich Martin mit der deutschen Sprache konfrontiert, wie sie von den Einheimischen gesprochen wurde. In seiner Geburtsstadt zog es ihn in das berühmte Burgtheater, das er »oft, zuweilen Tag um Tag« besuchte. Dort wurde, wie er sich erinnerte, »die deutsche Sprache gesprochen. Das war eine große Belehrung. Aber es war auch eine holde Verführung dabei: Hier erst wurde recht eigentlich das Urgold der Sprache dem unbemühten Erben in den Schoß geschüttet«.18
Der Achtzehnjährige nahm sich vor, alles nur Erdenkliche zu unternehmen, um sich mit dem Deutschen so vertraut zu machen, wie es von Muttersprachlern gesprochen wurde. »Zwei Jahrzehnte vergingen, bis ich mich … . zum strengen Dienst am Wort durchgerungen hatte und das Erbe so hart erwarb, wie wenn ich es nie zu besitzen gemeint hätte.«19 Der Umstand, dass es just die im Theater gesprochene deutsche Sprache war, die ihn inspirierte, könnte auf eine unbewusste Beziehung zu seiner Mutter, einer Schauspielerin, zurückzuführen sein. Sowohl seine Freunde als auch seine Kritiker merkten an, dass seiner Diktion etwas Theatralisches eigentümlich war – er formulierte langsam und mit genauer, geradezu dramatischer Aussprache. Diese emphatische Redeweise könnte möglicherweise auf einen leichten Sprachfehler infolge der versehrten Lippe zurückzuführen sein.20 Paula Winkler, Bubers spätere Ehefrau, sollte ihm im Bemühen, fehlerfrei Deutsch zu sprechen, immer behilflich sein und die literarische Arbeit ihres Mannes tatkräftig fördern. Sie entstammte einer frommen katholischen Familie aus München und hatte sich schon in jungen Jahren einen Namen als Schriftstellerin gemacht. Ihre Romane veröffentlichte sie unter dem Pseudonym Georg Munk.21 Bis zu ihrem Tod im Jahr 1958 sollte Buber sie regelmäßig um Rat bei grammatikalischen oder stilistischen Fragen bitten.22
Die beiden begegneten sich zum ersten Mal im Wintersemester 1899 an der Universität Zürich. Lebhaft, intellektuell engagiert und unabhängig, fiel Paula Winkler nicht nur als eine der wenigen Studentinnen, sondern auch, oder vielmehr besonders durch den exotischen Flair einer Bohemienne auf.
Paula Winkler war Mitglied einer Esoteriker-Kolonie in Südtirol gewesen, die von Omar al-Raschid Bey geleitet wurde – einem ehrwürdigen älteren Herrn mit grauem Bart in Beduinenkluft, der von seinen Anhängern als charismatisch-transzendentaler Weiser verehrt wurde.23 Jüdischer Herkunft, war al-Raschid Bey zum Islam konvertiert und betörte fortan seine Jünger – darunter aufstrebende Dichter und Philosophen – mit der »Weisheit des Orients«, einer höchst synkretistischen Mixtur aus islamischen, indisch-buddhistischen und anderen mystizistischen Lehren.24
In seinen Memoiren berichtete der Philosoph Theodor Lessing, auch er ein Gefolgsmann al-Raschid Beys, dass so manche von dessen Anhängern in Paula verliebt waren, »das einzige hübsche Mädel … in der kleinen Kolonie«.25 Sie war zunächst mit al-Raschid Bey nach Zürich gekommen, um auf sein Geheiß hin Sanskrit und indische Religionsgeschichte zu studieren – während seine fassungslose Ehefrau Helene in München zurückgelassen wurde.26 Bald, nachdem sie mit al-Raschid Bey Schluss gemacht hatte, lernte Paula in einem Seminar zur deutschen Literatur Martin Buber kennen, und ihre Romanze begann auf einem Ball in den Alpen, der sich bis in die frühen Morgenstunden hinzog. Einige Augenzeugen konnten es kaum fassen, dass sie sich zu dem unscheinbaren, schmächtigen Buber hingezogen fühlte – er maß kaum 160 cm und war außerdem sieben Monate jünger als sie.27
Aus ihrer Beziehung ging ein Kind hervor, Rafael, der am 9. Juli 1900 geboren wurde. Obwohl Buber im ersten Augenblick über Paulas Schwangerschaft ziemlich die Fassung verlor, wurde ihr zweites Kind, die Tochter Eva, kaum ein Jahr später, am 3. Juli 1901, geboren. Aus Angst, dass seine Großeltern das außereheliche Verhältnis mit einer nicht-jüdischen Frau, aus dem auch noch Kinder hervorgegangen waren, als doppelte Sünde ansehen würden, verschwieg ihnen Buber die Beziehung sowie die Geburt der Kinder. Erst im Januar 1907, nachdem sein Großvater am 28. Dezember 1906 verstorben war, trat Paula zum Judentum über. Im April desselben Jahres heirateten beide auf dem Standesamt in Friedenau, damals einem Vorort von Berlin.28 Kurz darauf berichtete Buber seiner Großmutter von seiner Verbindung mit Paula und ihren beiden Kindern.
In seinen Erinnerungen gedachte der 87-jährige Buber seiner Großmutter mit herzlichen Worten, während er den Großvater nur en passant erwähnte. Vierzig Jahre zuvor hatte er sich ausführlicher über ihn geäußert, und zwar im Zusammenhang seiner Schilderung, wie er sich in seiner Jugend vom Judentum abgewandt hatte, obwohl er doch im Haus dieses berühmten, ganz seiner Arbeit ergebenen Gelehrten der rabbinischen Literatur und streng gesetzestreuen Juden aufgewachsen war. Solange Buber bei seinen Großeltern lebte, war er zumindest nach eigener Aussage äußerlich fest in der jüdischen Tradition verankert, aber selbst damals »gingen mir manche Fragen und Zweifel durch den Kopf«.29 Dieses schwärende Unbehagen an der religiös gebotenen Lebensweise trat deutlich zu Tage, als er vierzehnjährig von den Großeltern fortzog, um fortan bei seinem Vater zu leben, der sich unlängst wieder verheiratet hatte. Im Haus seines Vaters legte er nicht mehr Tefillin und befolgte die von der Halacha gebotenen Rituale und Bräuche nicht weiter.30 Er ging zur Synagoge der liberalen Gemeinde, der sein Vater angehörte. Erst dann sah er sich, wie er später berichtete, liberalen Einflüssen in seiner religiösen Erziehung ausgesetzt.31
Es hat ganz den Anschein, als habe zwischen dem jungen Buber und dem Großvater nie ein so enges Verhältnis bestanden wie zu Großmutter Adele. Die Wärme und Bewunderung, mit der er sie in seinen Erinnerungen schildert, spiegelt sich auch in beider Korrespondenz wider. Die Briefe, die er von seinem Großvater empfing, waren dagegen stets knapp und nicht selten in kritischem Ton gehalten. In einem auf Jiddisch geschriebenen Brief vom 18. Juni 1906 fragte Salomon seinen Enkel, wieso er denn nicht auf seine Briefe antworte: »Selbst in Frankfurt oder Berlin kann man doch wohl zehn Minuten finden, um einen Brief zu schreiben.«32
Ungeachtet seiner offenkundigen Distanz zum Großvater, teilte Buber zahlreiche Eigentümlichkeiten mit ihm.33 Salomon Buber war, was man heute einen workaholic nennt, und das sollte auch auf seinen Enkel zutreffen.34 Salomon Buber war nicht nur ein ungeheuer produktiver Gelehrter, zudem außerordentlich wohlhabend, sondern auch ein überaus großzügiger Förderer anderer Gelehrter, denen es weit weniger gut ging als ihm. Seine singuläre Position innerhalb der europäischen Judenheit als Gelehrter und Philanthrop – der sowohl jüdische wie nicht-jüdische Vorhaben unterstützte – wurde in einem Nachruf im Londoner Jewish Chronicle vom 4. Januar 1907 überschwänglich gepriesen. Darin wurden sowohl der weite Umfang seiner finanziellen Geschäfte als auch das breite Engagement in Angelegenheiten von Gemeinde und Kommune, nicht zuletzt der Wohltätigkeit geschildert und abschließend festgestellt: »Es dürfte manche verblüffen zu erfahren, dass [Salomon] Buber zweifellos der produktivste Autor auf dem Gebiet der jüdischen Gelehrsamkeit seiner Zeit gewesen ist. Die von ihm verfassten Werke bilden für sich schon eine ganze Bibliothek, die unveröffentlichten Arbeiten füllen viele Regale. Buber saß, wie es im Talmud [BT Zera′im, Berakhot 8b] so treffend heißt, an zwei Tischen – an dem des Wohlstands und dem der Weisheit.«35 Die Familie Buber führte ihre Herkunft auf Meir ben Isaak Katzenellenbogen (1482-1565), den Oberrabbiner von Padua, zurück, zu dessen Nachfahren unter anderen Karl Marx und Abraham Joshua Heschel zählten. Unmittelbar verwandt war die Familie indes mit Rabbi Benjamin Aharon ben Abraham Slonik, Verfasser von Mas′at Binjamin, einem der für deutsche wie polnische Juden gleichermaßen maßgeblichsten und zugleich populärsten Werke rabbinischer Responsa zur Halacha, das erstmals 1633 in Krakau erschien und unzählige Nachdrucke erfuhr.36 Rabbi Sloniks Urenkel, der Vater von Salomon Buber, Rabbi Isaiah Abraham Buber, war ein berühmter Talmudist, dessen geschäftliche Erfolge ihm gestatteten, großzügig diverse Einrichtungen für Bedürftige zu unterstützen sowie ein Krankenhaus in Lemberg zu gründen. Trotz heftiger Aprilschauer nahmen Tausende an seinem Begräbnis teil, auf dem die führenden Rabbiner der Stadt sein Leben und Werk würdigten. Seine Söhne, allen voran Salomon, versprachen zum Gedächtnis an den Verstorbenen eine bedeutende Summe für den Bau eines neuen Krankenhauses, ferner weitere Mittel zum Unterhalt des alten, von ihrem Vater gegründeten Hospitals.37
Kurzum – die Familie Buber gehörte zur intellektuellen und finanziellen Elite Galiziens.38 So war es nicht weiter verwunderlich, dass Martin in jüdischen Kreisen als der Enkel Salomon Bubers bekannt und willkommen war. In einem Brief an seine Großmutter schrieb er mit spürbarem Unwillen: »Ich werde hier, sooft ich mit Zionisten zusammenkomme, nach Großpapa, seinem Befinden, seinen Arbeiten u. dgl. gefragt; ich bin noch keinem vorgestellt worden, der mich nicht nach meinem Verwandtschaftsverhältnis zu Salomon Buber gefragt hätte …«39 Es lag ihm daran, selbst seine eigene Identität zu formen, wenn auch mit Rückbezug auf seinen Großvater. Seinen Brief an die Großeltern anlässlich des 73. Geburtstags von Salomon Buber begann er in einem ungewöhnlich herzlichen Ton und voller Bewunderung für seinen Großvater: »Selten kann ich mich der Tränen erwehren – Tränen innigster Verehrung – wenn ich an sein liebes Gesicht denke«, um zugleich der Hoffnung Ausdruck zu verleihen, dass »Deine lebendige Güte, lieber Großvater, die mir so oft Trost und Freude und Festigkeit verliehen hat, lange lange erhalten bleibe«. Im Folgenden ersuchte er den Großvater, den von ihm, Martin, eingeschlagenen Weg gutzuheißen. Auch wenn zionistische Aktivitäten nicht eben das gewesen sein mochten, was sein Großvater für seinen Enkel im Sinn gehabt hatte, würde doch diese Tätigkeit, so versicherte er, ebenfalls dem Ziel dienen, die Zukunft des jüdischen Volks zu gewährleisten.
Die indirekte Bitte um Versöhnung mit dem Großvater ging möglicherweise auf die Hoffnung zurück, die ahnungsvollen Zweifel der Großeltern hinsichtlich seiner akademischen Laufbahn zu entkräften, die kein bestimmtes Berufsziel im Auge hatte – jedenfalls gibt es Hinweise dieser Art in ihrem Briefwechsel. Ein Nachruf auf seinen Vater Carl, der in einer polnisch-jüdischen Zeitung in Lemberg erschien, erwähnte, dass Adele Buber ihrem Sohn strikt untersagte, nach der höheren Schule weitere Studien aufzunehmen. »Sie befürchtete, dass Karol [Carl] seligen Andenkens seine Studien an säkularen Institutionen fortsetzen und so in die Sphäre der weltlichen Wissenschaften und Gepflogenheiten gelangen wollte, die so grundverschieden von der jüdischen Tradition waren.« Carl gab seinen Traum auf, Medizin zu studieren, beugte sich »dem Wunsch seiner Eltern« und reiste durch Europa, um sich mit der Seidenindustrie vertraut zu machen«. Nachdem er sich in diesem Gewerbe kundig gemacht hatte, weitete er seine geschäftlichen Interessen auf die Montanindustrie – Phosphat- und Mineralöl-Abbau – aus, um schließlich »einer der führenden Experten auf dem Gebiet der Agrarwirtschaft zu werden«.40 Vor dem Hintergrund dieser Geschichte könnte Carl Buber sehr wohl die Entscheidung seines Sohns unterstützt haben, akademischen Studien nachzugehen, damit diesem das gelänge, was ihm selbst versagt geblieben war.
Hätten die Großeltern gewusst, dass Martin zwei uneheliche Kinder von einer nicht-jüdischen Frau hatte, wären ihre Befürchtungen ohne Zweifel bestätigt worden, dass sein Studium weltlicher Fächer ihn unweigerlich vom rechten Weg abbringen musste. Wie aus dem Geburtstagsbrief an seinen Großvater hervorgeht, hoffte Martin, dass seine Verbindung mit dem Zionismus, die er im Wintersemester 1897/1898 an der Universität Leipzig aufgenommen hatte, seine Großeltern beruhigen würde. Es ging ja nicht nur um ihre Zustimmung, sondern auch um ihre finanzielle Unterstützung, die er dringend benötigte. Als er den Geburtstagsbrief an seinen Großvater schrieb, erwartete Paula schon ihr erstes Kind.
Erst als Martin sich dem Studium des Chassidismus zu widmen begann, sah es ganz so aus, als habe er des Großvaters Anerkennung gefunden, der ihm im Weiteren Ausgaben chassidischer Werke zukommen ließ, die in Deutschland nicht erhältlich waren. Wenige Wochen vor seinem Tod 1906 erhielt Salomon Buber ein Exemplar der ersten, von seinem Enkel besorgten Anthologie chassidischer Lehren, Die Geschichten des Rabbi Nachman, deren Widmung ihre Aussöhnung dokumentiert: »Meinem Großvater Salomon Buber, dem letzten Meister der alten Haskala, bringe ich in Treuen dieses Werk der Chassidut dar.«41 Dabei bezieht sich die Formulierung »alte Haskala« auf die osteuropäischen Anhänger der jüdischen Aufklärung, die, weitgehend Autodidakten, mehr oder weniger an der religiösen Tradition und Lebensweise festhielten, um zugleich die intellektuellen und kulturellen Normen des gebildeten Europa anzunehmen.
Dagegen hielt der Vater, der in bewusster Distanz zu seinen Eltern die deutschsprachige liberale Synagoge in Lemberg besuchte und überdies versucht hatte, seinen Sohn davon abzuhalten, gemeinsam mit dem Großvater zur chassidischen Klaus zu gehen, Martins Interesse am Chassidismus für sinn- und witzlos. In einem Brief zu Martins dreißigsten Geburtstag mahnte Carl Buber seinen Sohn eindringlich, sich wichtigeren und nützlicheren Problemen zuzuwenden: »Glücklich wäre ich, wenn Du Dich von den Chassidischen und Sohar-Sachen lossagen würdest, da selbe nur geistesverwüstend und unheilvoll einwirken und es ist schade, Deine Fähigkeiten auf so ein fruchtloses Thema zu verwenden und so viel Arbeit und Zeit, sich und der Welt nutzlos, zu verbrauchen …«.42
Martin blieb von der Missbilligung seines Vaters unbeeindruckt, sein Interesse am Chassidismus steigerte sich sogar noch, nicht zuletzt dank Paulas enthusiastischem Engagement. Tatsächlich war sie es, die Studentin der indischen Religionen, die ihn erstmals auf die Mystik aufmerksam gemacht hatte. Bevor sie sich kennenlernten, hatte der Schwerpunkt seiner intellektuellen Tätigkeit auf Philosophie, Psychologie, Kunstgeschichte und Literatur gelegen. Auch unterstützte sie ihn in seinem Engagement für die Sache des Zionismus. Wenige Monate nach Geburt ihres zweiten Kindes schrieb sie an ihn: »Ich wachse an Deiner Sache heran, das musst Du, wirst Du finden. Sie wird die meine und die der Kinder soll sie werden.«43 Tags zuvor hatte sie erklärt: »Ich habe einen neuen Willen, das muß ich Dir sagen, denn früher hatte ich ihn nicht: Ich möchte mit Dir für den Zionismus tätig sein, nein, ich werde es. Ich habe das Gefühl, ich kann, ich muß etwas tun dafür.«44 In einem langen, zwei Jahre zuvor geschriebenen Brief berichtete sie Martin Buber von einem hitzigen Wortwechsel, den sie mit einer jüdischen Gegnerin des Zionismus geführt hatte. In Erwiderung auf deren Charakterisierung des Zionismus als »einer nationalen Sache«, die »rückwärts führt«, habe sie vorgebracht, dass Liebe zur Menschheit und Streben nach ferneren Horizonten nicht zu verwechseln sei mit »Gleichmachung, Nivellierung, Verwischung, Aufhebung« von kulturellen Traditionen, die leicht Resultat eines dogmatisch verstandenen Kosmopolitismus sein könnten: »Mensch zu Mensch sollten wir vor allem zu einander stehn, oh ja – nicht ›Franzose zu Deutschem‹, nicht ›Jude zu Christ‹, vielleicht auch weniger ›Mann zu Weib‹.«
Paulas leidenschaftliches Engagement zugunsten des Zionismus und ihre Liebe zum jüdischen Volk kamen Martins Ausformung oder zumindest Bestätigung seiner ganz eigenen Grundsätze zugute, sie bestätigten ihn auch darin, jenen Weg über den – wie er es nannte –, »schmalen Grat zu gehen« zwischen Verbundenheit mit dem jüdischen Volk und unverbrüchlicher Solidarität mit allen Mitmenschen.
In Paula fand Martin nicht allein die mütterliche Person, nach der er sich gesehnt hatte, sondern eine verwandte Seele; sie waren sich sowohl in ihrer romantischen Liebe als auch in ihrer lebenslangen intellektuellen und spirituellen Übereinstimmung verbunden. Sie wussten um dieses Band und nannten sich daher liebevoll gegenseitig »Mogli« nach dem Kind in Rudyard Kiplings Dschungelbuch. Mogli, der in einem Wolfsrudel aufgewachsen war, verkörperte beispielhaft die Einheit von Geist und Natur. Aus Anlass seines fünfzigsten Geburtstags schrieb Buber das Gedicht »Am Tag der Rückschau«, das er »P. B.« widmete; in ihm rief er sich sein bisheriges Leben in Erinnerung an der Seite der Frau, die ihn die Einheit von Geist und Natur sehen gelehrt hatte.
Da ward so Geist wie Welt mir aufgetan,
Die Lüge barst, und was war, war genug.
Du wirktest, daß ich schaue, –
Wirktest? Du lebtest nur,
Du Element und Fraue,
Seele und Natur!45
Die Integration von Seele und Natur, des Transzendenten und des Alltäglichen, sollte zum allgegenwärtigen Leitmotiv in Bubers Lebenswerk werden.
2
Herold einer jüdischen Renaissance
Carl Buber heiratete nach der vom Rabbinat geschiedenen Ehe neu. Der vierzehnjährige Martin zog bei seinen Großeltern aus, um fortan bei Vater und Stiefmutter in einem vornehmen, zentral gelegenen Stadthaus in Lemberg zu leben. Wie der Vater vermutlich schon befürchtet hatte, tat sich sein Sohn schwer, die »Ersatzmutter« zu akzeptieren, und hielt sich so viel wie möglich bei seinen Großeltern auf. Kurz bevor Martin im Herbst 1896 Lemberg verließ, um sein Studium in Wien aufzunehmen, beobachtete er vom Balkon des väterlichen Hauses eine antisemitische Demonstration, die ihn auf die raue politische Realität verwies, der er nach seiner Übersiedlung aus einer Provinzstadt am Rande der k. u. k. Monarchie in die Habsburger Metropole begegnen würde.
An der Wiener Universität belegte Buber Seminare in Philosophie, Psychologie, Literatur und Kunstgeschichte – tatsächlich aber war es das vibrierende kulturelle Leben der Stadt, insbesondere die Theater- und Literaturszene, wofür sich der Studienanfänger begeisterte und intellektuell interessierte. Innerhalb weniger Monate nach der Ankunft in seiner Geburtsstadt veröffentlichte er eine Folge von vier auf Polnisch verfassten Essays in einer Warschauer Literaturzeitschrift über die Dichter und Schriftsteller der Wiener Avantgarde.
Die vierteilige Reihe »Zur Wiener Literatur« war Bubers literarisches Debüt. Bereits an diesen Essays zeigten sich sowohl Bubers ungewöhnliche Bildung als auch die kulturelle Vielseitigkeit, die für die nächsten siebzig Jahre seine Schriften charakterisieren sollten.1 Zwar immer noch ein Teenager, konnte er schon auf seine breite Kenntnis deutscher, polnischer, französischer und italienischer Werke zurückgreifen, um »die herausragenden Gestalten der Gruppe junger Schriftsteller, die gemeinhin als ›Jung Wien‹ bezeichnet wird«, vorzustellen und zu vergleichen: Hermann Bahr, Hugo von Hofmannsthal, Peter Altenberg und Arthur Schnitzler: »Bei ihnen allen«, bemerkte er mit der Sicherheit des reifen Gelehrten, »findet man die herrliche, rein Wienerische Synthese aus Leichtigkeit, Melancholie und Träumerei, die man in den Walzern von Strauß, den Gemälden von Makart, den Komödien von Raimund und den Skulpturen von Tilgner wiederfindet. Bei ihnen allen begegnet man diesem typisch Wienerischen Fehlen des heroischen revolutionären Elements. Sie sprechen davon, in ihrer Arbeit eine ›individuelle, unverwechselbare Wiener Kultur‹ erschaffen zu wollen, aber in Wirklichkeit machen sie lediglich die bestehende Kultur auf sich selbst aufmerksam und verleihen ihr auf diese Weise eine sinnvollere Intensität.«2
Wie von diesen Dichtern vertreten, läuft die Wiener Moderne letztlich auf nicht mehr als einen oberflächlichen, ja dekadenten Individualismus hinaus, dem jedweder wahrhaft heroische, revolutionäre Ausdruck seiner selbst abging, urteilte Buber, welches Diktum verdeutlicht, wie starken Einfluss Nietzsche damals auf ihn ausübte. Ahron Eliasberg gegenüber, einem angeheirateten Cousin, den er im Wintersemester 1897-98 an der Universität Leipzig kennenlernte und mit dem er sich anfreundete, bemerkte Buber, dass er noch zwei, drei Jahre zuvor ein »glühender Nietzscheaner gewesen« [sei], »doch jetzt sehe ich ihn nur noch als ein …«3
Was Buber mit diesem »nur noch« meinte, hatte er einige Monate zuvor in einem unveröffentlichten Aufsatz mit dem ironisch-pointierten Titel »Zarathustra« dargelegt. Dort erinnerte er sich, wie er im Alter von sechzehn Jahren auf Nietzsches Geburt der Tragödie stieß. »Dieses Buch machte mich zum Anhänger Nietzsches, zum kranken Anhänger« – »krank«, weil er Nietzsches Botschaft unkritisch übernahm.4 Von daher ist der Aufsatz »die Krankheitsgeschichte mit all ihrer Genesung und Erlösung [von ihr]«.5 Nietzsches Einstellung entsprach ganz dem vom jungen Buber empfundenen Missfallen an der Welt, in der er lebte: er verspürte »einen wütigen Hass gegen die ganze ekelgeschwängerte Luft, in der ich lebte; eine grimmige Abneigung gegen die officielle Moral, die officielle Bildung, das conventionelle Lächeln, Weineln und Wörteln«.6
Und Nietzsches Glorifizierung Wagners in der Geburt der Tragödie hatte zur Folge, dass Buber im Komponisten die »Apotheose« des neuen, des anti-bürgerlichen Menschen erblickte.7 In der von ihm selbst diagnostizierten Naivität wurde der jugendliche Buber folglich auch ein begeisterter Wagnerianer. Als er später Nietzsches Kritik an Wagner las, fühlte er sich im ersten Moment schmählich betrogen: es schien ihm, als untergrabe Nietzsche seine eigene Weltsicht. Doch als er im Folgenden Also sprach Zarathustra las, wurde ihm klar, dass Nietzsches Lehre nicht als Doktrin zu verstehen sei, sondern als poetischer Appell an einen radikalen Skeptizismus gegenüber jedweden Systemen und Theorien zu gelten habe – einschließlich seiner eigenen Ansichten. »Ein Hauptzweck Nietzsches ist … die Erweckung des großen Misstrauens … das Misstrauen gegen Alles und Jedes zu erwecken, gegen seine eigenen Worte, gegen sein eigenes Schweigen. … Nicht die Übermensch-Phantasie.«8
Mit einer rhetorischen Wendung sprach Buber unmittelbar Nietzsche an, der zu jener Zeit ja noch lebte, und bekannte: »Das war meine Krankheit: nicht glaubte ich an dich, ich glaubte dir« – will sagen, er war Nietzsches Lehre als einer Doktrin, nicht aber dem Denker selbst als persönlichem Beispiel für die nie nachlassende Suche nach intellektueller Integrität gefolgt.9
Der sechzehnjährige Buber war von seinem neuen Verständnis Nietzsches dermaßen eingenommen, dass er sich anschickte, Also sprach Zarathustra ins Polnische zu übertragen, allerdings musste er bald feststellen, dass ein polnischer Dichter bereits einen Übersetzervertrag abgeschlossen hatte, weshalb er sein Vorhaben aufgeben musste. Jahre später erinnerte sich ein ehemaliger Klassenkamerad vom polnischen Gymnasium in Lemberg, dass Buber Tag für Tag mit einem Exemplar von Nietzsches Zarathustra in der Hand zum Unterricht erschien.10 Obwohl er im Lauf der Zeit seine Ansicht über Nietzsche modifizierte, blieb Buber im Grunde doch immer ein Apostel von Zarathustra und dessen lebensbejahendem Aufbruch hin zu Selbstbeherrschung, zum Freisein von den Geboten willkürlicher Autorität. Dieser Impuls sollte letztendlich und entscheidend Bubers spezifischen, ganz eigentümlichen religiösen Anarchismus durchdringen, dessen Aussage im Wesentlichen darauf hinauslief, dass eine gelebte, in echtem Dialog geführte Begegnung mit Gott nicht von traditionell vorgeschriebenen religiösen Bräuchen und theologischen Doktrinen geregelt wird.
Man könnte gewiss Bubers Hinweis im Zarathustra-Essay auf seinen »wütigen Hass gegen die ganze ekelgeschwängerte Luft« während seiner Jugend als eine Übertreibung des frischgebackenen Nietzscheaners abtun, doch ist er gleichwohl Ausdruck einer tief empfundenen Abneigung gegenüber den von ihm als anmaßend, herrschsüchtig empfundenen Werten seiner Erziehung.11 Die Aversion gegenüber dem in seiner Jugend gültigen ethischen und pädagogischen Ethos mag zum Verständnis beitragen, warum er in den ersten Jahren seiner Studentenzeit bewusst ein nachdrückliches Desinteresse an religiösen Themen im Allgemeinen und jüdischen Angelegenheiten im Besonderen bekundete. In seinem Aufsatz über Jung Wien erwähnte er nicht einmal nebenbei, dass zwei der vier von ihm behandelten Autoren, nämlich Altenberg und Schnitzler, Juden waren, und ein dritter, Hugo von Hofmannsthal, jüdische Vorfahren hatte. Sein Cousin Ahron Eliasberg bemerkte, dass Buber tatsächlich den »typisch jüdischen Antisemitismus« zur Schau stellte, wobei er sich häufig über andere Juden als »typisch jüdisch« verächtlich äußerte. Was Wunder – die Kunde vom Zionismus war noch nicht zu ihm gedrungen. Eliasberg, der Die Welt, das Zentralorgan des zionistischen Weltverbands, abonniert hatte, bemühte sich vergebens, seinen Cousin für die neu gegründete Bewegung zu interessieren.12
Damals zog es Buber zum polnischen Nationalismus. Er nahm aktiv an einem geheimen Treffen polnischer, im Habsburger Reich lebender Studenten teil, vor denen er eine mit stürmischem Beifall bedachte Rede hielt.13 Tatsächlich hatte er sich bereits Jahre zuvor als Anhänger des liberalen polnischen Nationalismus zu erkennen gegeben, als er auf der Bar-Mizwa-Feier eines Freundes das Wort ergriff.14 Die Haftara, den Abschnitt aus den prophetischen Büchern, den Buber während des Gottesdienstes vortrug, enthielt auch einen Vers aus dem Buch Micha (5, 6): »Dann wird der Rest Jakobs inmitten der Völker wie Tau von dem Herrn sein, wie Regentropfen auf dem Gras …« Unter Verweis auf die »Ode an die Jugend«, ein Gedicht des romantischen polnischen Patrioten Adam Mickiewicz, interpretierte der vierzehnjährige Buber diesen Vers als ein Versprechen auf wahre »ewige Jugend« – nicht des Körpers, sondern des Geistes. In diesem Zusammenhang bemerkte der frühreife Buber, dass geistige Jugend letztlich auf Liebe gründet und zitierte – auf Französisch, versteht sich – Victor Hugo: »C'est Dieu qui met l'amour au bout de toute chose, l'amour en qui tout vit, l'amour en qui tout pose. L'amour, c'est la vie.« (Gott legt allem Liebe zugrunde, alles lebt von Liebe, alles beruht auf Liebe. Liebe ist Leben.) – will sagen: es geht um Liebe zur Menschheit insgesamt, auch zu seinen Feinden. Die Überlegungen des Vierzehnjährigen ließen schon das Credo erahnen, das der philosophischen und politischen Vision des reifen Alters zugrunde liegen sollte. Dieser humanistische Impuls trat bereits in der Ansprache anlässlich seiner eigenen Bar-Mizwa-Feier klar zu Tage, die – offensichtlich auf den dringenden Wunsch seines Vaters – in der liberalen Synagoge zu Lemberg, dem Deutsch-Israelitischen Bethaus, stattfand.15 Damals sann er über die Bedeutung der Haftara aus dem Buch Hosea (2, 1-22) nach, die er zunächst vorgetragen hatte. Indem er sich unmittelbar an seinen Vater und die Großeltern wandte, entwickelte er seine Überlegungen zum Ruf des Propheten zugunsten von tsedek, einem zentralen biblischen Begriff, den er im Unterschied zur vielfach üblichen Übersetzung »Gerechtigkeit« oder »Rechtschaffenheit« als »Tugend« verstand.
Während er sich in beiden Ansprachen ausgiebig auf traditionelle jüdische Quellen, insbesondere die hebräische Bibel und den Siddur, das Gebetbuch, berief, scheute er sich nicht, in der zweiten Rede einen Grundsatz aus dem Neuen Testament anzuführen. Auf Polnisch wandte er sich direkt an seinen Freund und führte die berühmte Passage 1 Korinther 13,13 an, um ihn zugleich inständig zu bitten: »Lass drei Worte dich auf diesen Pfad [der ewigen Jugend] führen, die Worte, die die polnische Nation führen: Hoffnung, Liebe und Glaube.«16
Die weitläufigen Kenntnisse sowie die scharfe Intelligenz des jungen Buber galten bald als legendär und sprachen sich, zumal in der Familie, rasch herum. Eben hier zirkulierte die Kunde von seinen schulischen Leistungen – etwa der Bericht von der Aufnahmeprüfung für das Gymnasium, als er im Fach Griechisch über einen Chor des Sophokles examiniert wurde und er den entsprechenden Gesang in Gänze auf Griechisch rezitieren konnte.17 Als Ahron Eliasberg zum ersten Mal Buber begegnete, war er schon darauf gefasst, ihn als angehendes Genie zu begrüßen – er sollte nicht enttäuscht werden. Bestürzt musste er allerdings feststellen, dass sein Cousin, der doch genau wie er in streng orthodoxer Tradition aufgewachsen war, über weit weniger jüdisches Wissen verfügte, als man vom Enkel Salomon Bubers erwarten durfte.18 Eliasberg führte die kümmerliche jüdische Bildung seines Cousins auf dessen bourgeoise Erziehung zurück, womit er offensichtlich die Vernachlässigung des talmudischen Lernens meinte. Zwar hatte Buber tatsächlich den Talmud mit seinem Großonkel studiert, das Erlernte anscheinend aber verdrängt.19 Gleichwohl hatte er solide Kenntnisse der hebräischen Sprache und des biblischen Schrifttums, der klassischen Kommentare und vermutlich auch der Midraschim sowie der Mischna erworben und bewahrt.20 Auch heißt es, dass er das traditionelle hebräische Gebetbuch auswendig kannte.21
Die deutsche und die polnische Kultur übten zweifellos die größte Anziehungskraft auf Buber aus. Kurz vor seiner Bar-Mizwa-Feier wurde er in das Franz-Josephs-Gymnasium zu Lemberg aufgenommen. Jahre später sollte er sich seiner Schule – die den Namen des habsburgischen Kaisers trug und in der auf Polnisch unterrichtet wurde – als eines Mikrokosmos der österreichisch-ungarischen Monarchie entsinnen, deren multinationales und kulturelles Gefüge sich aus widersprüchlichen Elementen zusammensetzte:
Die Schule hieß »Franz-Josephs-Gymnasium«. Man unterrichtete und unterhielt sich auf Polnisch, die Atmosphäre aber war jene uns heute fast ahistorisch anmutende, die zwischen den Völkerschaften der österreichisch-ungarischen Monarchie herrschte oder zu herrschen schien: gegenseitige Verträglichkeit ohne gegenseitiges Verständnis. Die Schüler waren zum weitaus größten Teil Polen, dazu kam eine kleine jüdische Minderheit (die Ruthenen hatten ihre eigenen Schulen); persönlich kam man gut miteinander aus, aber die beiden Gemeinschaften selbst wussten fast nichts voneinander.22
Jahre später sollte Buber sich zum Unterschied zwischen dem Leben im Nebeneinander und im Miteinander äußern – dem toleranten, aber ohne gegenseitiges Verständnis oder gar wahren Respekt geprägten Auskommen einerseits und dem gemeinsamen, mit- und beieinander geführten Dasein andererseits; eine Unterscheidung, die er gelegentlich und zumal in seinen Schriften zum zionistisch-palästinensischen Konflikt vornahm. Das Miteinander beschrieb er als eine Forderung – genau genommen als ein existentielles und religiöses Gebot, dem Anderen als einem »Du«, einem Mitmenschen im tiefsten und unwidersprüchlichsten Sinn zu begegnen.
Als Buber Lemberg verließ, um sein Studium in Wien aufzunehmen, war diese Ansicht, die im Lauf der Zeit zum Kennzeichen seiner Philosophie des Dialogs werden sollte, nicht mehr als eine verschwommene Eingebung. Er war nachgerade darauf versessen, das kosmopolitische Ethos sich anzueignen, das die kleinlich-provinziellen Grenzen zu überwinden versprach, die in Lemberg gezogen waren, und von daher distanzierte er sich von allem Jüdischen, von der traditionellen jüdischen Lebensweise. Doch im Lauf der sommerlichen Semesterferien 1898, die er auf dem Landsitz seines Vaters in Ostgalizien verbrachte, schickte er eine eilig hingeworfene Nachricht an Eliasberg, in der er pathetisch verkündete, er habe sich zum Kurswechsel entschlossen und werde fortan die Sache des Zionismus vertreten.23 Wie er dazu ausführte, war ihm unlängst die von einem gewissen Mathias Acher verfasste Broschüre in die Hände gefallen, unter welchem Pseudonym der Schriftsteller Nathan Birnbaum seine Schriften veröffentlichte: Die jüdische Moderne war ein 38 Seiten umfassendes, gedrängt und schlüssig argumentierendes Manifest, das Herzls visionär entworfener Gründung eines jüdischen Staates als der »modernen« Lösung der »jüdischen Frage« beipflichtete.24 Ganz im Sinne Herzls führte Acher aus, dass jegliche Bemühungen, den Antisemitismus juristisch zu bekämpfen, eine »Farce, die Assimilation ein Phantom«, desgleichen auch die Verheißung einer zukünftigen gerechten Gesellschaft schlicht illusionär sei. Die Judenfrage würde so lange akut bleiben, wie das jüdische Volk nicht eine Heimstatt, ein nationales Zentrum sein Eigen nennen könnte. Diese Lösung könnte, so Acher, die Reibereien zwischen Juden und den Nationen, in deren Mitte sie lebten, wenn nicht beenden, so doch erheblich vermindern. Was Buber nun vor allem bewog, sich der zionistischen Bewegung anzuschließen, war zweifellos Achers Argumentation, dass das Festhalten am Glauben der Väter nicht der alleinige Weg war, Solidarität mit seinen jüdischen Zeitgenossen zum Ausdruck zu bringen.
Hatte bis dahin Zugehörigkeit zum jüdischen Volk ausschließlich auf der religiösen Praxis innerhalb der Gemeinde beruht, bot sich nunmehr der Zionismus als revolutionäre, säkulare Alternative für jüdisches Nationalbewusstsein und Solidarität an.
Beflügelt von Birnbaums Broschüre, kehrte Buber alsbald nach Leipzig zurück, um dort gemeinsam mit seinem Cousin die örtliche Zionistische Studentenvereinigung zu gründen, die ihn zum Vorsitzenden wählte. In dieser Funktion nahm er im März 1899 an einer Tagung deutscher Zionisten in Köln teil; von dort fuhr er weiter nach Zürich, um seine Studien fortzusetzen – und seiner späteren Ehefrau Paula zu begegnen. Als Abschiedsgeschenk überreichte Eliasberg seinem Cousin den kürzlich posthum publizierten Band Griechische Kulturgeschichte des Schweizer Kunsthistorikers Jacob Burckhardt.25 Noch während seines Aufenthalts in Köln schrieb Buber an Eliasberg, dass er den Band vor sich liegen habe und sich frage, »wann werden wir solch ein Werk mit dem Titel Jüdische Kulturgeschichte haben?«.26 Das war kein müßiger Wunschtraum und sollte auch nicht einfach als erstrebenswertes akademisches Vorhaben verstanden werden, vielmehr verlieh er hier seiner Hoffnung Ausdruck, dass eine genuin jüdische Kultur entstehen werde.
Indem sich Bubers zionistische Vision entfaltete, sollte sie in der Tat von Burckhardts Kulturverständnis begleitet werden, das die Gesamtheit des spirituellen Lebens, auch das Selbstverständnis einer Nation umfasste und auf dem intellektuellen, künstlerischen sowie literarischen Wirken in Verbindung mit religiöser Tradition beruhte. Die tiefgreifende Auswirkung der italienischen Renaissance war der entscheidende Umbruch vom Mittelalter zur Neuzeit, in der das Individuum als selbstbewusstes, schöpferisch tätiges, sein Geschick und spirituelles Leben eigenverantwortlich bestimmendes Wesen auftrat und aktiv in das kulturelle Wirken eingriff.
In seinem bekanntesten Werk, Die Kultur der Renaissance in Italien von 1860, das Buber als Lektor eines israelischen Verlags Jahre später ins Hebräische übertragen ließ, beschrieb Burckhardt diesen Prozess überaus anschaulich in Begriffen und Wendungen, die ihre Wirkung auf einen jungen Menschen kaum verfehlen konnten, dem daran gelegen war, seinen Platz in der modernen Kultur zu finden, und zwar unbelastet von Ansprüchen seitens seiner ursprünglichen Herkunft.27 Indem der Mensch sich nicht länger nur »als Rasse, Volk, Partei, Korporation, Familie oder sonst in irgendeiner Form des Allgemeinen« erkannte und der »Schleier, gewoben aus Glauben, Kindesbefangenheit und Wahn« gelüftet wurde, hatte die italienische Renaissance die Befreiung des Individuums eingeleitet und so den Weg zum Übergang in die moderne Welt geebnet. Der Begriff »Renaissance« bezeichnete von daher genau eine wirkliche »Wiedergeburt«, ein Wiedererwachen des schöpferischen Geistes des Einzelnen, das so charakteristisch für das klassische Altertum gewesen, im Lauf des Mittelalters aber geschwunden war.
Bubers Verständnis von »Renaissance« als Wiedergeburt hatte sich nach und nach durch die Schriften von Burckhardts Freund und Kollegen an der Baseler Universität, Friedrich Nietzsche, entwickelt.28 In einem Artikel, der in einer Berliner jüdischen Studentenzeitschrift kurz nach Nietzsches Tod im August 1900 erschien, hob Buber die Vorstellung von der Wiedergeburt hervor, die er in die zionistische Debatte einzuführen gedachte. In diesem mehr schon einer Lobrede ähnelnden Essay unter dem Titel »Ein Wort über Nietzsche und die Lebenswerte« sprach er sich dafür aus, dass man Nietzsches Erbe unter keiner Disziplin oder Berufssparte einzuordnen vermöchte.29 Stattdessen war Nietzsche die Verkörperung einer neuen Vision dessen, was ein menschliches Wesen zu sein vermöge – ein »Abgesandter des Lebens«, »ein heroischer Mensch, der sich selber schafft und über sich selbst hinaus«.30
Diese Auffassung war für Buber umso beeindruckender, als auch Nietzsche an der allenthalben herrschenden Krankheit der Zeit litt. Daher war das, was er verkündete, nicht »sein eigenes Sein, sondern seine Sehnsucht … das erscheint uns wie die Krystallisierung unserer eigenen Tragik …«.
Die Krankheit der Zeit, so Buber, hatte die Juden sogar noch heftiger befallen – weshalb sie Nietzsches heilsamer Kunde einer Wiedergeburt nur umso dringender bedurften.
Indessen beschwor Nietzsches Kombination einer nachdrücklich individualistischen Konzeption von Wiedergeburt mit der einer nationalen Gemeinschaft neue Spannungen, wenn nicht regelrechte Widersprüche herauf. Anfangs versuchte Buber, diese schwierige Verbindung mittels der romantischen Vorstellung von »Volkstum« zu lösen. Mit Bezug auf den im späten 18. Jahrhundert geprägten Begriff »Volksseele« sprach er von einer »jüdischen Renaissance« – eine Formulierung, die er erstmals 1901 in einem Essay verwandte – womit er dem »innersten Wesen« und der charakteristischen »Individualität« des jüdischen Volkes Ausdruck zu verleihen suchte.31 Buber identifizierte die gewünschte Dialektik zwischen der schöpferischen Wiedergeburt und der des Kollektivs – eine Dialektik, die das gemeinsam-einvernehmliche Leben der Menschheit im Blick hat, »ein von Schönheit und gütiger Kraft durchtränktes Menschheitsleben, in dem jeder Einzelne und jedes Volk mit schafft und mit genießt, ein jedes in seiner Art und nach seinem Werte«.32
Dieser Kampf zwischen Golus und Zion spiegelte Bubers eigene qualvolle Entfremdung von der jüdischen Lebensweise seiner Jugendzeit wider, wie man einem mit autobiographischen Andeutungen versehenen Essay entnehmen kann, den er zwei Monate später veröffentlichte: »Feste des Lebens: Ein Bekenntnis«.33 Indem er die traditionellen jüdischen Fest- und Feiertage als das personifizierte »Du« bezeichnete, bekannte er: »Einst wandte ich mich ab von euch, wie ein Kind von der Mutter, der es sich entwachsen glaubt, müde des Gleichförmigen und nach Abenteuern verlangend. Wie die Dichtung eines Gebetes waret ihr, deren Worte das Kind wie eine Formel hersagt, lässig, des Sinnes unkundig und von den Spielen träumend, da ging ich von euch«.34 Doch gibt er zu – indem er die ödipale Metapher weiter bemüht –, dass er sich von der mütterlichen Wärme der Feiertage nicht zu befreien vermag, und erklärt: »Darum liebe ich euch, Feste meines Volkes, wie ein Kind seine Mutter liebt«.35 Die Feiertage des jüdischen Jahres wieder zu begehen sei Grundvoraussetzung für die Wiederherstellung von »Schönheit und Glück« der Familie eines Kindes, um in der ersten Person fortzufahren: »Und ich weiß: ein Volk, das keine Heimat hat, muss durch ein lebendiges Band von gemeinsamem, bedeutungsvollem Erleben die heimatliche Einheit ersetzt sehen, wenn es ein Volk bleiben soll.«36
Die gemeinschaftlich begangene Feier der traditionellen jüdischen Festtage vermittelte ja diese Erfahrung, dies sinnlich wahrnehmbare, lebendige Erleben der Zugehörigkeit, eines Bandes, das »rein geistige Güter« niemals zu knüpfen vermöchten.37 Es galt, sie als »Feste des Lebens« freudig zu bejahen – und nicht als« sinnlose Ceremonien, nicht weil Euch sie ein Gott befahl«.38 Im Gegenteil waren sie vom Volk gut geheißen und so gewollt worden, um dem Seelenleben des jüdischen Volkes in Vergangenheit und Gegenwart freudigen Ausdruck zu verleihen, das dessen »Volksseele« stetig erfüllt und formt.39 Bezeichnenderweise sind »die Feste alte Feste, zu denen man zurückkehrt, aber sie sind neu geworden. Es sind nicht starre Denkmäler schützender Tradition, sondern junge Weihegärten eines jungen Volkes. Nicht zu Festen toter Vergangenheit, sondern zu Festen lebendiger Zukunft.«40
In den Jahren 1902 bis 1903 kam Buber immer wieder auf Momente in seinem Leben zurück, in denen er sich für die kulturelle Wiedergeburt aussprach, so in einem Zyklus von drei Gedichten. Die Gedichte sind Elischa ben Abuja, genannt Acher (der Andere), gleichsam in den Mund gelegt, jenem Gelehrten, der in der talmudischen Tradition für den verfluchten Häretiker steht. Buber und andere frühe Zionisten sahen in Acher dagegen einen, der die »Ketten« des Rabbinismus abgeworfen, zu einem lebendigen, gelebten Judentum zurückgefunden hatte und einen säkularen, jüdischen Nationalismus vertrat.
Um jüdisches Leben neu zu beleben, zu einer jüdischen Wiedergeburt zu gelangen, wies Buber der »jüdischen Frau« eine zentrale Rolle zu. In einem Vortrag zum Thema »Das Zion der jüdischen Frau«, den er in Wien vor einem Publikum junger jüdischer Mädchen hielt, führte er aus: »… die nationale Erneuerung kann in ihrem innersten Kern nur von der jüdischen Frau ausgehen«.41 Um dieses Ziel zu erreichen, müsse sie »vor allem aber wieder eine Mutter sein«.42 In den langen Jahren des jüdischen Exils, insbesondere denen im Ghetto, war es die Frau gewesen, die »in das Haus eine wunderbare Naturfrische [bringt], welche das verlorene junge Grün der Heimat so weit als möglich ersetzt«.43 Angesichts der Drangsale des Exils und des Lebens im Ghetto ist es die jüdische Frau, »die in dieser Leidenszeit die Männer zum Ausharren im Glauben aneifert«.44 Doch mit der Emanzipation der Juden und ihrer damit verbundenen Verbürgerlichung sollte die jüdische Frau rasch zum schwächsten Glied der Kette werden. In geradezu rasend schneller Aneignung aller narzisstischen, geltungsbedürftigen und materialistischen Werte der modernen Gesellschaft hatte sie zum Verlust des jüdischen Heims beigetragen, denn »mit den jüdischen Sitten geht auch das jüdische Haus, mit der Treue auch die Liebe verloren«.45 Ihre Kinder suchten das unweigerlich sich daraus ergebende »Gefühl der Verlassenheit, das der Mangel an innerer Freude erzeugt«, durch äußerliches, möglichst geräuschvolles Wohlleben zu betäuben.46 Im Stich gelassen von der jüdischen Frau und mit dem Verlust der heimeligen Wärme, die sie einst in ihrem Haus verbreitet hatte, ist der »jüdische Mann« bestenfalls nur noch imstande, ein schwaches Abbild der traditionellen Observanz »mit pedantischer und hohler Passivität« aufrecht zu halten. Folglich verliert er »mehr und mehr jeden hohen Eifer und geht völlig im Erwerbsleben auf«.47





























