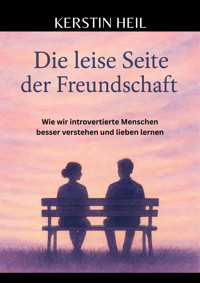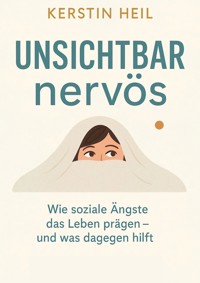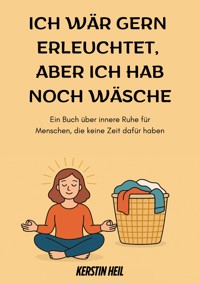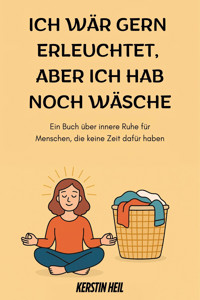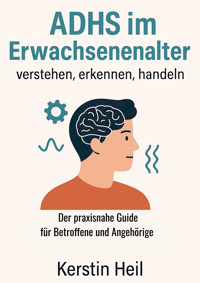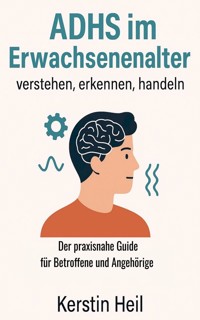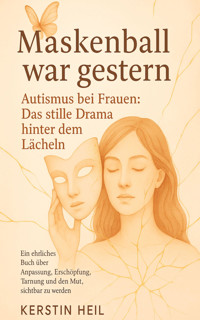
Maskenball war gestern. Autismus bei Frauen: Das stille Drama hinter dem Lächeln. E-Book
Kerstin Heil
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Ein Buch für alle, die sich zu lange verstellt haben – und endlich sie selbst sein wollen. Autistische Frauen bleiben oft unerkannt – weil sie still sind, angepasst, „funktionieren“. Doch hinter dem scheinbaren Lächeln verbirgt sich oft ein Leben voller Erschöpfung, Überforderung und innerer Einsamkeit. Dieses Buch erzählt von genau diesem unsichtbaren Drama: dem Masking. Von Frauen, die sich jahrelang verbogen haben, um nicht aufzufallen. Von einem System, das neurodivergente Menschen nicht nur übersieht – sondern aktiv zum Schweigen bringt. Und von dem Mut, sich davon zu befreien. Empathisch, klar und frech beschreibt die Autorin, selbst spät diagnostizierte Autistin, wie es ist, sich sein Leben lang anzupassen – und was passiert, wenn man damit aufhört. Ein Buch über das Erkennen, das Entlarven – und das Sichtbarwerden. Ehrlich. Tröstlich. Befreiend. Für alle, die sich in der Welt zu laut, zu empfindlich oder zu falsch fühlen – und endlich verstehen wollen, warum. Themen u. a.: Was Masking wirklich bedeutet – und wie es entsteht Warum autistische Frauen oft erst spät oder gar nicht erkannt werden Wie sich chronische Anpassung auf Körper, Psyche und Identität auswirkt Wege zurück zum echten Ich – zwischen Wut, Trauer und Selbstermächtigung Beziehungen, Kommunikation & Nähe aus autistischer Perspektive Warum die Gesellschaft uns nicht krank macht – aber erschöpft Leben nach dem Masking: mutig, ehrlich, selbstbestimmt Ein tiefgehender Ratgeber. Ein feministisches Manifest. Eine Einladung zur Rebellion – gegen das Verstecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
MASKENBALL WAR GESTERN
Autismus bei Frauen:Das stille Drama hinter dem LächelnEin ehrliches Buch über Anpassung, Erschöpfung,Tarnung und den Mut, sichtbar zu werdenvonKerstin Heil
Vorwort
Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich selbst so eins gebraucht hätte.
Eines, das mir sagt: Du bist nicht komisch. Nicht zu empfindlich. Nicht zu viel. Du bist autistisch – und das ist okay.
Ich habe über vierzig Jahre lang geglaubt, dass mit mir etwas nicht stimmt. Ich war müde vom Funktionieren, vom „Normal-Sein-Spielen“, vom Verbiegen und Erklären. Ich konnte so vieles – und fühlte mich trotzdem ständig überfordert. Warum? Ich wusste es nicht. Ich wusste nur: Ich bin erschöpft. Und allein.
Erst als ich so ein Buch gelesen habe wie dieses fiel das erste Mal etwas von mir ab. Und gleichzeitig begann ein Weg, der mir mehr Angst gemacht hat als alles vorher: mich selbst wirklich kennenzulernen. Ohne Maske. Ohne Schutzprogramm. Ohne Dauerlächeln.
Dieses Buch ist für dich, wenn du dich wiedererkennst – oder jemanden liebst, der sich täglich durch eine Welt kämpft, die zu laut, zu schnell, zu chaotisch ist. Es ist für alle Frauen, die sich durchs Leben maskiert haben, weil sie dachten, sie müssten anders sein, um dazugehören zu dürfen.
Du wirst in diesen Seiten keine Therapieanleitungen finden, keine medizinischen Fachbegriffe, kein Zahlenwerk. Stattdessen findest du hier Geschichten. Gefühle. Gedanken, die endlich Worte bekommen haben.
Ich will, dass du dich verstanden fühlst. Ich will, dass du spürst: Du bist nicht allein. Und ich will dir Mut machen, dein eigenes „Ich“ Stück für Stück unter der Maske hervorzuholen.
Denn Maskenball war gestern.
Jetzt bist du dran.
Deine Kerstin
Kapitel 1: Ich wirke okay – bin’s aber nicht
Oder: Wie man ein ganzes Leben lang lächelt, um nicht aufzufallen
Ich bin nicht kaputt. Ich bin nur müde.
Müde vom Lächeln, wenn ich innerlich schreien möchte.Müde vom Zuhören, obwohl mein Kopf längst in Watte ist.Müde vom Funktionieren, obwohl alles in mir nach Pause ruft.
Ich wirke ruhig. Ich lächle. Ich bin höflich. Ich bin nett. Ich bin erschöpft. Nicht, weil ich zu viel arbeite. Nicht, weil ich zu wenig schlafe. Sondern weil ich ein Leben lang versuche, nicht aufzufallen. Nicht zu stören. Nicht anders zu wirken.
Dabei bin ich anders. Schon immer. Und ich hab’s verdammt lang verdammt gut versteckt.
Die Kunst, nicht aufzufallen
Ich erinnere mich an die erste Besprechung im neuen Job. Ich saß zwischen anderen Kolleg:innen, mein Block auf dem Schoß, der Stift ordentlich auf der Linie, die Hände im Schoß gefaltet. Ich nickte an den richtigen Stellen, lachte verhalten mit, sagte möglichst nichts. Nicht, weil ich nichts zu sagen hatte – sondern weil ich innerlich so damit beschäftigt war, nicht aufzufallen, dass für echte Worte kein Raum blieb.
Ich wollte dazugehören. Und dazu musste ich unauffällig sein. Unkompliziert. Sozial verträglich.
„Ganz normal.“
Aber was heißt das eigentlich – normal?
In meinem Fall hieß es: still sein, wenn ich zu laut fühlte. Lächeln, wenn mir nach Rückzug war. So tun, als würde ich gerne in Gruppen arbeiten.So tun, als würde mich das Rascheln, das Piepen, das Plappern nicht fertig machen. So tun, als würde ich gerne über das Wetter reden. (Was ich übrigens nicht tue. Nie.)
Herzlich willkommen im Leben mit Autismus
Speziell als Frau. Oder als Mensch, der gelernt hat, sich anzupassen. Weil Nicht-Mitmachen bedeutet: Isolation. Unverständnis. Kritik. Oder einfach nur diesen Blick. Diesen unmissverständlichen Blick, der sagt:
„Was stimmt denn nicht mit dir?“
Manchmal kommt der Blick ohne Worte.Manchmal mit:– „Du bist aber sensibel.“– „Das bildest du dir doch ein.“– „Das ist doch nicht so schlimm.“– „Stell dich nicht so an.“– „Andere schaffen das doch auch.“
Und irgendwann glaubt man das.Man glaubt, dass man falsch ist.Weil man ständig zu viel fühlt, zu viel denkt, zu sehr reagiert.Weil man nicht ins Raster passt.Weil man sich nicht abends einfach „treffen“ möchte. Weil Smalltalk anstrengend ist.Weil ein volles Einkaufszentrum wie ein Angriff auf alle Sinne ist.Weil man sich nach Klarheit sehnt, nach Echtheit, nach Ruhe – und sich trotzdem dauernd verstellt, damit man niemandem zur Last fällt.
Was ist Masking – und warum tun wir das?
„Masking“ – das klingt irgendwie niedlich. Wie Karneval. Oder Theater. In Wirklichkeit ist es ein täglicher Kraftakt.
Masking bedeutet: Ich spiele Normalität.
Ich beobachte andere und ahme nach.Ich modelliere, wie man guckt, wie man reagiert, wie man redet.Ich spüre genau, was von mir erwartet wird – und liefere.Und das, obwohl es in mir tobt. Obwohl ich innerlich längst in die Knie gegangen bin.
Masking heißt: Ich bin immer auf Sendung.Ich steuere, wie ich spreche. Wie ich sitze. Wie ich reagiere.Ich halte Blickkontakt, auch wenn er mich nervlich zerfetzt.Ich nicke, auch wenn ich nicht zustimme.Ich sage „Kein Problem“, obwohl es gerade ein riesiges ist.
Ich funktioniere. Und alle klatschen.Weil ich doch „so gut zurechtkomme“.
Ein Alltag im Tarnmodus
Ich wache auf und checke: Wie viel Energie habe ich heute? Kann ich reden? Kann ich reagieren? Reicht’s für die Kaffeemaschine und den Supermarkt? Oder muss ich heute meine Reaktionen noch tiefer vergraben?
Ich treffe Menschen und verhalte mich, wie sie es erwarten. Ich spreche in „freundlichem Ton“. Ich frage nach dem Wochenende. (Auch wenn mich ehrlich gesagt nicht interessiert, wer wandern war oder wer den Keller neu gestrichen hat.) Ich sitze in Teamsitzungen und vergesse zu atmen, weil mein ganzer Fokus auf Körpersprache, Mimik, Stimme liegt.
Das ist Masking. Und Masking ist keine Spielerei. Es ist kein freiwilliges Hobby. Es ist ein Schutzmechanismus. Ein Überlebensmodus. Eine angepasste Tarnkappe, die wir oft schon als Kinder aufsetzen – ohne Anleitung, ohne Warnhinweise, ohne Pause.
Manche von uns merken früh, dass sie „anders“ sind. Andere wissen es erst mit vierzig.Aber wir alle haben eins gemeinsam: Wir haben gelernt, uns so zu verhalten, dass wir „nicht stören“. Dass wir durchrutschen. Dass wir keine Probleme machen.
Was Masking mit uns macht
Masking hat Nebenwirkungen. Nicht auf dem Beipackzettel, aber im Leben:
– Wir verlieren den Kontakt zu uns selbst.– Wir übergehen unsere Bedürfnisse.– Wir ignorieren unsere Reizgrenzen.– Wir leben in chronischem Stress.– Wir entwickeln Burnout, Depressionen, Angststörungen.– Und niemand versteht, was los ist – weil wir doch „so gut funktionieren“.
Ja. Wir funktionieren. Aber wir leben nicht.
Wir spielen Rollen.Wir liefern ab.Wir analysieren, imitieren, regulieren – und verlieren uns dabei selbst.
Und irgendwann kommt der Moment, an dem das System streikt.
Der Körper sagt: „Ich kann nicht mehr.“Die Seele sagt: „Du hast mich vergessen.“Und der Kopf? Der funktioniert weiter. Erstmal.Bis er irgendwann auch auf Pause schaltet – und nichts mehr geht.
„Du siehst gar nicht autistisch aus.“
Ein Satz wie ein Kompliment gemeint – und doch wie ein Schlag in den Magen. Denn was sagt er wirklich?
Er sagt:„Du wirkst normal. Also kann das ja gar nicht stimmen mit dem Autismus.“Oder:„Du benimmst dich nicht auffällig – also kann das nicht echt sein.“
Solche Sätze klingen harmlos. Aber sie treffen dort, wo wir am verletzlichsten sind:an dem Punkt, an dem wir unser ganzes Leben lang gelernt haben, nicht sichtbar zu sein.Nicht auffällig. Nicht „seltsam“. Und dann kommen diese Worte – und machen genau das unsichtbar, was uns am meisten Kraft kostet: unser tägliches inneres Überleben.
Was Menschen nicht sehen:
Wie viel Energie es braucht, sich „normal“ zu verhalten.
Wie sehr wir uns dafür selbst übergehen.
Wie oft wir nach Gesprächen stundenlang still daliegen müssen, um uns zu regenerieren.
Wie sehr wir uns von uns selbst entfernen, wenn wir ständig versuchen, jemand anderes zu sein.
Und:Dass es in Wahrheit nicht darum geht, „nicht wie autistisch“ zu wirken. Sondern darum, nicht wie das Klischee eines autistischen Mannes zu wirken. Denn das Bild, das viele im Kopf haben, ist männlich, technisch, sozial plump, gefühlsfern.
Und das bin ich nicht.Ich bin sensibel.Ich bin empathisch.Ich bin sozial – aber eben anders.Ich spüre Stimmungen, bevor sie jemand ausspricht.Ich lese zwischen Zeilen, statt auf der Zeile.Ich verstehe komplexe Zusammenhänge – aber manchmal nicht, wann ich dran bin mit Reden.
Ich bin autistisch. Nur sieht man’s mir nicht an. Weil ich gut getarnt war. Weil ich gelernt habe, durchzukommen.
Alltagsbeispiele – oder: Die kleinen Katastrophen im Kopf
Manche Tage bestehen aus lauter kleinen Überforderungen. Von außen kaum zu erkennen – von innen ein Wirbelsturm. Hier drei klassische Situationen:
Supermarkt.Ich will nur schnell einkaufen. Die Kassiererin fragt freundlich: „War’s das?“ Ich nicke. Dann dieses panische Kitzeln im Hirn: Floskel! Welche Floskel?! Ich rufe mir ein Skript auf. Ah, ja: „Schönen Tag noch!“ – Lächeln nicht vergessen.
Währenddessen:– Neonlicht.– Musik.– Piepen.– Menschen zu nah.– Rascheln.– Gerüche.Ich funktioniere. Ich lächle. Ich zahle.Ich verlasse den Laden mit pochendem Kopf und zittrigen Händen.Für andere war’s ein banaler Einkauf.
Büro.Smalltalk in der Teeküche. Jemand fragt: „Und, was hast du am Wochenende gemacht?“Ich friere innerlich ein. Soll ich ehrlich sagen: Ich lag im abgedunkelten Zimmer mit Geräuschunterdrückung und habe Podcasts gehört, weil mein Nervensystem auf Durchzug war?Nein. Ich greife zum Default-Satz: „Ach, bisschen entspannt. Du so?“
Die Person erzählt vom Wandern. Ich nicke, lächle, sage: „Ja, Wandern ist ja... äh, gesund.“
Peinlich.
Ich gehe zurück an den Schreibtisch, als hätte ich gerade ein Bewerbungsgespräch hinter mir. Erschöpft. Leise wütend auf mich. Und gleichzeitig auf die Welt.
Familienfeier.Alle reden durcheinander. Kinder kreischen. Das Geschirr klappert. Die Heizung rauscht.Oma will drücken. Tante spricht zu laut. Onkel will diskutieren. Ich sitze da, wie eingeklemmt zwischen zwei Frequenzen. Mein Atem ist flach. Mein Herz hämmert. Meine Schultern schmerzen vom Dauer-Anspannen.
Ich halte durch.Ich bin höflich.Ich bin nett.Ich zahle mit zwei Tagen völliger Erschöpfung.
Die unsichtbare Erschöpfung
Viele von uns fallen nicht durch „Fehlverhalten“ auf – sondern durch schleichende Symptome.– Wir sind ständig müde.– Wir kriegen Kopfschmerzen, Magenprobleme, Schlafstörungen.– Wir reagieren empfindlich auf Licht, Geräusche, Gerüche.– Wir sind reizoffen – und gleichzeitig reizüberladen.– Wir wirken still, zurückhaltend, anstrengend oder „launisch“.
Und weil das so wenig sichtbar ist, verstehen es die wenigsten.
Irgendwann – oft nach Jahrzehnten – kommt der Zusammenbruch.Burnout. Depression. Panikattacken. Totalausfall.
Und alle wundern sich:„Was ist denn mit der los? Die war doch immer so taff.“
Ja. War ich. Weil ich funktioniert habe. Nicht gelebt. Funktioniert.
Warum so spät erkannt?
Weil die Diagnosekriterien für Autismus jahrzehntelang auf männliche Verhaltensmuster ausgerichtet waren. Weil man weiblichen Autismus lange nicht sehen wollte. Oder nicht sehen konnte. Oder ihn mit etwas anderem verwechselt hat.
Weil viele von uns angepasst sind bis zur Selbstverleugnung.Weil wir lieber lächeln, als erklären, warum ein lautes Geräusch körperlich schmerzt.Weil wir gelernt haben, dass unser Erleben „übertrieben“ wirkt.Weil wir lieber dazugehören wollen, als ständig erklären zu müssen, warum wir so sind, wie wir sind.
Darum landen viele von uns erst mal in ganz anderen Diagnosen:– Depression– Angststörung– Zwangsstörung– ADHS– Borderline
Und irgendwo dazwischen: die Wahrheit. Still. Versteckt. Autistisch. Und irgendwann bricht sie durch – oft erst dann, wenn nichts mehr geht.
Und dann kommt:Verwirrung.Zweifel.Trauer.
Der Moment der Erkenntnis
Für viele beginnt der Weg nicht mit einer Diagnose, sondern mit einem Gefühl.Einer inneren Ahnung: Ich bin anders. Und das ist nicht falsch – aber auch nicht leicht.
Vielleicht war’s ein Text im Internet.Ein Gespräch.Ein Video.Ein Selbsttest.Ein Buch wie dieses.
Und plötzlich fällt alles an seinen Platz.
Plötzlich ergibt das eigene Leben Sinn.Die ständige Erschöpfung.Die Reizempfindlichkeit.Die Überanpassung.Die sozialen Schwierigkeiten, die niemand sehen wollte.
Und gleichzeitig:Eine neue Frage.Wer bin ich eigentlich ohne Maske?
Warum dieses Buch?
Weil ich all das selbst erlebt habe.Weil ich weiß, wie es sich anfühlt, jahrelang zu glauben, man sei „falsch“.Weil ich weiß, wie viel Kraft es kostet, sich selbst nicht zu verstehen – und trotzdem jeden Tag weiterzumachen.
Dieses Buch ist keine wissenschaftliche Abhandlung. Es ist keine Anleitung, wie man „besser klarkommt“ oder sich „anpasst“.Es ist kein Ratgeber im klassischen Sinn.Es ist ein Raum.Ein Ort, an dem du ankommen darfst – mit allem, was du bist.Ein Ort, der sagt: Du bist nicht kaputt. Du bist nicht zu sensibel. Du bist nicht schwierig.
Du bist anders. Und das ist okay.
Ich schreibe für alle, die nie laut waren – aber innerlich schreien.Für alle, die funktionieren – und dabei innerlich verschwinden.