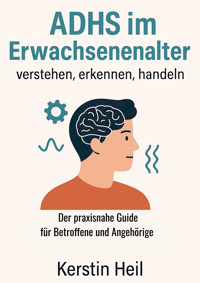4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Ich wär gern erleuchtet, aber ich hab noch Wäsche Buddhistische Psychologie für ein ganz normales Leben – humorvoll, menschlich, alltagstauglich Du willst achtsamer leben – aber dein Alltag ist voll, deine Gedanken laut und deine Wäsche macht sich leider nicht von selbst? Dann ist dieses Buch genau für dich. "Ich wär gern erleuchtet, aber ich hab noch Wäsche" verbindet die Weisheit der buddhistischen Psychologie mit den Herausforderungen eines ganz normalen, modernen Lebens. Ohne spirituelles Blabla. Ohne Leistungsdruck. Dafür mit viel Herz, Humor und einer großen Portion Mitgefühl für all die inneren Dramen, die uns begleiten: Selbstkritik, Reizüberflutung, emotionale Achterbahn, Erschöpfung – und der ganz normale Wahnsinn zwischen To-do-Liste und Sinnkrise. Die Autorin nimmt dich mit auf eine Reise zu mehr Achtsamkeit, innerer Klarheit und echter Selbstfreundschaft – auch (und gerade dann), wenn du keine Zeit für Schweigeretreats hast oder dein letzter Meditationsversuch im Gedankenchaos versunken ist. Was dich erwartet: 35 liebevoll-freche Kapitel über Achtsamkeit, Ego, Emotionen, Mitgefühl und Alltagswahnsinn buddhistische Grundbegriffe verständlich erklärt – ohne spirituelles Chinesisch praktische Übungen für achtsame Momente mitten im Trubel ein Stil, der klug, nahbar und humorvoll ist – wie ein gutes Gespräch mit einer Freundin ein Buch für leise Menschen, sensible Seelen, müde Mütter, überdrehte Denker:innen und alle, die gern tief gehen, aber bitte ohne Räucherstäbchen-Zwang Für alle, die mitten im Leben stehen – und trotzdem (oder gerade deshalb) den Weg zu sich selbst gehen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
IMPRESSUM
Autorin und verantwortlich im Sinne des § 5 TMG / § 55 RStV:Kerstin HeilSchenkenböhlstraße 23 e67098 Bad DürkheimDeutschland
E-Mail: [email protected]
Titel:Ich wär gern erleuchtet, aber ich hab noch Wäsche
Ein Buch über innere Ruhe für Menschen, die keine Zeit dafür haben
Veröffentlicht über Tolino Media
Satz und Layout: MS Office 365Covergestaltung: Canva Pro / Kerstin Heil / ChatGPT
Hinweis zur KI-Nutzung:
Dieses Werk wurde in Teilen mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erstellt.Verwendetes Tool: ChatGPT von OpenAI (Textassistenz, Formulierungshilfe, Cover).Die finale inhaltliche Verantwortung, Auswahl und Gestaltung lagen bei der Autorin.Alle Inhalte wurden sorgfältig geprüft und verletzen nach bestem Wissen keine Urheberrechte oder Persönlichkeitsrechte Dritter.
Haftungsausschluss:Dieses Buch wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Autorin übernimmt jedoch keine Haftung für eventuelle Schäden oder Nachteile, die direkt oder indirekt aus der Nutzung der in diesem Buch enthaltenen Informationen entstehen.
Es handelt sich nicht um eine medizinische, psychologische, rechtliche oder steuerliche Beratung. Bei gesundheitlichen, rechtlichen oder anderen relevanten Fragen wird empfohlen, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
Alle dargestellten Erfahrungen, Tipps und Einschätzungen sind subjektiv und spiegeln die persönliche Meinung der Autorin zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider.
Für externe Links oder Hinweise auf Produkte, Dienstleistungen oder Webseiten wird keine Verantwortung übernommen.
Copyright:© 2025 Kerstin HeilAlle Rechte vorbehalten.Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der Autorin unzulässig.
Vorwort
Dieses Buch ist für dich, wenn du dich schon mal gefragt hast, ob man gleichzeitig erleuchtet und genervt sein kann.
Wenn du versuchst, achtsam zu leben – aber trotzdem manchmal dein Handy anschreist.
Wenn du dir Mitgefühl vornimmst – aber dann wieder mit deinem inneren Kritiker in den Ring steigst.
Wenn du spirituelle Weisheit schätzt – aber bitte ohne Räucherstäbchenpflicht und Lotussitz-Zwang.
Dann bist du hier genau richtig.
Ich habe dieses Buch nicht geschrieben, weil ich weise bin. Sondern weil ich mich regelmäßig dabei ertappe, wie ich in alten Mustern festhänge, obwohl ich es doch „besser wissen“ müsste. Weil ich oft mitten im Alltag vergesse, was ich theoretisch längst verstanden habe. Und weil ich glaube, dass genau dort – im Vergessen, im Stolpern, im Menschsein – der eigentliche Weg beginnt.
„Ich wär gern erleuchtet, aber ich hab noch Wäsche“ ist keine Anleitung zur inneren Perfektion. Es ist ein liebevoll-chaotisches Nachschlagewerk für all jene, die zwischen Zahnarzttermin und Seelenkrise versuchen, ein bisschen klarer zu sehen, weicher zu fühlen und freundlicher mit sich zu sein.
Die buddhistische Psychologie liefert dafür erstaunlich alltagstaugliche Werkzeuge – wenn man sie nicht zu ernst nimmt.
Dieses Buch versucht, diese Weisheit herunterzuholen von ihrem Thron und mitten hinein in deinen Tag zu stellen – neben die Kaffeemaschine, den Wäschekorb und die To-do-Liste.
Du findest hier keine Erleuchtungsgarantie. Aber viele Aha-Momente. Und vor allem die Erlaubnis, nicht perfekt sein zu müssen, um innerlich zu wachsen.
Lass uns gemeinsam schauen, was möglich ist – zwischen Achtsamkeit und Alltag, zwischen Mitgefühl und Müdigkeit, zwischen „Ich sollte meditieren“ und „Ich will einfach nur meine Ruhe.“
Schön, dass du hier bist. Mach’s dir bequem. Auch mit Wäsche.
Namasté & Nervenkeks,
deine Kerstin
Kapitel 1: Achtsamkeit? Ich kann nicht mal stillsitzen
„Du musst einfach nur im Moment sein.“
Ja, danke. Und ich muss auch einfach nur die Steuer machen, die Katze vom Küchenschrank holen und endlich aufhören, an das peinliche Gespräch von 2007 zu denken. Einfach. Nur.
Die Sache mit dem Moment
Ich erinnere mich noch gut an meinen allerersten Versuch, achtsam zu sein. Ich hatte irgendwo gelesen, dass Achtsamkeit der Schlüssel zu innerem Frieden sei. Das klang gut. Ich wollte auch Frieden. Und wenn es dafür nur ein bisschen Atembeobachtung braucht – her damit.
Also setzte ich mich hin. Rücken gerade. Beine verschränkt. Hände im Zen-Mudra (ja, ich hatte vorher gegoogelt, wie das aussieht). Ich atmete ein. Ich atmete aus. Und dann…
…fiel mir ein, dass ich vergessen hatte, die Waschmaschine anzustellen.
…musste ich plötzlich dringend wissen, ob ich damals in der fünften Klasse zu gemein zu Lisa war.
…und was war das eigentlich für ein Geräusch? Hat die Katze wieder die Fernbedienung geklaut?
Achtsamkeit, so stellte ich fest, war offenbar nicht mein Ding. Zumindest nicht, wenn man dabei nichts denken darf. Und ich dachte ziemlich viel. Sehr aktiv. Mit Begeisterung.
Was Achtsamkeit (nicht) ist
Das Problem ist: Achtsamkeit wird in unserer Welt oft romantisiert. In Hochglanz. Menschen in Leinenhosen sitzen lächelnd auf einem Steg am See. Kerzen flackern. Irgendwo dudelt ein Gong.
Und dann kommt man selbst, mit seiner müden Alltagsbirne und den überreizten Nerven, und versucht, „den Moment zu spüren“, während das Handy vibriert, der Bauch knurrt und das Gehirn eine PowerPoint-Präsentation aller noch offenen To-dos durchrattert.
Dabei ist Achtsamkeit im buddhistischen Sinne kein Wellness-Trend. Sie ist kein Zustand, kein Ziel, kein hübsches Gefühl. Sie ist eine Praxis. Und mit Praxis ist gemeint: Üben. Wieder und wieder. Trotz allem. Gerade mit allem.
Achtsamkeit bedeutet schlicht: Da sein mit dem, was ist. Ohne Bewertung.
Nicht: „Da sein mit dem, was schön ist.“Nicht: „Da sein mit dem, was ich gerne hätte.“
Sondern: Da sein. Punkt.
Achtsamkeit im Alltag: Der Testlauf
Nachdem mein erster Meditationsversuch also mehr Netflix für die Gedanken war als tiefe Erleuchtung, beschloss ich, das Ganze kleiner anzugehen. Ich musste ja nicht gleich die Dalai-Lama-Ausbildung starten.
Also nahm ich mir vor, einfach mal achtsam die Zähne zu putzen. Ja, wirklich.
Anleitung:
Zahnbürste in die Hand.
Spüren, wie sie sich anfühlt.
Wasser auftragen. Den kalten Strahl bewusst wahrnehmen.
Zahnpasta nicht automatisch, sondern achtsam auf die Borsten drücken.
Putzen. Nicht denken. Nur fühlen. Bewegen. Spüren.
Klingt einfach?
Pustekuchen.
Ich habe in der Zeit drei Einkaufslisten erstellt, einen inneren Streit mit einer Kollegin von vor drei Jahren geführt und mich gefragt, ob ich eigentlich genug Vitamin D bekomme.
Aber: Ich habe es versucht. Und das zählt. Denn das ist Achtsamkeit. Nicht, dass es klappt. Sondern dass man es merkt, wenn man abschweift. Und dann zurückkehrt. Immer wieder. Wie ein freundlicher Hund, der merkt, dass er vom Weg abgekommen ist, und sich dann selbst zurück zur Fährte bringt – mit wedelndem Schwanz.
Buddhismus für Ungeduldige
In der buddhistischen Psychologie ist Achtsamkeit (Sati) keine hübsche Dekoration – sie ist die Grundlage. Sie hilft uns, zu erkennen, was gerade geschieht, innen wie außen. Und zwar bevor wir in unsere üblichen Reaktionen kippen: Werten, bewerten, fliehen, kämpfen, kontrollieren.
Wer achtsam ist, hat die Chance, kurz innezuhalten, bevor der Autopilot übernimmt. Bevor der Gedanke zur Selbstkritik wird. Bevor die Emotion zur Explosion wird. Bevor aus einem kurzen Impuls ein Drama wird.
Aber genau das fällt uns schwer. Denn unser Hirn liebt Schnelligkeit. Abkürzungen. Gewohnheit. Es denkt lieber automatisch als bewusst.
Achtsamkeit ist das Gegenteil davon. Sie sagt: „Moment, ich schau erst mal hin.“
Die innere To-do-Liste
Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich trage innerlich ständig eine Art Projektmanagement-System mit mir herum. Dinge, die ich erledigen sollte. Sachen, die ich verbessern müsste. Eigenschaften, die ich gerne hätte, aber nicht besitze.
Als ich anfing, mich mit Achtsamkeit zu beschäftigen, dachte ich, das sei nur ein weiteres Tool in dieser Liste. So à la:
Achtsam sein
Weniger denken
Gelassen wirken
Bitte alles möglichst gleichzeitig und perfekt
Und dann passierte das Unerwartete: Ich lernte, die Liste überhaupt erst mal zu bemerken. Nicht, um sie sofort abzuarbeiten – sondern um zu erkennen, wie viel sie von mir fordert. Und wie selten ich einfach nur bin.
Im Buddhismus heißt das: bewusstes Dasein jenseits von Tun und Haben.
Kein Ziel. Kein Zustand. Nur dieser Moment.
Die Drei-Atemzüge-Pause (aka: mein Lebensretter)
Weil ich kein Fan von stundenlangem Lotus-Sitzen bin (mein rechtes Knie streikt ab Minute sieben), habe ich mir eine ganz einfache Übung angewöhnt, die ich hier mit dir teilen will:
Drei-Atemzüge-Pause:
Stopp. Was tue ich gerade?
Einatmen. Spüren, wie die Luft einströmt.
Ausatmen. Spüren, wie sie wieder geht.
Nochmal. Zweimal.
Lächeln. Oder fluchen. Beides ist erlaubt.
Drei Atemzüge. Mehr nicht. Und trotzdem verändert sich etwas. Ich komme raus aus dem Autopiloten, rein in den Moment. Kurz. Aber spürbar.
Ich habe das im Supermarkt probiert, an der Ampel, beim Scrollen durch soziale Medien. Und manchmal – okay, eher selten – sogar beim Zähneputzen.
Achtsamkeit für Neurodiverse, Viel-Fühlende & Gedankenjongleure
Falls du zu den Menschen gehörst, die alles gleichzeitig denken, fühlen, wahrnehmen – willkommen im Club.
Achtsamkeit ist nicht immer der einfache Weg für uns. Unsere Gehirne laufen oft auf Hochtouren. Da kann „einfach mal sitzen und atmen“ schnell wie ein Höllenritt wirken.
Aber genau deshalb lohnt es sich. Nicht, weil wir dadurch still werden. Sondern weil wir lernen, uns nicht von der Lautstärke abschrecken zu lassen.
Du musst nicht ruhig sein, um achtsam zu sein. Du musst nur da sein.
Selbst wenn du denkst:
„Ich kann nicht mehr. Ich fühl zu viel. Ich will weg.“
Dann sei achtsam mit genau dem.
Warum es nicht um Erfolg geht
Ich habe lange gedacht, Achtsamkeit müsse „funktionieren“. Also mich irgendwie besser, ruhiger oder erleuchteter machen.
Tut sie aber nicht. Nicht sofort. Und manchmal: gar nicht sichtbar.
Manche Tage meditiere ich drei Minuten und fühle mich danach genauso hibbelig wie vorher. An anderen Tagen merke ich plötzlich, dass ich in einer Stresssituation nicht ausgerastet bin – und erinnere mich: Ah. Vielleicht war das Achtsamkeit. Hinterrücks. Still und heimlich.
Der Punkt ist: Achtsamkeit ist kein Ziel, sondern eine Beziehung zum Leben. Und Beziehungen brauchen Zeit, Geduld – und Humor.
Fazit: Der Moment nervt. Und ist trotzdem alles, was wir haben.
Ich sage dir ganz ehrlich: Ich bin nicht gut im Hier und Jetzt. Ich verliere mich in Erinnerungen, sorge mich um die Zukunft und rede mit imaginären Versionen von Menschen, die es vielleicht gar nicht mehr interessiert.
Aber genau deswegen schreibe ich dieses Buch. Weil ich glaube, dass wir nicht perfekt achtsam sein müssen – sondern ehrlich. Und mutig genug, immer wieder zurückzukommen.
Zum Atem. Zum Körper. Zum Leben.
Selbst wenn die Katze auf dem Küchenschrank hockt. Selbst wenn das Gehirn sich gerade einen Horrorfilm aus Sorgen ausdenkt. Selbst wenn du beim Meditieren an Schokolade denkst (du bist nicht allein).
Achtsamkeit heißt nicht: „Ich bin Zen.“
Achtsamkeit heißt: „Ich bin da.“Trotz allem. Wegen allem. Mit allem.
Kleine Achtsamkeitsübungen für den Alltag (zum Ausprobieren)
Die Achtsamkeitsdusche:
Beim Duschen jeden Sinn bewusst aktivieren: spüren, riechen, hören. Nicht multitasken. Nicht planen. Nur duschen.
Achtsam essen:
Einen Bissen nehmen. Kauen. Schmecken. Nicht nebenbei lesen, scrollen oder nachdenken. Nur kauen. (Ja, das ist schwerer, als es klingt.)
Der Achtsame Kaffee- oder Teemoment:
Getränk zubereiten. Hinsetzen. Trinken. Bewusst. Schluck für Schluck.
Achtsam fluchen:
Wenn’s knallt: innehalten. Wahrnehmen. Dann fluchen – bewusst, herzlich und präsent. Auch das ist Leben.
Nächstes Kapitel:
Ich denke, also bin ich … verwirrt
Warum deine Gedanken nicht immer Recht haben – und was buddhistische Psychologie dagegen vorschlägt (außer schweigen).
Kapitel 2: Ich denke, also bin ich … verwirrt
„Glaub nicht alles, was du denkst.“
Klingt gut.
Funktioniert mittelmäßig, wenn dein Kopf ein Ideen-Feuerwerk mit Dauerbetrieb ist.
Oder ein Schwarzmalerei-Studio.
Oder ein nervöser Hamster auf Koffein.
Willkommen im Oberstübchen
Man sagt, wir denken am Tag zwischen 60.000 und 80.000 Gedanken. Wenn du neurodivers bist oder einfach nur ein bisschen zu viel Zeit mit Grübeln verbringst, kann es locker das Doppelte sein. Mein Hirn jedenfalls hat keine Pausetaste. Und wenn ich es mal zur Ruhe bringen will, reagiert es wie ein trotziges Kind auf Zuckerentzug: laut, wild und mit Fantasie.
Gedanken sind faszinierend. Sie kommentieren, analysieren, bewerten – und zwar pausenlos. Sie spielen uns Szenarien vor, schreiben innere Drehbücher und führen manchmal komplette Gerichtsverhandlungen durch. Mit Anklage. Mit Verteidigung. Mit Drama, Musik und Rückblenden.
Und das Problem?
Wir glauben ihnen. Immer.
Gedanken ≠ Wahrheit
In der buddhistischen Psychologie gilt eine einfache, aber revolutionäre Erkenntnis:
„Du bist nicht deine Gedanken.“
Halt. Kurz sacken lassen.
Das bedeutet: Nur weil dein Hirn denkt, dass du versagt hast, hässlich bist, dich blamiert hast oder niemals glücklich wirst, ist das nicht automatisch wahr.
Aber unser Gehirn liebt seine Geschichten. Es hält sich selbst für sehr überzeugend. Es klingt ja auch so vernünftig!
„Natürlich denkt das jeder.“
„Das ist doch logisch.“
„Ich spür das doch.“
Tatsächlich denkt unser Gehirn meistens das, was es immer denkt – weil es das am leichtesten kann. Gedanken sind wie alte Jeans: eingetragen, bequem, sitzen nicht besonders gut, aber hey, man kennt sie halt.
Die Gedanken-Falle
Vielleicht kennst du das:
Du gehst durch die Straße, jemand schaut dich komisch an – dein Kopf: „Der mag mich nicht. Ich seh bestimmt komisch aus. War das eine Bewertung? Warum bin ich so unangenehm?“
Jemand schreibt nicht sofort zurück – dein Kopf: „Ich hab was Falsches geschrieben. Ich bin zu aufdringlich. Die will keinen Kontakt mehr. Ich bin zu viel.“
Du willst etwas Neues anfangen – dein Kopf: „Du bist nicht gut genug. Andere können das besser. Wer sollte dir zuhören?“
Buddhistische Psychologie nennt das „Vikalpa“ – die Neigung des Geistes, in Fantasien, Konstrukten und Bewertungen abzudriften. Der Verstand will verstehen. Einordnen. Kontrolle haben. Und weil er ungern Unsicherheit erträgt, denkt er sich einfach eine Geschichte aus.
Und du?
Nickst innerlich.
Und glaubst es.
Warum Gedanken süchtig machen
Gedanken sind nicht neutral. Sie lösen Gefühle aus. Dein Hirn denkt etwas Negatives – dein Körper reagiert mit Anspannung, dein Herz rast, deine Stimmung kippt. Das wiederum bestätigt deinen Gedanken:
„Siehste! Ich fühl’s ja. Muss also stimmen!“
Buddhistische Psychologie sagt: Gefühle folgen Gedanken.
Und beide sind flüchtig. Aber wir verwechseln sie oft mit Realität.
Das ist wie beim Film: Nur weil es spannend ist, heißt das nicht, dass du wirklich verfolgt wirst.
Aber unser Nervensystem checkt das nicht sofort. Es reagiert auf die Bilder, auf den inneren Monolog, als wäre es echt. Du denkst also einen negativen Gedanken – fühlst dich mies – und glaubst noch mehr negative Gedanken. Willkommen im Gedankenkarussell.
Der innere Kommentator (und warum er ständig labert)
Stell dir vor, dein Gehirn ist ein überengagierter Sportkommentator. Er kommentiert jede Szene deines Lebens – mit Meinung, Deutung und Drama. Meistens ohne eingeladen worden zu sein.
Du willst was sagen – er flüstert: „Mach dich nicht lächerlich.“
Du sagst was – er ruft: „Das war zu viel!“
Du sagst nichts – er meckert: „Warum bist du so komisch?“
Buddhistische Praxis lädt uns ein, diesen Kommentator nicht abzuschalten, sondern kennenzulernen. Ihn zu beobachten. Ihm zuzuhören – ohne ihm alles zu glauben.
Im Zen sagt man dazu: „Den Geist wie den Himmel sehen – und die Gedanken wie Wolken.“
Sie kommen.
Sie gehen.
Und du bist nicht jede Wolke. Du bist der Himmel.
Die Kraft der Metakognition: Wer denkt da eigentlich?
Einer der spannendsten Aspekte in der buddhistischen Psychologie ist die Beobachtung dessen, was geschieht. Das wird oft als „reines Gewahrsein“ beschrieben. Also: nicht bewerten, nicht analysieren – nur sehen, dass da ein Gedanke ist.
Das fühlt sich an wie ein Perspektivwechsel:
Statt im Film mitzuspielen, sitzt du plötzlich im Kinosessel und schaust zu.
Beispiel:
Gedanke: „Ich bin nicht gut genug.“
Reaktion früher: Sofortige Scham, Rückzug, Selbstabwertung.
Reaktion mit Achtsamkeit: „Aha, interessanter Gedanke. Der taucht also wieder auf. Hm. Hallo, alter Bekannter.“
Das ist nicht zynisch. Das ist heilsam. Denn es nimmt dem Gedanken die Macht. Du erkennst: Ich habe einen Gedanken – aber ich bin nicht dieser Gedanke.
Die buddhistische Sicht: Anatta – Kein Selbst
Und hier kommt der Knaller aus der buddhistischen Psychologie: die Lehre vom Nicht-Selbst (Anatta).
Was bedeutet das?
Ganz einfach gesagt: Es gibt kein festes, unveränderliches „Ich“, das da sitzt und denkt. Was wir „Ich“ nennen, ist ein Zusammenspiel aus Erfahrungen, Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühlen – ein ständiges Werden und Vergehen.
Das „Ich“ ist ein Prozess, kein statisches Ding.
Klingt spooky?
Ist es vielleicht am Anfang. Aber auch entlastend. Denn wenn es kein starres Ich gibt, muss ich mich auch nicht krampfhaft an bestimmte Gedanken klammern, die sagen: „So bin ich halt.“
Vielleicht bist du das gar nicht. Vielleicht ist das nur ein Gedanke. Eine alte Geschichte.
Gedanken wie Netflix behandeln
Hier eine meiner Lieblingsmetaphern:
Behandle deine Gedanken wie Netflix-Vorschläge.
Manchmal erscheint ein Gedanke – du klickst drauf, es läuft ein Drama.
Manchmal kommt ein Horrorfilm.
Manchmal eine billige Komödie mit innerem Fremdscham.
Und manchmal steht da: „Basierend auf deinen bisherigen Entscheidungen schlagen wir Folgendes vor…“
Du musst nicht alles anschauen.
Du darfst auch sagen: „Nicht interessiert.“
Oder: „Nicht nochmal vorschlagen.“
Du bist nicht verpflichtet, jeden inneren Film durchzustehen.
Gedanken still machen? Oder: Hilfe, ich kann nicht aufhören zu denken!
Viele Menschen scheitern an Meditation, weil sie glauben, sie müssten dabei nichts denken. Und sobald der erste Gedanke auftritt – „Was gibt’s später zu essen?“ oder „Warum piept mein Handy?“ – denken sie: Ich kann das nicht. Ich bin zu unruhig. Ich mach das falsch.
Aber das stimmt nicht.
Der Trick ist nicht, nicht zu denken. Der Trick ist, nicht auf jeden Gedanken aufzuspringen.
Stell dir deinen Geist wie einen Fluss vor. Die Gedanken sind Blätter auf dem Wasser. Du kannst ihnen zusehen, wie sie vorbeitreiben – ohne hinterherzuspringen.
Klingt poetisch?
Ist in der Praxis oft chaotisch.
Aber es geht. In kleinen Dosen. Und es verändert alles.
Übung: Gedanken beobachten statt glauben
Setz dich bequem hin.
Atme ein paar Mal tief durch.
Warte auf den ersten Gedanken. (Er kommt garantiert.)
Wenn er da ist, sag dir innerlich: „Ah, da ist ein Gedanke.“
Wiederhole das bei jedem weiteren. Nicht: „Ich bin gestresst“, sondern: „Ich denke gerade gestresste Gedanken.“
Das schafft Abstand. Du nimmst den Gedanken ernst – aber nicht persönlich.
Gedanken und soziale Phobie (oder: „Ich hab bestimmt alles falsch gemacht“)
Für viele Menschen mit sozialer Angst oder Unsicherheit sind Gedanken besonders gemein. Sie klingen wie innere Mobber.
„Du bist komisch.“„Alle merken, dass du unsicher bist.“„Du hättest das nicht sagen sollen.“
Das Problem ist nicht, dass du denkst – sondern dass du diesen Gedanken vertraust, weil sie sich so echt anfühlen.
Die buddhistische Psychologie sagt hier: Sieh hin. Erkenne sie. Und durchschau sie.
Ein Gedanke ist wie ein Verkäufer an der Tür: Er will dir was aufschwatzen. Du kannst höflich zuhören. Oder einfach nicht aufmachen.
Humor als Erkenntnisweg
Einer meiner Lieblingswege, mit meinem Gedankenchaos umzugehen, ist Humor. Wenn mein Gehirn mir wieder mal erzählt, dass ich bestimmt gleich auf offener Straße einen Fehler mache und dann öffentlich geächtet werde, versuche ich, das wie ein Drehbuch zu sehen.
Titel: „Die große Blamage – eine tragische Komödie in drei Akten.“
Hauptrolle: Ich.Ort: Die Bäckerei.Konflikt: Ich hab „Schrippe“ gesagt statt „Brötchen“.Publikum: Niemand.Kritik: Hirn übertreibt.
Lachen hilft. Es löst das Drama auf. Nicht, indem es das Gefühl kleinmacht – sondern indem es dem Gedanken die Bühne nimmt.
Fazit: Du bist mehr als dein Kopfkino
Dein Gehirn meint es nicht böse. Es will dich schützen. Es will planen, kontrollieren, erklären. Aber es ist nicht du. Es ist ein Werkzeug – und manchmal ein chaotischer Regisseur mit Hang zum Drama.
Die buddhistische Psychologie lädt dich ein, das zu erkennen. Und mitfühlend hinzusehen. Ohne Selbstoptimierungswahn. Ohne spirituellen Leistungsdruck. Sondern einfach mit dieser Haltung:
„Ach, das ist also mein Geist. Ganz schön kreativ, das Ding. Und jetzt atme ich weiter.“
Nächste Station: Vom Denken zum Fühlen
Mitgefühl für alle – außer für mich?
Warum wir oft die Letzten sind, die wir trösten – und wie buddhistische Psychologie uns hilft, mit uns selbst Frieden zu schließen.
Kapitel 3: Mitgefühl für alle
außer für mich?
"Sei freundlich. Sei verständnisvoll. Sei achtsam."
Für andere? Klar.
Für mich selbst? Uff. Schwierig.
Der innere Buddha ist sehr beschäftigt (mit anderen)
Du kennst das bestimmt:
Du siehst jemanden weinen – und willst trösten.
Jemand macht einen Fehler – und du findest verständnisvolle Worte.
Jemand zweifelt an sich – und du findest: „Aber du bist doch großartig!“
Und dann machst du selbst einen kleinen Fehler – und dein innerer Kritiker fährt hoch wie ein Chef im Kontrollzentrum: „Peinlich. Unfähig. Wie kannst du nur?!“
Mitgefühl ist oft das Erste, was wir anderen geben – und das Letzte, was wir uns selbst gönnen.
In der buddhistischen Psychologie ist Mitgefühl (Karuna) eine zentrale Qualität. Aber nicht nur nach außen – sondern auch nach innen. Und das klingt einfacher, als es ist. Denn: Selbstmitgefühl wird häufig verwechselt mit Selbstmitleid, Nachsicht, Schwäche oder (Gott bewahre!) Selbstverliebtheit.
Dabei ist es eigentlich das Fundament dafür, dass wir überhaupt durch dieses Leben navigieren können, ohne dauernd innerlich auseinanderzufallen.
Ich. Bin. Nicht. Nett. Zu. Mir.
Wenn ich ehrlich bin, habe ich einen ziemlich rauen Umgangston mit mir selbst. Da gibt’s keine aufmunternden Sprüche, sondern eher ein internes Coaching, das klingt wie eine genervte Sportlehrerin mit dem Charme eines kaputten Toasters.
Typische Sätze in meinem Kopf:
„Reiß dich zusammen.“
„Das ist doch kein Grund, traurig zu sein.“
„Andere haben es viel schlimmer.“
„Du musst dich einfach mehr anstrengen.“
Klingt vertraut?
Buddhistische Praxis würde dazu sagen: Autsch. Das tut weh. Warum tust du dir das an?
Die drei Komponenten von Selbstmitgefühl (nach Kristin Neff)
Moderne Psychologie hat diesen Aspekt aus der buddhistischen Lehre wissenschaftlich aufgegriffen. Die Psychologin Kristin Neff beschreibt Selbstmitgefühl als Zusammenspiel aus drei Dingen:
Achtsamkeit – also: überhaupt bemerken, dass du leidest.
Gemeinsame Menschlichkeit – also: anerkennen, dass Leiden zum Menschsein gehört.
Freundlichkeit mit sich selbst – also: dich selbst so behandeln, wie du einen Freund behandeln würdest.
Klingt nett.
Fühlt sich aber manchmal an wie ein Versuch, sich selbst zu umarmen, während man in einem Laubhaufen liegt, das Handy piept und die Steuererklärung ruft.
Warum wir oft so hart zu uns selbst sind
Die buddhistische Psychologie würde sagen: Unser innerer Kritiker ist ein Schutzmechanismus. Er will uns „optimieren“, damit wir dazugehören, keine Fehler machen, uns nicht schämen müssen. Dahinter steckt Angst – nicht Böswilligkeit.
Aber wenn dieser Kritiker die ganze Zeit das Mikro in der Hand hat, hört man irgendwann nichts anderes mehr.
Das Gegenteil ist oft der Fall. Menschen mit Selbstmitgefühl sind resilienter, gesünder, ehrlicher zu sich selbst – und weniger selbstverliebt.
Ja, du hast richtig gelesen.
Selbstkritik als spirituelles Hindernis
Die buddhistische Praxis sagt: Jeder Mensch trägt Buddha-Natur in sich – das Potenzial zur Klarheit, Mitgefühl und Erkenntnis.
Aber: Wenn du dich selbst ständig verurteilst, erkennst du diese Natur nicht. Du bist dann zu beschäftigt damit, dich zu optimieren, dich zu verstecken oder zu „verbessern“.
Dabei geht es gar nicht darum, perfekt zu werden – sondern echt zu werden. Und das geht nicht ohne Selbstfreundlichkeit.
Ein Zen-Spruch sagt:
„Du kannst das Gesicht Buddhas nicht sehen, wenn du dich selbst dauernd anklagst.“
Aber... wenn ich mir selbst vergebe, werde ich dann nicht faul?
Klassikerfrage.
Antwort aus der buddhistischen Praxis:
Selbstmitgefühl bedeutet nicht, sich alles durchgehen zu lassen. Es bedeutet, die Wahrheit zu sehen – und trotzdem sanft mit sich zu bleiben.
Wenn du einen Fehler machst, kannst du das anerkennen, ohne dich zu zerfleischen. Wenn du etwas nicht schaffst, kannst du dich trösten, statt dich zu beschimpfen. Wenn du dich schlecht fühlst, kannst du dich halten – nicht weiter runterziehen.
Das macht dich nicht passiv.
Das macht dich fähig.
Weil du dich dann nicht mehr vor dir selbst fürchten musst.
Vom inneren Kritiker zum inneren Freund
Stell dir vor, deine innere Stimme würde sich ändern. Nicht in ein überzuckertes „Alles ist supi, Liebling!“, sondern in ein mitfühlendes „Das war schwer. Ich verstehe dich. Ich bin da.“
Was würde das verändern?
Vielleicht würdest du dich trauen, neue Dinge auszuprobieren. Vielleicht würdest du dich nicht mehr schämen, wenn du Pausen brauchst. Vielleicht würdest du dich weniger verstecken.
Die buddhistische Psychologie lädt uns ein, diesen inneren Tonfall zu verändern – nicht durch Affirmationen à la „Ich bin ein wunderschöner Schmetterling im Glitzerregen“, sondern durch echtes Hinsehen und Halten.
Übung: Der innere Mitgefühlstest
Stell dir vor, eine enge Freundin kommt zu dir – traurig, verzweifelt, voller Selbstzweifel.
Was würdest du ihr sagen?
Wie würdest du sie anschauen?
Was würdest du auf keinen Fall sagen?
Jetzt stell dir vor, du selbst bist in der gleichen Lage.
Was sagst du dir in der Realität?
Vergleich das.
Erkennst du den Unterschied?
Und dann: Fang an, dich selbst wie diese Freundin zu behandeln. Nicht perfekt. Nur ein bisschen freundlicher als gestern.
Buddhistische Metta-Meditation: Freundlichkeit kultivieren
Die Metta-Meditation – auch bekannt als Liebende-Güte-Meditation – ist eine der ältesten und kraftvollsten Methoden, Mitgefühl zu üben.
Ablauf:
Beginne bei dir selbst. Sag dir innerlich:
„Möge ich glücklich sein.“
„Möge ich gesund sein.“
„Möge ich sicher sein.“
„Möge ich mit Leichtigkeit leben.“
Weite das auf andere aus:
Auf einen lieben Menschen
Auf einen neutralen Menschen
Auf jemanden, mit dem du Schwierigkeiten hast
Auf alle Wesen
Wichtig: Du musst nichts fühlen.
Es geht darum, diese Sätze zu senden – nicht darum, in spirituelle Ekstase zu verfallen.
Anfangs fühlt es sich vielleicht albern an. Oder künstlich. Aber mit der Zeit kann diese Praxis dein Herz weichmachen. Auch für dich selbst.
Selbstmitgefühl in chaotischen Momenten
Stell dir vor: Du hast einen schlechten Tag. Alles nervt. Du fühlst dich überfordert, missverstanden, müde. Früher hättest du dich dafür beschimpft.
Heute sagst du dir stattdessen:
„Okay, das ist gerade echt viel.“
„Ich darf müde sein.“
„Ich mach jetzt eine Pause.“
Keine Magie. Keine rosa Wolken.
Nur ein anderer Umgang.
Und der verändert alles.
Der Mitgefühlsmuskel will trainiert werden
Wie bei jedem Muskel gilt:
Einmal „freundlich denken“ reicht nicht.
Selbstmitgefühl ist eine Praxis.
Manchmal klappt sie. Manchmal nicht.
Es gibt Tage, da kannst du dich umarmen.
Und es gibt Tage, da willst du dich am liebsten entfreunden.
Beides ist okay.
Wichtig ist, dranzubleiben.
Für neurodiverse, hochsensible, stillere Menschen
Wenn du ein besonders empfindsames Nervensystem hast, kennst du das vielleicht:
Du nimmst viel wahr. Du willst alles richtig machen. Du bist hart zu dir, weil du das Chaos im Außen irgendwie kompensieren willst.
Gerade dann ist Selbstmitgefühl keine Schwäche, sondern Überlebensstrategie.
Denn in einer lauten Welt brauchst du einen Ort, an dem du weich sein darfst. Und dieser Ort beginnt in dir.
Mini-Selbstmitgefühl-to-go
Hier ein paar kleine Erste-Hilfe-Sätze, wenn dein Kopf wieder austickt:
„Ich kämpfe gerade. Das ist menschlich.“
„Ich darf Fehler machen. Alle dürfen das.“
„Es ist okay, traurig zu sein.“
„Ich bin für mich da – auch wenn ich’s nicht perfekt hinkriege.“
Such dir einen davon aus. Oder erfinde deinen eigenen. Und dann: Wiederholen. Still. Im Kopf. Oder laut. Oder auf dem Klo. Hauptsache: Du bist dabei nett zu dir.
Fazit: Du bist auch ein Wesen, das Mitgefühl verdient
Buddhistische Psychologie lehrt: Mitgefühl ist grenzenlos. Es kennt keine Bedingungen. Es sagt nicht: „Nur wenn du alles richtig machst, darfst du dich mögen.“
Es sagt:
„Gerade weil du leidest, darfst du dich halten.“
Und das ist vielleicht die revolutionärste Erkenntnis überhaupt.
Nicht Erleuchtung ist das Ziel.
Sondern: Ein weiches Herz inmitten eines manchmal harten Lebens.
Und ja – auch wenn du noch Wäsche hast.
Nächste Station: Der Körper weiß Bescheid
Geist und Körper – das uralte Duo.
Warum buddhistische Praxis nicht nur im Kopf stattfindet – und wie wir lernen, wieder in uns hineinzuspüren, statt nur über uns nachzudenken.
Kapitel 4: Der Körper weiß Bescheid
auch wenn der Kopf anderer Meinung ist
"Ich denke, also bin ich."
Und mein Körper denkt sich: „Schön für dich. Ich fühl aber auch noch was.“
Willkommen im Oberstübchen
Lange Zeit dachte ich, Spiritualität sei etwas für den Kopf. Fürs Denken, Verstehen, Reflektieren. Ich hatte das Bild von meditierenden Menschen vor Augen, die mit geschlossenen Augen auf Kissen sitzen und große Einsichten haben. Körper? Pfff. Reine Sitzgelegenheit.
Ich habe Bücher studiert, Podcasts gehört, philosophische Fragen gewälzt. Aber was ich dabei konsequent ignoriert habe: Meinen Körper.
Er war einfach... dabei. Hat mitgemacht. Meistens stillgehalten. Manchmal gemurrt. Und irgendwann: hat er mich schlicht überstimmt.
Denn: Buddhistische Psychologie beginnt nicht nur im Geist – sie beginnt im Erleben. Und das findet, Überraschung, im Körper statt.
Vom Denken ins Spüren: ein radikaler Wechsel
Wenn du eher zu den reflektierenden, vieldenkenden, sensiblen Menschen gehörst (Willkommen im Club!), bist du wahrscheinlich sehr gut darin, Dinge zu analysieren:
Warum du dich so fühlst.
Welche Kindheitsmuster da getriggert wurden.
Was das mit deiner letzten Beziehung zu tun haben könnte.
Und was du eigentlich fühlen solltest.
Das ist alles spannend.
Aber oft auch ein Umweg.
Denn der Körper ist viel schneller. Er zeigt dir deine Wahrheit oft, bevor du sie verstehst:
Die Frage ist: Hörst du hin?
Der Körper lügt nicht – aber er spricht undeutlich
Ein Problem: Wir sind so daran gewöhnt, mit dem Kopf zu funktionieren, dass wir den Körper gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Oder wir interpretieren ihn sofort:
„Mein Herz rast – ich hab bestimmt was mit dem Kreislauf.“
„Ich bin müde – ich brauch mehr Koffein.“
„Ich fühl mich unwohl – schnell ablenken.“
Was buddhistische Praxis uns anbietet, ist eine Rückkehr zur unmittelbaren Erfahrung. Das heißt: nicht nur zu denken, dass man traurig ist – sondern zu fühlen, wie sich Traurigkeit anfühlt.
Das klingt erst mal einfach.
Ist aber tatsächlich so intim, dass viele von uns lieber wieder zurück in den Kopf flüchten.
Achtsamkeit ist körperlich – nicht theoretisch
Jon Kabat-Zinn, ein Schüler der buddhistischen Lehren und Entwickler des MBSR-Programms (Mindfulness-Based Stress Reduction), sagt:
„Achtsamkeit ist das Bewusstsein, das entsteht, wenn wir aufmerksam sind – im gegenwärtigen Moment, ohne zu urteilen.“
Und wo findet der gegenwärtige Moment statt?
Nicht in der To-do-Liste von morgen. Nicht in der Analyse von gestern. Sondern genau: im Körper.
Wenn du atmest, deinen Bauch hebst und senkst, die Füße spürst, wie sie auf dem Boden stehen – dann bist du da. Nicht als Theorie, sondern als fühlendes Wesen im Hier und Jetzt.
Das Gedankenkarussell durchbrechen: über die Sinneskanäle
Wenn dein Kopf sich dreht wie ein schlecht geöltes Karussell auf dem Rummelplatz, hilft kein „Denk doch einfach nicht so viel“. (Haha. Sehr witzig.)
Was hilft: Den Fokus umlenken. Und zwar nach unten. Nach innen. Ins Spüren.
Drei einfache Wege:
Atmung spüren: Nicht verändern, nur beobachten. Wie fühlt sich der Atem in der Nase an? Wie bewegt sich der Brustkorb?
Körperkontakt wahrnehmen: Wo berühren deine Hände deine Beine? Wie fühlt sich der Boden unter den Füßen an?
Klang oder Geräusch wahrnehmen: Nicht interpretieren. Nur: hören.
Das klingt unspektakulär.
Aber wenn du’s machst, wirst du merken: Es bringt dich raus aus dem Kopf – rein in den Moment.
Körpergedächtnis: Warum du auf Reize reagierst, bevor du sie verstehst
Der Körper speichert Erfahrungen. Auch die, die wir nicht „verstanden“ haben. Deshalb reicht kognitives Verstehen oft nicht aus.
Beispiel:
Du betrittst einen Raum und spürst plötzlich Unruhe – obwohl objektiv alles okay ist.
Dein Körper erinnert sich vielleicht an ein ähnliches Setting, in dem du dich mal unwohl gefühlt hast. Er schickt ein Signal – du fühlst Stress, obwohl du keinen „Grund“ findest.
Das ist kein Defekt. Das ist intelligente Schutzfunktion.
Buddhistische Praxis würde sagen:
„Nimm es wahr – aber identifiziere dich nicht damit.“
Oder: Spür es. Erkenn es. Aber werde nicht das Gefühl selbst.
Der Körper als Kompass – auch für spirituelle Praxis
Viele Menschen suchen nach spirituellen Erlebnissen: Licht, Erkenntnis, Frieden, Transzendenz. Klingt super.
Aber manchmal sitzt die Erleuchtung eher im unteren Rücken – und nennt sich „Ah, ich atme durch“.
Oder in der Kehle – und heißt „Ich kann endlich sagen, was ich fühle“.
Oder in den Füßen – wenn du wirklich mit beiden Beinen im Leben stehst.
In der buddhistischen Psychologie gilt: Der Körper ist nicht das Hindernis. Er ist das Tor.
Warum spirituelle Praxis ohne Körper leicht zur Flucht wird
Ein bisschen Selbstoffenbarung gefällig?
Ich habe mich in meiner Anfangszeit gern in „höhere Ebenen“ geflüchtet. Lesen, denken, philosophieren. Alles, nur nicht fühlen.
Ich konnte über Anhaftung reden – ohne zu merken, dass ich gerade verzweifelt an einem Idealbild von mir selbst festhielt.
Der Körper aber lügt nicht. Er ist der ehrliche Freund, der sagt:
„Du kannst dir das schönreden. Aber ich spüre gerade Angst. Oder Traurigkeit. Oder Hunger. Oder alles zusammen.“
Wenn du den Körper ausklammerst, wird Spiritualität schnell abgespalten. Dann redest du vom Hier und Jetzt – während du innerlich drei Kilometer entfernt bist.
Kleine Übungen für große Wirkung
Bodyscan (Körperreise):
Lege dich hin oder setze dich bequem. Wandere mit der Aufmerksamkeit durch deinen Körper – von den Füßen bis zum Kopf. Ohne zu bewerten. Nur spüren.
Frage dich: „Was ist jetzt da?“
Mini-Check-in:
Stell dir drei Fragen:
Was nehme ich körperlich wahr?
Was fühle ich emotional?
Was denke ich gerade?
Mach das einmal täglich. Zwei Minuten reichen. Du wirst überrascht sein, wie oft du gar nicht gemerkt hast, was eigentlich los ist.
Bewegungsachtsamkeit:
Spazieren. Strecken. Tanzen. Und dabei spüren: Wie fühlt sich das an?
Nicht als Workout. Sondern als Kontaktaufnahme mit deinem Körper.
Der Körper als Zuhause – nicht nur als Baustelle
Viele von uns sehen den Körper vor allem als „Problemzone“. Zu dick, zu dünn, zu müde, zu sensibel, zu irgendwas.
Aber was wäre, wenn dein Körper kein Projekt ist – sondern dein Zuhause?
Was, wenn du ihm dankbar sein dürftest? Fürs Durchhalten. Fürs Fühlen. Fürs Tragen durch dieses Leben?
Buddhistische Praxis heißt auch: Den Körper achten. Nicht für sein Aussehen – sondern für sein Dasein.
Und was hat das jetzt mit Erleuchtung zu tun?
Alles.
Denn Erleuchtung heißt im Buddhismus nicht: schwerelos über Wiesen schweben und dabei Lotosblüten verteilen.
Erleuchtung heißt: voll da sein. Mit allem. Auch mit Rückenschmerzen, Müdigkeit, Zittern, Herzklopfen.
Wenn du den Körper einbeziehst, wird Praxis geerdet. Echt. Spürbar. Und manchmal überraschend heilsam.
Denn plötzlich ist da nicht nur ein Gedanke: „Ich darf sein.“
Sondern auch ein Körpergefühl dazu: Wärme. Weite. Stille.
Für sensible Körper (wie deinen und meinen)
Neurodiverse Menschen, hochsensible Menschen, Menschen mit einem „fein getunten Nervensystem“ – sie nehmen oft mehr wahr. Intensiver. Schneller. Reizbarer.
Das ist nicht falsch. Es ist anders. Und es braucht: achtsamen Umgang.
Dich überfordern? Kein Zeichen von Schwäche.
Dich zurückziehen? Kein Rückschritt.
Dich selbst spüren? Ein mutiger Akt in einer Welt, die Ablenkung belohnt.
Gerade für feinfühlige Menschen ist der Körper nicht nur Mitreisender – sondern oft auch Leitplanke. Wenn du ihn beachtest, findest du Wege, die dir gut tun.
Fazit: Komm zurück. In deinen Körper. In den Moment. In dich.
Du brauchst keine komplizierten Techniken.
Du brauchst keine besonderen Voraussetzungen.
Du brauchst nur die Bereitschaft, wieder zu spüren, was ohnehin da ist.
Der Körper ist keine Nebensache. Er ist der Ort, an dem Leben passiert.
Auch dein spirituelles.
Manchmal bedeutet Praxis nicht mehr als:
Atmen.
Spüren.
Nicht weggehen.
Und genau darin liegt die leise, ehrliche Magie.
Nächste Station: Der Tanz mit dem Gedankenaffen
Dein Kopf hüpft von Idee zu Idee wie ein hyperaktiver Affe auf Espresso? Willkommen bei den Gedankenaffen! Kapitel 5 zeigt dir, wie du mit deinem Verstand umgehen kannst – ohne ihn zu bekämpfen oder zu unterdrücken.
Kapitel 5: Der Tanz mit dem Gedankenaffen
Wie du deinem Verstand nicht auf den Leim gehst
„Ich wollte meditieren, aber mein Hirn hatte andere Pläne.“
Willkommen im Club. Der Eintritt ist frei, aber raus kommst du so schnell nicht.
Gedankenaffen und andere wilde Kreaturen
Stell dir Folgendes vor: Du willst endlich mal runterkommen. Meditieren. Achtsam sein. Im Moment ankommen.
Und dein Kopf? Fängt an, sich aufzuführen wie ein überdrehter Affe mit Espresso-Intoleranz. Er springt von Ast zu Ast:
„Hab ich die Waschmaschine angemacht?“
„Was meinte Sandra gestern eigentlich mit diesem komischen Tonfall?“
„Ich muss noch Katzenfutter kaufen.“
„Ich hab Hunger. Vielleicht hab ich auch nur Durst? Aber eigentlich auch keine Lust auf Wasser. Gibt’s noch Cola Light?“
Willkommen im Gedankenkarussell. Oder besser gesagt: im Gedanken-Dschungel. Und mittendrin: der Gedankenaffe – dein überaus kreatives, meinungsstarkes und oft ziemlich dramatisches Gehirn.
Warum dein Kopf macht, was er will
In der buddhistischen Psychologie wird der „Monkey Mind“ schon seit Jahrhunderten beschrieben. Der Begriff kommt aus alten Pali-Texten und bezeichnet das unruhige, sprunghafte, sich ständig bewegende Bewusstsein.
Das Gehirn sucht nach:
Gefahr (überlebenswichtig!)
Zucker (auch überlebenswichtig – sagt es zumindest)
Drama (damit es nicht einschläft)
Die schlechte Nachricht: Dein Gehirn ist nicht auf Frieden gepolt.
Die gute Nachricht: Du bist nicht dein Gehirn.
Gedanken sind nicht die Wahrheit. Nur Vorschläge.
Einer der wichtigsten Sätze, die ich je gehört habe – und der mich regelmäßig rettet, wenn mein innerer Affe wieder durchdreht:
„Du musst nicht alles glauben, was du denkst.“
Das klingt simpel. Ist aber radikal.
Denn Gedanken wirken oft wie Fakten. Wenn da steht:
„Ich bin nicht gut genug.“
„Die anderen denken bestimmt…“
„Ich krieg das nie hin.“
… dann fühlen wir uns, als wäre das in Stein gemeißelt. Dabei ist es: nur ein Gedanke. Kein Gesetz. Kein Urteil. Kein kosmisches Orakel.
Einfach nur: Elektrische Impulse. Alte Muster. Geschichten, die unser Gehirn erzählt – weil es das gelernt hat.
Der innere Kommentator – eine endlose Tonspur
Vielleicht kennst du das: Du gehst spazieren – und dein Kopf kommentiert alles:
„Oh, hübsche Blume.“
„Da hätte ich auch langgehen können.“
„Warum guckt der Typ so komisch?“
„Was mach ich eigentlich mit meinem Leben?“
Das Gehirn kann nicht anders. Es erzählt. Bewertet. Vergleicht. Rechnet.Es ist wie ein Nachrichtensprecher ohne Pause – nur dass die Nachrichten meist überzogen, schlecht recherchiert und leicht dramatisch sind.
Buddhistische Praxis sagt:
„Lass ihn reden. Du musst nur nicht mitspielen.“
Der Trick: Beobachten statt Einsteigen
Stell dir deine Gedanken vor wie Wolken am Himmel. Oder wie Autos auf einer Straße. Oder wie Werbung auf Instagram: ständig präsent, aber nicht zwingend relevant.
Du kannst:
Sie bemerken.
Sie durchziehen lassen.
Und nicht in jedes Auto einsteigen.
Das ist Meditation: Nicht, die Gedanken abzuschalten (geht eh nicht), sondern sie nicht mehr ernst zu nehmen.
Das erste Mal, als ich das wirklich verstanden hab, saß ich auf meinem Meditationskissen, völlig genervt von meinem inneren Affen. Und dann kam der Gedanke:
„Was, wenn ich ihm einfach beim Zappeln zuschaue – statt ihn zu bändigen?“
Seitdem übe ich mich im Zuschauen statt Zensieren.
Was passiert, wenn du deine Gedanken nicht steuerst
Kurz gesagt: das Übliche.
Du gehst im Kopf durch 37 hypothetische Szenarien, während du eigentlich einen Tee machen wolltest.
Du liegst nachts wach und denkst an ein Gespräch von 2011.
Du planst Gespräche, die nie stattfinden – mit Menschen, die ganz anders reagieren werden, als du es dir gerade vorstellst.
Das Problem ist nicht, dass du denkst.
Das Problem ist, dass du denkst, du bist das.
Der Verstand als Werkzeug – nicht als Chef
Stell dir deinen Verstand wie ein Schweizer Taschenmesser vor. Super praktisch. Aber du würdest auch nicht versuchen, damit eine Beziehung zu führen, deine Ängste zu regulieren oder spirituelle Erleuchtung zu erreichen.
Der Verstand:
Kann planen, rechnen, analysieren.
Kann nicht fühlen, vertrauen oder präsent sein.
Er ist also ein Werkzeug – kein Anführer.
Und trotzdem lassen wir ihn oft ans Steuer. Kein Wunder, dass wir dann im Graben landen.
Was tun mit einem überaktiven Kopf?
Benennen, was ist:
Wenn du mitten in einer Gedankenschleife steckst, sag innerlich:
„Aha. Grübeln. Danke, Verstand.“
Allein das Benennen schafft Distanz.
Humor einbauen:
Wenn der Affe wieder wild wird, nenn ihn beim Namen:
„Ah, Kevin hat wieder Bühnenzeit.“
(Du darfst ihm auch einen anderen Namen geben. Aber Kevin passt erstaunlich oft.)
Zurück zum Körper:
Siehe Kapitel 4 – der Körper lügt nicht. Atmen. Füße spüren. Schultern entspannen. Und zack – bist du wieder da.
Gedankenlosigkeit ist kein Ziel – Präsenz schon
Viele glauben, Meditation bedeute, keine Gedanken mehr zu haben. Das ist ungefähr so realistisch wie „Nie wieder Wäsche waschen müssen“.
Gedanken kommen. Immer.
Die Frage ist: Wie gehst du damit um?
Achtsamkeit bedeutet: Gedanken dürfen da sein. Aber sie dürfen auch wieder gehen.
Du hältst sie nicht fest. Du läufst ihnen nicht hinterher. Du sagst:
„Hallo. Schön, dass du da bist. Tschüss auch.“
Der innere Kritiker – der lauteste Affe von allen
Er sitzt gern auf deiner Schulter und kommentiert:
„Das war jetzt aber nicht sehr achtsam.“
„Alle anderen kriegen das besser hin.“
„Du bist halt zu empfindlich.“
„Wenn du erleuchtet wärst, würdest du das jetzt nicht fühlen.“
Herzlichen Glückwunsch: Das ist kein spiritueller Lehrer. Das ist dein Ego im Tarnanzug.
Und der Buddhismus sagt dazu: Erkenne ihn. Durchschaue ihn. Und dann: lächle milde.
Metapherzeit: Der wilde Affe im Teehaus
Stell dir vor, du sitzt in einem Teehaus. Ruhig, schön, sanft beleuchtet.
Und plötzlich stürmt ein Affe rein, fegt über die Tische, schmeißt Kissen um, trinkt deinen Tee.
Was machst du?
Schreist du ihn an?
Versuchst du ihn mit Gewalt rauszuwerfen?
Ignorierst du ihn komplett?
Oder: Du setzt dich ruhig hin, nimmst einen tiefen Atemzug, und wartest, bis er müde wird.
Du bietest ihm vielleicht sogar einen Keks an. Sagst:
„Setz dich, Kleiner. Ich seh dich. Aber ich trink jetzt meinen Tee.“
Das ist Praxis.
Übung: Die Gedanken-Rückspultaste
Einmal täglich (am besten abends) setz dich für fünf Minuten hin und frag dich:
Welche Gedanken haben mich heute besonders beschäftigt?
Waren sie hilfreich?
Waren sie wahr?
Und vor allem: Waren sie nötig?
Wenn nicht: Weg damit.
Oder wie Marie Kondo sagen würde:
„Danke für deinen Beitrag. Du darfst gehen.“
Für neurodiverse Gehirne: Wenn der Affe ADHS hat
Noch ein Wort an alle mit ADHS, Autismus oder Hochsensibilität:
Euer Gedankenaffe ist nicht nur hyperaktiv – er jongliert auch mit Neon-Bällen, während er Podcasts hört und gleichzeitig ein Drama aus 2004 nachinszeniert.
Das ist kein Fehler. Das ist: intensiv. Vielschichtig. Kreativ.
Buddhistische Praxis muss für euch vielleicht anders aussehen.
Kürzere Meditationen.
Mehr Bewegung.
Achtsamkeit im Tun statt im Sitzen.
Kein Dogma. Nur: Kontakt zu euch selbst.
Fazit: Dein Kopf darf bleiben. Aber er muss nicht Chef sein.
Dein Verstand ist genial.
Er hilft dir, dieses Buch zu lesen, Termine zu koordinieren, Texte zu schreiben, Lösungen zu finden.
Aber wenn es um Anwesenheit, Gefühl, Frieden geht – dann darf er sich auch mal zurücklehnen.
Die Gedanken kommen.
Die Gedanken gehen.
Und du?
Du bleibst.
In der Stille.
Im Atem.
Im Sein.
Mit einem kleinen inneren Affen, der ab und zu auf den Tisch springt – aber mittlerweile weiß: Du gibst ihm keinen Zucker mehr.
Nächste Station: Gefühl ist nicht gleich Drama
Im nächsten Kapitel schauen wir uns die nächste Station auf dem Weg zu mehr Klarheit an: Emotionen. Warum sie nicht dein Feind sind. Warum du sie nicht kontrollieren musst. Und wie du sie reiten kannst, ohne dabei unterzugehen. Taschentücher erlaubt, Drama nicht zwingend.
Kapitel 6: Gefühle sind wie Wetter
Du musst nicht jedes mitspielen
„Ich fühl mich wie ein nasser Waschlappen.“
Schön! Das heißt, du fühlst. Willkommen in der Champions League der Menschlichkeit.
Emotionen: Zwischen Hochwasser und Hitzefrei
Da sitzen wir also. Auf unserem Meditationskissen, umgeben von Räucherstäbchen, guter Absicht – und dann BAMM: Gefühl.
Und nicht irgendeins. Nein. Sondern so ein richtig saftiges.
Wut wie ein platzender Dampfkochtopf.
Traurigkeit mit Schleimspur.
Angst mit Apokalypse-Geschmack.
Freude, aber so überdreht, dass wir uns danach hinlegen müssen.
Der erste Impuls? Weg damit. Kontrollieren. Runterschlucken. Wegrationalisieren.
Oder – die Deluxe-Variante – spiritualisieren:
„Ich beobachte dieses Gefühl. Es ist nicht ich. Ich lasse es ziehen.“
Schnitt: Heulend im Badezimmer.
Buddhistisch betrachtet: Gefühl ≠ Problem
Die buddhistische Psychologie ist – Überraschung – erstaunlich entspannt, wenn es um Gefühle geht.
Denn: Gefühle sind kein Fehler, sondern Teil des Pakets.
Du bist Mensch? Dann hast du Gefühle.
Sie gehören dazu wie der Putzlappen zum Haushalt – vielleicht nicht glamourös, aber unverzichtbar.
Was sind Gefühle eigentlich?
Gefühle sind:
Körperliche Reaktionen auf innere oder äußere Reize.
Kurzlebige Zustände mit viel Energie.
Ein Mix aus Denken, Fühlen und Spüren.
Oder auf gut Deutsch:
Emotionen sind der Wetterbericht deiner Seele. Sie zeigen dir, wie’s gerade aussieht – nicht, wie’s für immer bleibt.
Wenn du also denkst:
„Ich bin traurig.“
Dann ergänze:
„Ich erlebe gerade Traurigkeit.“
Denn das bist nicht du. Das ist ein Durchgangsgast.
Klassischer Fehler in spirituellen oder achtsamen Kreisen:
Wir wollen Gefühle nicht mehr fühlen. Wir wollen sie analysieren, kontrollieren, loswerden, transformieren – und am besten alles gleichzeitig.
„Ich hab Angst – was sagt das über meine Kindheit?“
„Ich bin traurig – ich hab bestimmt schlecht geschlafen.“
„Ich bin wütend – das ist unspirituell, ich muss verzeihen!“
Stopp.
Gefühle sind keine Feinde.
Sie sind Wellen.
Und du bist nicht das Meer – sondern der Surfer.
Gefühl ≠ Actionbefehl
Nur weil du was fühlst, musst du nicht drauf reagieren.
Beispiel:
Du fühlst Wut.
Das heißt nicht, dass du sofort schreiben musst: „Du bist ein manipulativer Dackel, Kevin.“
Du fühlst Traurigkeit.
Das heißt nicht, dass dein Leben im Eimer ist.
Du fühlst Freude.
Das heißt nicht, dass du jetzt allen erklären musst, wie sie „positiv denken“ sollen.
Gefühle sind wie Besuch: Sie dürfen kommen, bleiben eine Weile – und gehen wieder.
Der buddhistische Umgang mit Gefühlen: Raum geben statt Drama machen
Die klassische Formel:
Annehmen – Erforschen – Loslassen
Annehmen:Ja, da ist Wut. Oder Angst. Oder Scham.
Du sagst: „Aha, hallo Gefühl. Ich seh dich.“
Erforschen:Wo fühl ich das im Körper?
Was erzählt mir das Gefühl gerade?
Was passiert, wenn ich es einfach da sein lasse?
Loslassen:Nicht im Sinne von „Weg damit“, sondern: weiterziehen lassen.
So wie du eine Wolke nicht festhältst.
Die Körperspur: Gefühle wohnen im Gewebe
Der Verstand will verstehen. Das Gefühl will gefühlt werden.
Klingt banal, ist aber zentral.
Denn viele von uns denken ihre Gefühle lieber – statt sie zu erleben.
„Ich weiß, dass ich wütend bin, weil ich diesen Trigger erkannt habe.“
Cool. Und jetzt fühl’s.
„Ich bin traurig, aber ich hab verstanden, dass das an meinem Bindungsmuster liegt.“
Super. Und jetzt heul.
Gefühle wollen durch dich durch. Nicht nur analysiert, sondern erlebt.
Wenn du sie spürst, lösen sie sich oft schneller auf, als wenn du sie kontrollieren willst.
Aber was, wenn ich dann untergehe?
Diese Angst kennen viele:
„Wenn ich das Gefühl zulasse, hört es nie mehr auf.“„Wenn ich traurig bin, werd ich nie wieder froh.“„Wenn ich wütend bin, explodiere ich und bin dann eine schlechte Person.“
Fakt: Gefühle wollen gesehen werden – nicht dein Leben übernehmen.
Je mehr du sie wegdrückst, desto mehr Energie verbrauchen sie im Hintergrund.
Wie ein Handy mit 17 offenen Apps.
Lässt du sie da sein, reguliert sich dein System oft von allein.
Wichtiger Unterschied: Reaktion vs. Regulation
Viele verwechseln emotionales Erleben mit Reaktivität.
Wut fühlen ≠ rumschreien.
Traurigkeit fühlen ≠ sich im Selbstmitleid suhlen.
Angst fühlen ≠ panisch handeln.
Du darfst alles fühlen.
Und du musst nicht alles tun, was dein Gefühl dir vorschlägt.
Das nennt sich: Emotionale Reife.
Und ja – sie kommt meistens durch Übung, nicht durch Bücher. Leider.
Gefühlskompetenz für Fortgeschrittene
Ein kleiner Mini-Leitfaden:
Was fühle ich gerade – ohne Bewertung?
(Nicht: „Das ist blöd, ich sollte nicht so sein“)
Wo im Körper sitzt das?
Was will dieses Gefühl?
(Zugehört werden? Schutz? Ausdruck?)
Was braucht mein System gerade?
(Atmen? Ruhe? Bewegung? Schokolade?)
Was tue ich – bewusst, freundlich, präsent?
Der Mythos vom „höheren Selbst“ ohne Gefühle
In vielen spirituellen Kreisen kursiert die Idee, dass wir irgendwann über den Gefühlen stehen sollten.
So was wie:
„Ich bin nicht wütend – ich bin im Frieden.“
„Ich bin nicht traurig – ich bin verbunden mit allem.“
„Ich bin nicht enttäuscht – ich vertraue dem Universum.“
Klingt schön. Ist aber oft: Verdrängung in Glitzerfolie.
Der Dalai Lama sagt:
„Gefühle sind wie ein Kompass. Sie zeigen uns, was wichtig ist.“
Und der Dalai Lama sagt nicht:
„Halt’s Maul, du Dramaqueen.“
Sondern eher:
„Lächle dem Gefühl zu. Dann wird’s weich.“
Für die Neurodiversen unter uns: Gefühlsoverload Deluxe
Wenn du hochsensibel, neurodivergent oder einfach ein sehr tief fühlender Mensch bist, gilt:
Deine Gefühle sind nicht übertrieben.
Du bist nicht zu viel.
Du brauchst nur mehr Raum, mehr Zeit, mehr Regulierung.
Das heißt:
Längere Pausen.
Bewegung, um Gefühle zu kanalisieren.
Sensorische Regulation (Decken, Düfte, Musik).
Und: Menschen, die deine Tiefe nicht für ein Problem halten.
Praktische Übung: Das Fühl-Protokoll
Nimm dir 10 Minuten Zeit.
Was fühle ich JETZT gerade?
Nicht was ich denken sollte, sondern was ist.
Wo spüre ich das im Körper?
Kann ich es 1 Minute lang einfach da sein lassen – ohne Flucht, ohne Drama?
Was verändert sich, wenn ich es nicht wegmache?
Mach das drei Tage hintereinander. Du wirst merken: Gefühle sind wie Gäste – manche laut, manche leise. Aber fast alle gehen freiwillig, wenn du ihnen einen Tee anbietest.
Fazit: Gefühle machen dich nicht schwach. Sie machen dich echt.
Gefühle sind die Farbe deines Innenlebens.
Sie sind unordentlich, überraschend, wild – und manchmal unfassbar schön.
Wer fühlt, lebt.
Wer alles fühlen darf, kann alles halten.
Und wer sich selbst halten kann, muss niemanden mehr retten.
Du darfst:
Wütend sein – ohne laut zu werden.
Traurig sein – ohne zu zerbrechen.
Glücklich sein – ohne schlechtes Gewissen.
Gefühle sind: lebendig.
Und du bist es auch.
Ausblick Kapitel 7: Ego – Der innere Gockel im Räucherstäbchen
Im nächsten Kapitel gehen wir dem hartnäckigsten aller Ich-Anteile auf den Grund: dem Ego. Warum es laut ist, sich gern verkleidet und immer mitreden will. Und wie du ihm mit einer Mischung aus Milde, Klarheit und innerem Schmunzeln begegnen kannst.
Kapitel 7: Das Ego
Der innere Gockel im Räucherstäbchen
„Ich will mein Ego loswerden.“
– Sagte das Ego und buchte einen Achtsamkeits-Retreat.
Wer oder was ist eigentlich das Ego?
Stell dir das Ego vor wie einen sehr lauten WG-Mitbewohner.
Redet unaufgefordert.
Kommentiert alles.
Ist überzeugt, immer recht zu haben.
Und hat die emotionale Reife einer Tupperdose.
Im Buddhismus wird das Ego nicht als „Feind“ gesehen, sondern als Illusion:eine Sammlung aus Vorstellungen, Geschichten, Abgrenzungen und Mustern, die behaupten:
„Ich bin. Und zwar ganz genau so. Und wehe, jemand widerspricht.“
Ego ist nicht böse. Es ist nur… überengagiert.
Das Ego will eigentlich nur eins: Dich schützen.
Vor Verletzung.
Vor Bedeutungsverlust.
Vor dem Chaos des Daseins.
Es denkt: Wenn ich alles kontrolliere, erkläre, analysiere, vergleiche, plane – dann bin ich sicher.
Blöd nur: Genau dieser Kontrollfilm macht uns oft unglücklich.
Denn das Ego liebt:
Drama
Vergleiche
Recht haben
Gewinnen
Gemocht werden (aber bitte ohne Schwäche)
Kontrolle (aber ohne Aufwand)
Ego im Alltag: Die Greatest Hits
Du erkennst dein Ego an folgenden inneren Sätzen:
„Was denken die jetzt über mich?“
„Warum kriegt der mehr Applaus als ich?!“
„Ich hab das verdient – wieso krieg ich’s nicht?!“
„Das kann ich besser!“
„Ich sollte weiter sein.“
Auch gut: das spirituelle Ego.
Das trägt Yogahose, sagt „Namasté“ – und verurteilt alle, die noch Fleisch essen oder nicht meditieren.
Das Ego sagt gern: „Ich bin weiter als du.“
Das Herz sagt: „Wir sind auf dem Weg.“
Ego vs. Selbst: Ein kurzer Deep Dive
In der buddhistischen Psychologie unterscheiden wir:
Das Ego (persönliches Ich, Ich-Konstruktion)
Das Selbst (tiefer Wesenskern, das „bewusste Gewahrsein“)
Das Ego denkt: Ich BIN diese Meinung, diese Angst, dieses Drama.
Das Selbst weiß: Ich BIN – aber das, was kommt und geht, bin ich nicht.
Ein bisschen wie beim Wetter:
Ego: „Oh mein Gott, es regnet – ich bin das Opfer!“
Selbst: „Ah, da ist Regen. Ich bleib trocken im Innern.“
Das Selbst ist der Himmel.
Das Ego sind die Wolken, die denken, sie hätten das Sagen.
Wie das Ego sich verkleidet
Das Ego ist wie ein Kind im Faschingsrausch. Es liebt Kostüme:
Das Opfer-Ego
„Immer ich!“Gönnt sich Dauer-Selbstmitleid.Verwechslung von Schmerz mit Identität.
Das Retter-Ego
„Ich helfe allen – dann bin ich wertvoll!“Gibt, bis der Akku leer ist – und beschwert sich dann.