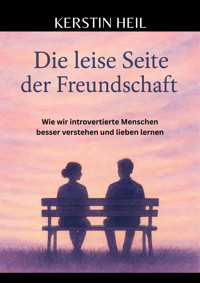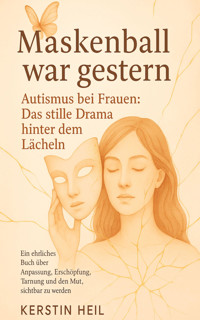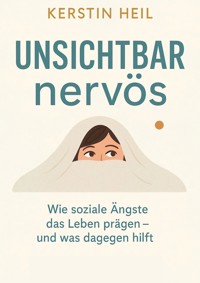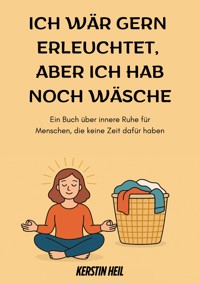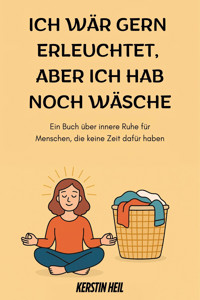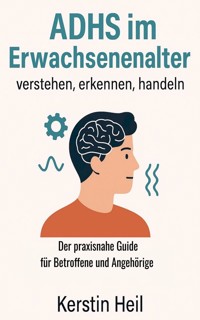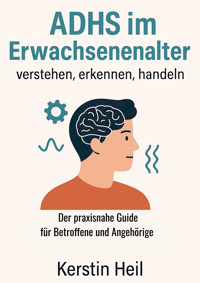
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Unkonzentriert, chaotisch, reizoffen – oder einfach neurodivers? ADHS bei Erwachsenen wird häufig übersehen, unterschätzt und missverstanden. Dieses Buch räumt auf mit Vorurteilen und gibt einen alltagstauglichen Überblick über die vielfältigen Facetten von ADHS. Kerstin Heil vermittelt fundiertes Wissen über Ursachen, Diagnose, Symptome und Begleiterkrankungen – ergänzt durch konkrete Tipps für Alltag, Beruf, Beziehungen und Selbstwert. Der praxisnahe Ratgeber bietet Checklisten, Tools, Selbsthilfestrategien sowie ein Glossar, Literaturtipps und Anlaufstellen. Ein Buch für alle, die ADHS verstehen wollen – mit Herz, Verstand und einem klaren Blick auf das echte Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Einleitung: Warum dieses Buch nötig ist
ADHS. Drei Buchstaben, die viele noch immer automatisch mit zappeligen Grundschulkindern verbinden, die den Unterricht stören und ihre Hausaufgaben vergessen. Was dabei oft übersehen wird: Die „Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung“ ist keine Kinderkrankheit. Sie wächst sich nicht einfach aus. Sie bleibt – auch im Erwachsenenalter. Sie verändert sich, sie tarnt sich, sie wird oft nicht erkannt. Aber sie bleibt.
Tatsächlich ist ADHS bei Erwachsenen weit verbreiteter, als viele glauben – und dabei oft noch viel zu wenig verstanden. Viele Betroffene sind Jahrzehnte durchs Leben gegangen, ohne zu wissen, warum sie ständig zu spät kommen, Termine vergessen, den Haushalt nicht geregelt bekommen oder in Beziehungen anecken. Sie haben gelernt, sich anzupassen, durchzubeißen oder sich zurückzuziehen. Nicht selten bezahlen sie dafür mit chronischem Stress, Selbstzweifeln, Erschöpfung – oder mit Diagnosen wie Depression, Angststörung oder Burn-out, die nur die Oberfläche berühren.
Gleichzeitig erleben wir in den letzten Jahren eine wachsende Aufmerksamkeit für ADHS im Erwachsenenalter. Immer mehr Menschen – vor allem Frauen – erhalten spät, manchmal erst mit 30, 40 oder sogar 60 Jahren die Diagnose. Und mit dieser Diagnose kommt oft eine Mischung aus Erleichterung, Überforderung und unzähligen Fragen.
Dieses Buch ist für genau diese Menschen geschrieben – für Betroffene, für Angehörige, für alle, die sich endlich ein umfassendes, verständliches und realistisches Bild von ADHS im Erwachsenenalter machen wollen. Es geht nicht um Klischees oder schnelle Patentlösungen. Es geht um echte Informationen, um Zusammenhänge, um Alltagstauglichkeit. Es geht darum, wie es ist, mit einem Gehirn zu leben, das anders funktioniert – und was das im Beruf, in Beziehungen, im ganz normalen Wahnsinn des Alltags bedeutet.
Wir werden gemeinsam einen Blick auf die wissenschaftlichen Grundlagen werfen – aber ohne Fachchinesisch. Wir schauen auf Symptome, die sich oft gut verstecken. Auf ein Leben mit Chaos, aber auch mit Kreativität. Auf Herausforderungen – und auf Ressourcen. Wir sprechen über Diagnostik, Medikamente, Therapieformen und über all das, was man tun kann, um sich selbst besser zu verstehen und das Leben einfacher zu machen.
Denn ADHS bedeutet nicht automatisch Scheitern. Es bedeutet: anders denken, anders fühlen, anders funktionieren. Wer dieses Anderssein versteht, kann lernen, damit umzugehen – und sogar darin zu wachsen.
Wenn du selbst betroffen bist, wird dir dieses Buch helfen, dich besser zu verstehen. Wenn du mit einem betroffenen Menschen lebst oder arbeitest, wirst du lernen, anders – fairer, unterstützender – hinzuschauen. Und wenn du einfach neugierig bist, erwartet dich ein ehrlicher, fundierter und alltagstauglicher Blick auf ein Thema, das längst mitten in unserer Gesellschaft angekommen ist.
Legen wir los.
Kapitel 1: Was ist ADHS?
Mehr als Zerstreutheit – eine neurobiologische Realität
Wenn jemand ständig vergisst, wo er den Schlüssel hingelegt hat, chaotische To-do-Listen führt und in Meetings gedanklich abschweift, hört man schnell den Spruch: „Du hast bestimmt ADHS.“ Meist ist das halb im Spaß gemeint – dabei steckt hinter diesen drei Buchstaben weit mehr als ein bisschen Zerstreutheit.
ADHS, ausgeschrieben Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, ist eine neurobiologische Entwicklungsstörung, die das Gehirn betrifft – insbesondere die Bereiche, die für Aufmerksamkeit, Impulskontrolle, Motivation und Selbstregulation zuständig sind. Und obwohl sie im Kindesalter beginnt, bleibt sie bei einem Großteil der Betroffenen auch im Erwachsenenalter bestehen – nur oft in veränderter Form.
Keine Mode-Diagnose
ADHS ist keine neumodische Erfindung. Schon in medizinischen Schriften des 18. und 19. Jahrhunderts wurden Menschen beschrieben, die sich impulsiv verhielten, nicht stillsitzen konnten oder große Schwierigkeiten hatten, sich zu konzentrieren. Die wissenschaftliche Beschreibung entwickelte sich über Jahrzehnte weiter, die Begriffe änderten sich (Zappelphilipp-Syndrom, MCD, HKS), aber die Symptome blieben.
Heute geht man davon aus, dass etwa 4–5 % aller Erwachsenen weltweit von ADHS betroffen sind – doch die Dunkelziffer ist hoch. Viele werden nie diagnostiziert, weil sie gelernt haben, sich anzupassen oder weil ihre Symptome nicht in das klassische Bild passen.
ADS oder ADHS – was ist der Unterschied?
Das H in ADHS steht für Hyperaktivität – die auffällige Unruhe, das „Nicht-still-sitzen-Können“, das bei Kindern oft zuerst auffällt. Doch nicht alle Menschen mit ADHS sind hyperaktiv. Manche wirken ruhig, verträumt, innerlich abwesend – sie fallen weniger auf, kämpfen aber genauso mit Konzentrations- und Organisationsproblemen.
In der Alltagssprache hat sich deshalb der Begriff ADS (ohne Hyperaktivität) eingebürgert. Medizinisch spricht man von drei Erscheinungsformen:
Vorwiegend unaufmerksamer Typ (eher „ADS“)
Vorwiegend hyperaktiv-impulsiver Typ
Kombinierter Typ (am häufigsten bei Erwachsenen)
Viele Erwachsene mit ADHS haben eine Mischung aus verschiedenen Symptomen, die sich im Laufe ihres Lebens verändert haben.
ADHS – eine Störung der Selbststeuerung
Anders als oft angenommen, ist ADHS keine Aufmerksamkeitsstörung im klassischen Sinn – denn Betroffene können sich durchaus konzentrieren, manchmal sogar extrem (→ Hyperfokus). Das Problem ist vielmehr die Regulation der Aufmerksamkeit: Sie lässt sich schwer steuern. Reize werden nicht richtig gefiltert, der Fokus springt, und die Aufmerksamkeit landet oft nicht dort, wo sie gebraucht wird – sondern dort, wo es gerade interessant, neu oder emotional ist.
Dazu kommt eine veränderte Impulskontrolle: Viele Betroffene handeln, bevor sie denken, platzen mit Gedanken heraus, kaufen spontan Dinge, unterbrechen Gespräche – nicht aus Unhöflichkeit, sondern weil der Impuls zu stark ist, um ihn zu unterdrücken.
Auch das Arbeitsgedächtnis ist häufig beeinträchtigt. Das führt dazu, dass Informationen nicht zuverlässig gespeichert oder abgerufen werden können – was sich in Vergesslichkeit, chaotischen Abläufen und einem Gefühl von mentalem Durcheinander zeigt.
Ursachen: Kein Erziehungsfehler, sondern Genetik und Gehirnchemie
ADHS ist keine Folge von schlechter Erziehung, übermäßigem Zuckerkonsum oder Bildschirmzeit. Es handelt sich um eine erblich bedingte Störung mit biologischer Basis. Bei Menschen mit ADHS sind bestimmte Botenstoffe im Gehirn – vor allem Dopamin und Noradrenalin – nicht in ausreichender Menge oder nicht zur richtigen Zeit verfügbar. Diese Stoffe sind wichtig für Motivation, Antrieb, Belohnungsverarbeitung und Konzentration.
Gleichzeitig zeigen bildgebende Verfahren, dass bei ADHS bestimmte Gehirnareale – insbesondere im präfrontalen Cortex – anders aktiviert werden. Das erklärt, warum Betroffene oft Schwierigkeiten haben, sich selbst zu organisieren, Aufgaben zu planen oder Impulse zu kontrollieren.
ADHS ist nicht gleich ADHS
Ein weiteres Missverständnis: ADHS verläuft bei jedem Menschen anders. Die Symptome können sich in Art, Intensität und Kombination stark unterscheiden – auch je nach Lebensphase, Geschlecht oder Umfeld. Während der eine vor Energie überquillt und von einem Projekt zum nächsten springt, versinkt die andere im inneren Stillstand, kämpft mit Antriebslosigkeit und dem Gefühl, „nichts auf die Reihe zu kriegen“.
Frauen mit ADHS werden besonders häufig übersehen, weil sie seltener durch Hyperaktivität auffallen, aber stärker unter innerem Druck, Selbstzweifeln oder emotionaler Überforderung leiden. Bei ihnen äußert sich ADHS oft eher leise – aber nicht weniger belastend.
Eine unsichtbare Hürde im Alltag
ADHS ist nicht auf den ersten Blick erkennbar. Es gibt keinen Bluttest, keine eindeutige äußere Kennzeichnung. Viele Betroffene wirken im Alltag „ganz normal“ – bis man näher hinschaut: Der überquellende Wäschekorb, das vergessene Meeting, die unerledigte Steuererklärung, die nächtliche Grübelei, das schlechte Gewissen, der Frust über das eigene Chaos.
Diese unsichtbaren Hürden führen nicht selten zu chronischer Überforderung, innerem Stress und einem Gefühl von Anderssein – oft begleitet von einer langen Geschichte aus negativen Rückmeldungen, Missverständnissen und Rückschlägen.
ADHS ist nicht nur Belastung
So herausfordernd ADHS sein kann – es ist nicht nur negativ. Viele Betroffene verfügen über große Kreativität, hohe Empathie, blitzschnelles Denken, unkonventionelle Lösungswege, Begeisterungsfähigkeit und einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Es ist kein Zufall, dass viele Unternehmer:innen, Künstler:innen oder Erfinder:innen von sich sagen, ADHS zu haben. Die Herausforderung besteht darin, die Stärken zu erkennen und die Schwächen zu managen – und genau darum geht es in diesem Buch.
Im nächsten Kapitel werfen wir einen genaueren Blick darauf, wie sich ADHS im Erwachsenenalter zeigt – jenseits von Schulnoten und Spielplatzproblemen. Denn auch wenn die Symptome subtiler werden, verschwinden sie nicht. Sie wechseln nur das Gewand.
Kapitel 2: Wie sich ADHS im Erwachsenenalter zeigt
Wenn das Chaos nicht mehr in die Schultasche passt
ADHS bei Erwachsenen ist wie ein Chamäleon: Es passt sich an, bleibt oft lange unentdeckt – und richtet trotzdem jede Menge Durcheinander an. Während bei Kindern die Symptome meist auffälliger und „äußerlich“ sind (z. B. Zappeln, Stören, Nicht-stillsitzen-Können), verlagert sich ADHS im Erwachsenenalter oft nach innen. Die Betroffenen kämpfen weniger mit Lehrern, dafür mehr mit sich selbst – mit einem chaotischen Kopf, schlechtem Zeitmanagement, emotionaler Achterbahnfahrt und einem ständigen Gefühl der Überforderung.
Und genau das macht die Sache so schwierig: Viele Erwachsene mit ADHS wirken auf den ersten Blick ganz normal – freundlich, gebildet, vielleicht ein bisschen verplant, aber nicht „auffällig“. Erst beim zweiten Hinsehen zeigt sich: Da ist ein Leben voller Stress, Selbstzweifel und gescheiterter Organisationsversuche.
Typische Symptome im Erwachsenenalter
ADHS ist ein ganzes Bündel an Symptomen – und jedes Bündel sieht etwas anders aus. Aber einige typische Merkmale zeigen sich bei sehr vielen Betroffenen:
Konzentrationsschwierigkeiten
Nicht immer und nicht überall – aber in genau den Momenten, wo sie besonders gebraucht wird, ist die Konzentration wie weg. Routineaufgaben? Kaum machbar. Lange Mails lesen? Anstrengend. Telefonate führen? Ein Kraftakt. Die Aufmerksamkeit springt ständig – oder bleibt minutenlang am falschen Detail hängen.
Zeitmanagement und Aufschieberitis
ADHS ist berüchtigt für seine „Jetzt-oder-nie“-Logik. Alles, was keinen akuten Druck macht, wird weggeschoben – bis der Stresslevel explodiert. Deadlines werden ignoriert, Termine vergessen, Aufgaben aufgeschoben, obwohl man weiß, dass es Stress gibt. Ironischerweise sind viele Betroffene unter Zeitdruck plötzlich hochproduktiv – aber das System ist auf Dauer kräftezehrend.
Organisation und Chaos
Die To-do-Liste existiert – irgendwo. Kalender sind halb gefüllt oder ungenutzt. Der Schreibtisch gleicht einem Schlachtfeld, die Wohnung wirkt „kreativ unaufgeräumt“, der Kühlschrank enthält entweder 7x das Gleiche oder gar nichts. Struktur? Schwierig. Routinen? Nur mit sehr viel Mühe.
Impulsivität
Manchmal platzt ein Gedanke einfach heraus – ungefiltert. Oder es wird impulsiv etwas gekauft, obwohl das Konto leer ist. Oder man meldet sich zu drei Projekten gleichzeitig an, weil alles so spannend klingt. Die Fähigkeit, einen Reiz zu bewerten und dann erst zu reagieren, ist bei vielen ADHS-Betroffenen eingeschränkt.
Emotionale Dysregulation
Ein Satz, ein Blick, ein Gefühl – und schon ist alles anders. Wut, Traurigkeit, Euphorie oder Panik können innerhalb weniger Minuten wechseln. Viele Erwachsene mit ADHS empfinden Emotionen intensiver und schwerer steuerbar. Sie sind nicht „launisch“, sondern emotional überflutet. Reaktionen wirken übertrieben – sind aber innerlich völlig echt.
Vergesslichkeit und Verzettelung
Vom Supermarkt zurückkommen – und das Wichtigste vergessen haben. Den Namen des neuen Kollegen nicht mehr wissen. Die E-Mail im Kopf zigmal geschrieben, aber nie abgeschickt. Oder fünf Projekte gleichzeitig anfangen – und keines zu Ende bringen. Das Arbeitsgedächtnis macht, was es will. Multitasking? Funktioniert nicht. Fokus halten? Schwierig.
Die unsichtbaren Folgen: Selbstbild und Lebensqualität
Das Problem an der Sache: Wer jahrzehntelang hört (oder sich selbst sagt), man sei unzuverlässig, faul, unkonzentriert, chaotisch, „zu sensibel“ oder „nicht belastbar“, übernimmt das irgendwann ins eigene Selbstbild. Viele Erwachsene mit ADHS sind hochgradig selbstkritisch. Sie zweifeln an sich, versuchen ständig, sich zu verbessern – und scheitern an Anforderungen, die andere scheinbar mühelos meistern.
Das führt oft zu:
Schamgefühlen und Schuld („Ich krieg’s einfach nicht hin“)
Erschöpfung und Burnout (durch ständigen Kompensationsversuch)
Beziehungsproblemen („Warum kannst du dir das nie merken?“)
Karrierebrüchen (häufige Jobwechsel, Probleme mit Hierarchien)
Selbstwertproblemen (ständig das Gefühl, „nicht normal“ zu sein)
Der Tarnmodus: Maskierung und Kompensation
Gerade Menschen mit spätdiagnostiziertem ADHS haben häufig über Jahre oder Jahrzehnte Masken entwickelt, um zu funktionieren: Checklisten, Erinnerungs-Apps, Perfektionismus, Dauerstress, ständige Selbstkontrolle. Sie übererfüllen, um nicht negativ aufzufallen. Viele erscheinen nach außen organisiert, freundlich, leistungsfähig – aber innerlich herrscht das totale Chaos.
Diese Maskierung kostet Energie. Viel Energie. Und sie hält oft nicht ewig. Viele Betroffene „funktionieren“ gut – bis etwas im Leben kippt: ein Jobverlust, eine Trennung, ein Kind, das eigene ADHS hat. Dann bricht die mühsam errichtete Fassade zusammen – und die Suche nach Antworten beginnt.
ADHS bei Frauen – besonders unsichtbar
Ein besonders häufig übersehener Fall: ADHS bei Frauen. Sie fallen in der Kindheit oft nicht durch Hyperaktivität auf, sondern durch Tagträumerei, Sensibilität oder emotionale Instabilität. Später übernehmen sie oft Care-Arbeit, jonglieren mit Haushalt, Familie, Beruf – und brechen irgendwann zusammen, weil sie sich ständig selbst überfordern.
Viele Frauen erhalten die Diagnose erst spät – und beschreiben diesen Moment als lebensverändernd: Endlich gibt es eine Erklärung für das, was sie ihr Leben lang begleitet hat. Keine Charakterschwäche. Keine Faulheit. Sondern ein Gehirn, das einfach anders tickt.
Ein anderes Gehirn – kein defektes
ADHS ist kein „Defekt“. Es ist ein neurodiverses Funktionsmuster. Das Gehirn verarbeitet Reize anders, bewertet Wichtigkeit anders, strukturiert anders – was nicht schlechter sein muss. Es bedeutet: Wer ADHS hat, muss andere Wege finden, um gut durchs Leben zu kommen. Wege, die funktionieren – nicht für alle, aber für einen selbst.
Und genau darum geht es in den nächsten Kapiteln: Wie finde ich heraus, ob ich ADHS habe? Wie läuft eine Diagnostik ab? Was bringt eine Therapie? Und vor allem: Wie kann ich im Alltag besser mit mir selbst umgehen?
Im nächsten Kapitel schauen wir uns an, wie eine ADHS-Diagnose im Erwachsenenalter abläuft – von den ersten Verdachtsmomenten bis zur offiziellen Bestätigung. Denn auch wenn viele Betroffene „es schon immer geahnt haben“, ist der Weg zur Diagnose oft alles andere als einfach.
Kapitel 3: Der Weg zur Diagnose
Zwischen Aha-Moment und Wartezimmer-Odyssee
Für viele Erwachsene mit ADHS beginnt der Weg zur Diagnose nicht beim Arzt, sondern in einem völlig anderen Moment: Beim Scrollen durch einen Artikel mit dem Titel „ADHS bei Frauen – das übersehene Phänomen“. Beim Hören eines Podcasts, in dem jemand beschreibt, wie chaotisch und gleichzeitig kreativ sein Alltag ist. Oder wenn das eigene Kind gerade eine ADHS-Diagnose bekommt – und man plötzlich denkt: Moment mal … das klingt verdächtig bekannt.
Es ist oft kein „Ich glaube, ich habe ADHS“, sondern eher ein „Oh. Das erklärt SO VIEL.“ Doch zwischen dieser Erkenntnis und der offiziellen Diagnose liegt ein Weg, der sich manchmal anfühlt wie ein Spießrutenlauf durch überfüllte Wartezimmer, missverstandene Symptome und halbgare Informationen aus dem Internet.
Erste Anzeichen: Der Moment, in dem alles Sinn ergibt
Typische Aussagen von Erwachsenen, die sich (meist spät) mit ADHS beschäftigen, lauten:
„Ich dachte, alle hätten diesen inneren Lärm – bis ich merkte, dass das nicht normal ist.“
„Ich bin 40 und habe noch nie eine Steuererklärung pünktlich geschafft.“
„Ich dachte immer, ich sei einfach faul oder zu sensibel.“
„Wenn ich konzentriert arbeite, vergesse ich zu essen, zu trinken und dass ich eigentlich ins Bett sollte.“
Oft beginnt die Selbsterkenntnis mit dem Gefühl, dass irgendetwas „nicht stimmt“ – oder dass man „anders“ funktioniert. Manche erleben Burnouts, Depressionen oder Angststörungen – und erst im Rahmen dieser Behandlungen wird ADHS als mögliche Ursache ins Spiel gebracht.
Die häufigsten Hürden bis zur Diagnose
1. Fehldiagnosen
ADHS wird häufig mit anderen Störungen verwechselt oder überdeckt – z. B. Depressionen, Angststörungen, bipolaren Störungen oder Borderline. Kein Wunder, denn viele Symptome ähneln sich (z. B. innere Unruhe, Konzentrationsprobleme, emotionale Instabilität). Leider bekommen Betroffene oft Medikamente oder Therapien, die an den Symptomen arbeiten – aber nicht an der Ursache.
2. Unwissen bei Fachleuten
Nicht jeder Hausarzt/jede Hausärztin, Psychotherapeut:in oder Psychiater:in kennt sich mit ADHS bei Erwachsenen aus. Manche lehnen die Diagnose sogar ab („Das hat man als Kind oder gar nicht“) oder reduzieren es auf Klischees. Das ist frustrierend – aber leider Realität. Es lohnt sich, gezielt nach Fachpersonen zu suchen, die sich auf ADHS bei Erwachsenen spezialisiert haben.
3. Lange Wartezeiten
Die Nachfrage ist groß, das Angebot klein. Viele Fachpraxen haben Wartezeiten von mehreren Monaten, teilweise über ein Jahr. Das kann entmutigend sein – aber dranbleiben lohnt sich. Manchmal helfen Zwischenlösungen: z. B. Erstgespräche bei Psychotherapeut:innen, um die Richtung zu klären.
Wer stellt die Diagnose?
In Deutschland dürfen nur bestimmte Berufsgruppen eine offizielle ADHS-Diagnose stellen:
Fachärzt:innen für Psychiatrie und Psychotherapie
Fachärzt:innen für Neurologie
Kinder- und Jugendpsychiater:innen (bei Übergangsfällen)
Psychologische Psychotherapeut:innen mit Zusatzqualifikation
Wichtig: Nicht jeder Psychologe oder Coach darf eine medizinische Diagnose stellen – auch wenn viele eine gute erste Einschätzung liefern können.
Was passiert bei der Diagnostik?
Die ADHS-Diagnostik ist keine Fünf-Minuten-Sache, sondern ein strukturierter Prozess. In der Regel umfasst sie:
Anamnese-Gespräch
Hier wird ausführlich besprochen, wie die aktuelle Lebenssituation aussieht, welche Probleme auftreten, wie die Kindheit verlaufen ist, ob ADHS-typische Schwierigkeiten schon früher vorhanden waren usw. Auch Familiengeschichte, psychische Belastungen und Stärken spielen eine Rolle.
Fragebögen und Selbstbeurteilungen
Typische Instrumente sind z. B. der ADHS-Selbstreport (ASRS), das Wender-Utah-Rating-Scale (WURS) für Rückblicke auf die Kindheit oder das DIVA-Interview (Diagnostic Interview for Adult ADHD). Diese standardisierten Verfahren helfen, ein objektives Bild zu bekommen.
Ausschluss anderer Ursachen
Da ADHS viele Symptome mit anderen psychischen oder neurologischen Erkrankungen teilt, ist es wichtig, differenzialdiagnostisch abzuklären: Liegt vielleicht eine Depression vor? Eine Angststörung? Ein Trauma? Auch körperliche Ursachen (z. B. Schilddrüsenerkrankungen) werden geprüft.
Fremdanamnese (optional)
Oft werden auch Eltern, Partner:innen oder enge Bezugspersonen einbezogen, um die Fremdsicht zu ergänzen – vor allem, wenn es um die Kindheit geht. Manche erinnern sich selbst nicht mehr so genau an früheres Verhalten.
Was kostet die Diagnostik?
Wenn du gesetzlich versichert bist und die Diagnostik bei einer kassenärztlich zugelassenen Praxis erfolgt, werden die Kosten in der Regel von der Krankenkasse übernommen. Bei privat Versicherten hängt es vom Vertrag ab. Selbstzahler:innen (z. B. bei privaten Instituten oder Coachings) zahlen je nach Umfang zwischen 300 und 1.200 Euro – allerdings ist das oft keine offizielle medizinische Diagnose, sondern eine fundierte Einschätzung.
Was bringt die Diagnose?
Für viele ist die Diagnose ein Befreiungsschlag. Kein diffuses Gefühl mehr, dass „mit einem etwas nicht stimmt“. Stattdessen: Eine Erklärung. Ein Name. Eine Richtung.
Typische Reaktionen:
„Ich dachte, ich bin einfach unfähig – aber ich funktioniere nur anders.“
„Endlich verstehe ich, warum ich so bin.“
„Ich hätte das gerne schon vor 20 Jahren gewusst.“
Natürlich bringt die Diagnose nicht automatisch Erleichterung. Viele erleben auch:
Trauer um verlorene Zeit
Zweifel („Darf ich das wirklich sagen – ich hab’s doch so lange geschafft?“)
Angst vor Stigmatisierung
Doch mit der Diagnose kommt auch: Zugang zu Unterstützung. Man darf Medikamente ausprobieren. Man kann gezielte Therapien beginnen. Man versteht sich selbst besser – und andere einen vielleicht auch.
Und dann?
Nach der Diagnose beginnt ein neuer Abschnitt: Das Leben mit ADHS – bewusster, informierter, realistischer. Die nächsten Kapitel dieses Buches geben dir Werkzeuge an die Hand: von Therapien und Medikamenten über Strategien für den Alltag bis zu Tipps für Beziehungen, Job und Selbstorganisation.
Denn mit ADHS zu leben, bedeutet nicht, dauerhaft im Chaos zu versinken. Es bedeutet, eine neue Gebrauchsanleitung für sich selbst zu schreiben – und genau dabei möchte dieses Buch dich begleiten.
Im nächsten Kapitel geht es um die Behandlungsmöglichkeiten: Was hilft wirklich? Welche Rolle spielen Medikamente, welche die Psychotherapie – und wie finde ich einen Weg, der zu mir passt?
Kapitel 4: Was hilft wirklich?
Behandlungsoptionen im Überblick
ADHS ist keine Erkältung. Es geht nicht einfach wieder weg, und es gibt keine Pille, die alles über Nacht in Ordnung bringt. Aber – und das ist die gute Nachricht – es gibt wirkungsvolle Hilfen.
Die Behandlung von ADHS im Erwachsenenalter basiert im Idealfall auf einem multimodalen Ansatz. Klingt kompliziert, heißt aber: Man kombiniert verschiedene Maßnahmen – Medikamente, Verhaltenstherapie, Coaching, Alltagsstrategien – je nachdem, was individuell passt.
Denn: Was bei Person A Wunder wirkt, kann bei Person B völlig verpuffen. Wichtig ist also nicht nur die richtige Behandlung – sondern die richtige Behandlung für dich.
Medikamente – Ja oder Nein?
Medikamente sind bei ADHS kein Muss, aber für viele eine enorme Entlastung. Sie wirken auf die Botenstoffe im Gehirn, insbesondere Dopamin und Noradrenalin, und verbessern die Reizfilterung, Konzentration und Impulskontrolle.
Die bekanntesten Wirkstoffe:
Methylphenidat (z. B. Ritalin, Medikinet):
Der Klassiker unter den Stimulanzien. Steigert die Verfügbarkeit von Dopamin. Wirkung tritt meist schnell ein (30–60 Minuten), hält je nach Präparat 4–12 Stunden.
Amphetaminpräparate (z. B. Elvanse):
Ebenfalls ein Stimulans. Gilt als etwas „weicher“ in der Wirkung, besonders bei emotionaler Instabilität hilfreich.
Atomoxetin (z. B. Strattera):
Kein Stimulans, sondern ein Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer. Wird oft bei komorbiden Angststörungen oder Suchterkrankungen eingesetzt.
Guanfacin:
Wird selten verschrieben, aber manchmal bei starker Impulsivität oder Schlafproblemen.
Vorteile:
Schneller Wirkeintritt (bei Stimulanzien)
Deutlich bessere Konzentration, Impulskontrolle, Organisation
Geringeres Chaos-Gefühl im Kopf
Alltag wird „steuerbarer“
Mögliche Nebenwirkungen:
Appetitlosigkeit, Schlafstörungen, Herzrasen
Rebound-Effekte (Symptome kehren nach Abklingen der Wirkung verstärkt zurück)
Emotionale Abflachung bei Überdosierung
Wichtig:
Medikamente wirken unterstützend, aber sie lösen keine Probleme für dich. Sie schaffen Voraussetzungen, damit du Strategien besser anwenden kannst. Ohne Verhaltenstherapie, Selbstreflexion und Struktur bleibst du unter Umständen „ruhig unorganisiert“.
Psychotherapie – Aufräumen im Kopf
ADHS-Therapie ist keine „Redekur“, sondern Alltagsarbeit. Die effektivste Methode bei ADHS ist die kognitive Verhaltenstherapie (KVT), idealerweise angepasst auf neurodiverse Klienten.
Was bringt die Verhaltenstherapie?
Entwicklung realistischer Selbstbilder
Erkennen und Verändern negativer Denkmuster
Aufbau von Routinen und Struktur
Umgang mit Prokrastination und Selbstsabotage
Training sozialer Kompetenzen und Emotionsregulation
Viele Betroffene profitieren auch von Gruppentherapien:
Der Austausch mit anderen wirkt entlastend und gibt das Gefühl, nicht allein zu sein.
Therapie bedeutet nicht, „geheilt“ zu werden – sondern: besser mit sich selbst umgehen zu können.
Coaching – Alltagstauglich statt akademisch
Psychotherapie beschäftigt sich mit Ursachen und inneren Prozessen. ADHS-Coaching dagegen ist praxisorientiert:
Wie organisiere ich meinen Schreibtisch?
Wie strukturiere ich meine Woche?
Wie überliste ich meine Prokrastination?
Ein guter ADHS-Coach kennt die typischen Stolperfallen – und hilft beim Aufbau konkreter Tools. Manche bieten auch Online-Coaching oder Begleitung per App an.
Achtung:
Der Begriff „Coach“ ist nicht geschützt. Am besten auf Qualifikationen achten (z. B. Zertifizierung, eigene ADHS-Erfahrung, psychologischer Hintergrund).
Selbsthilfe – Du bist nicht allein
Der Austausch mit anderen Betroffenen ist oft Gold wert. Ob Selbsthilfegruppen, Online-Foren oder Social-Media-Communities – hier findet man Verständnis, Trost und oft auch ziemlich gute Tipps.
Gute Anlaufstellen:
ADHS Deutschland e.V. (www.adhs-deutschland.de)
ADHS Selbsthilfegruppen (lokal oder online)
Facebook-Gruppen, Discord-Server, YouTube-Kanäle (z. B. „ADHS bei Erwachsenen“)
Podcasts, z. B. „ADHS für Erwachsene“, „Chaos im Kopf“
Struktur, Tools & Routinen – Dein persönliches Ordnungssystem
Viele ADHS-Betroffene entwickeln eigene Strategien, um durch den Alltag zu kommen. Was für andere „Kleinigkeit“ ist, kann für ADHS-Betroffene lebensrettende Struktur sein.
Beliebte Tools:
Digitale Kalender (z. B. Google Calendar mit Erinnerungsfunktion)
Pomodoro-Technik (25 Minuten Fokus, 5 Minuten Pause)
Bullet Journals oder Habit Tracker
visuelle To-do-Listen mit Icons oder Farbcodes
Apps wie „Trello“, „Notion“, „Todoist“, „Forest“
Alltagstipps:
Alles sichtbar machen (Listen, Notizzettel, Kalender sichtbar aufhängen)
Aufgaben aufteilen in Mini-Schritte
Routinen automatisieren (z. B. feste Morgen- und Abendabläufe)
„Body Doubling“ nutzen (mit jemandem parallel arbeiten – live oder per Video)
Belohnungssysteme einbauen (z. B. nach 3 To-dos eine Folge Lieblingsserie)
Wichtig:
Nicht alles auf einmal ändern. ADHS braucht Geduld – auch mit sich selbst. Lieber eine kleine Sache etablieren, die wirklich hilft, als 20 Tools gleichzeitig anfangen und nach drei Tagen frustriert aufgeben.
Was wirklich hilft? Das, was für dich funktioniert.
Es gibt kein Patentrezept. Die Mischung aus Medikamenten, Therapie, Coaching und Alltagstricks ist für jeden anders. Aber was alle erfolgreichen Ansätze gemeinsam haben:
Selbstakzeptanz statt Selbstverurteilung
Strukturen, die zu deinem Leben passen – nicht zu Instagram
Ein Team um dich herum – Ärzt:innen, Therapeut:innen, Freund:innen
Geduld mit Rückschritten – denn die gehören dazu
Im nächsten Kapitel schauen wir uns an, wie ADHS den Alltag beeinflusst – und wie man das tägliche Chaos überlebt, ohne sich selbst zu verlieren.
Kapitel 5: Alltag mit ADHS
Zwischen Listen, Verlusten und Lachanfällen
ADHS im Erwachsenenalter zeigt sich nicht nur im Kopf – sondern im ganz normalen Alltag. In der Küche, im Supermarkt, im Büro, beim Versuch, pünktlich zum Zahnarzt zu kommen oder beim Packen für den Wochenendausflug, bei dem man alles eingepackt hat – außer die Zahnbürste, den Pullover und den halben Verstand.
Viele ADHS-Betroffene sagen:
„Ich arbeite doppelt so viel wie andere – nur um halbwegs mitzuhalten.“
Willkommen im Alltag mit ADHS. Er ist bunt, turbulent, manchmal frustrierend – aber auch kreativ, lustig und voller Überraschungen.
1. Die Sache mit der Struktur – ein täglicher Endgegner
Struktur ist für viele mit ADHS ein schillerndes Einhorn: begehrt, bewundert – aber irgendwie nie zu fassen.
Typische Probleme:
Termine werden vergessen, obwohl sie im Kalender stehen
Man steht im Flur, weiß aber nicht mehr, was man holen wollte
Es gibt 17 To-do-Listen, aber keine wird konsequent genutzt
Der Tag fühlt sich an wie ein wilder Ritt durch einen Raum voller offener Tabs
Gegenmaßnahmen (die wirklich helfen):
Eine zentrale Sammelstelle für alles (ein Planer, eine App, ein Whiteboard)
Morgens den Tag strukturieren (Was steht an? Was hat Priorität?)
Visuelle Hilfen: Kalender an der Wand, farbige Klebezettel, Checklisten mit Kästchen zum Abhaken
Weniger ist mehr: lieber 3 feste Tools nutzen als 10 ausprobieren
2. Aufräumen – oder: Wo war nochmal mein anderer Schuh?
Menschen mit ADHS verlieren nicht nur Sachen, sondern auch Zeit, Energie und den Faden. Aufräumen kann zum epischen Abenteuer werden: Man beginnt mit dem Sockenfach und endet 4 Stunden später tief versunken in alten Tagebüchern.
Strategien, die helfen können:
10-Minuten-Regel: jeden Tag 10 Minuten gezielt aufräumen
Körbe für Chaos: Alles, was keinen Platz hat, kommt erstmal gesammelt in eine „unsortiert“-Box
Gegenstände „zuhause bringen“: Jeder Gegenstand braucht seinen festen Platz
Hilfsmittel nutzen: Timer, Musik, Body Doubling (jemand räumt mit – real oder virtuell)
3. Zeitmanagement – oder: Wie kann es schon wieder 17 Uhr sein?!
Für Menschen mit ADHS fühlt sich Zeit oft an wie ein flexibler, schlecht programmierter Gummizug. Entweder sie schleicht zäh wie Kaugummi – oder sie rast vorbei, während man in einer Hyperfokus-Blase steckt.
Hilfreiche Techniken:
Time Blocking: Zeitfenster für bestimmte Aufgaben festlegen
Pomodoro-Technik: 25 Minuten Fokus, 5 Minuten Pause – hilft beim Starten
Alarmfunktionen nutzen: Erinnerungen an Termine, Aufgaben, Pausen
Visualisierung der Zeit: Analoge Uhren, Countdown-Apps, visuelle Timer
4. Ernährung, Schlaf & Selbstfürsorge – nicht vergessen!
Klingt banal, ist aber essenziell: Viele Erwachsene mit ADHS vernachlässigen ihre Grundbedürfnisse – nicht aus Faulheit, sondern weil sie im „Modus“ einfach nicht daran denken.
Häufige Probleme:
Essen wird vergessen oder durch hektisches Snacking ersetzt
Schlafrhythmus ist unregelmäßig
Körperliche Signale (Hunger, Durst, Erschöpfung) werden übergangen
Selbstfürsorge steht ganz unten auf der Liste – oder gar nicht drauf
Lösungsansätze:
Erinnerungen ans Essen und Trinken (Apps, Partner, Timer)
Abendrituale etablieren für besseren Schlaf
Meal Prep: einfache Mahlzeiten vorkochen oder planen
Körperwahrnehmung üben: z. B. durch Yoga, Meditation, Achtsamkeit
5. Das emotionale Auf und Ab
Der Alltag mit ADHS ist oft emotional intensiv. Kleine Rückschläge fühlen sich riesig an, Freude explodiert in Begeisterungsstürmen, Ablehnung oder Kritik können lähmen.
Typische emotionale Reaktionen:
Überwältigung bei zu vielen Reizen oder Aufgaben
Selbstvorwürfe nach Fehlern
Euphorie bei neuen Ideen – die dann nach kurzer Zeit verpufft
Frustration über sich selbst („Warum schaffe ich das nicht?“)
Was helfen kann:
Emotionsregulation lernen (z. B. in der Therapie)
Pausen einbauen, bevor man reagiert
Gefühle benennen: „Ich bin gerade frustriert, weil …“
Mitfühlender Umgang mit sich selbst: nicht alles sofort bewerten
6. Chaos mit Charme – und ganz viel Kreativität
Trotz aller Herausforderungen haben viele ADHS-Betroffene ein beeindruckendes Talent: Sie finden ungewöhnliche Lösungen, haben kreative Einfälle, sind spontan, originell und in ihrer Begeisterung ansteckend.
Stärken im Alltag:
Improvisationstalent („Plan B? Gibt’s immer!“)
Humor, auch über das eigene Chaos
Empathie und Sensibilität für andere
Neugier und Lust aufs Lernen
Ausdauer bei Dingen, die wirklich interessieren
Alltag mit ADHS – eine Gratwanderung