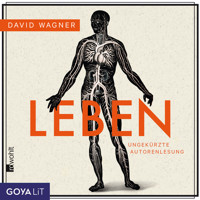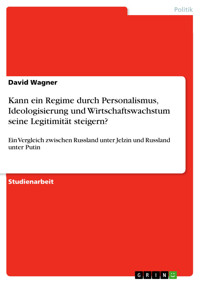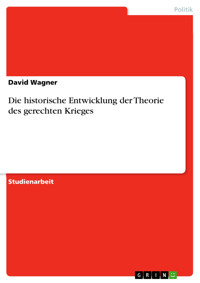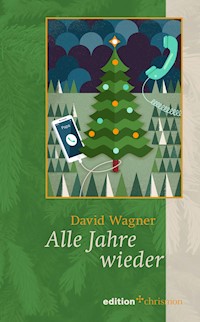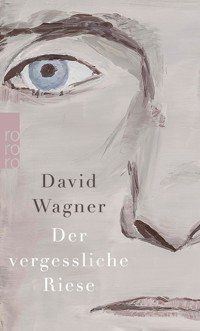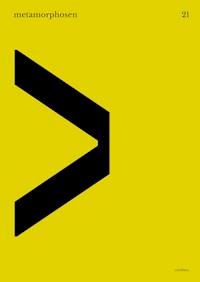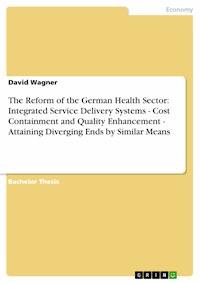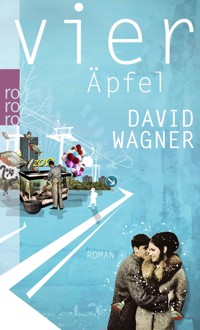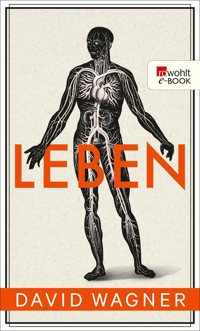Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbrecher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch ist alt und doch ganz neu. Um die Jahrtausendwende spazierte David Wagner durch Berlin, er besuchte Alexanderplatz und Friedrichstraße, einen Joop-Showroom und einen Verkehrsminister, er traf auf Rolf Eden und Angela Merkel. Für dieses Buch nun hat Wagner alle Orte noch einmal aufgesucht und seine Berichte von damals ergänzt und kommentiert. Der Autor, der 2013 für seinen Roman "Leben" den Preis der Leipziger Buchmesse erhielt, erweist sich hier als ein "Kenner, der sich zu verlaufen weiß" (Judith Schalansky).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DAVID WAGNER
MAUER PARK
Der einsamste Esser von Mitte
Wer einen ruhigen, durch und durch ungestörten Abend in einem riesigen Restaurant verbringen möchte, der sollte die Weltbühne, das leerste Lokal Berlins, besuchen. Er wird der einsamste Esser sein. Das leerste Lokal Berlins liegt in der Gormannstraße, hat eine sehr lange Bar, eine Klimaanlage, einen offenen Konzertflügel neben dem Tresen, eine Lounge mit Sesseln und ein Klavier im Speisesaal. Und einen Barmann, der jeden, der eintritt, euphorisch begrüßt. Der Gast hat die Wahl zwischen dreißig leeren Barhockern, leeren Stehtischen und leeren Ledersesseln. Keiner da, und doch brennt auf jedem Tisch eine Kerze.
Für den Aperitif schneidet der Herr der leeren Weltbar, wie sie sich nennt, die erste Zitrone des Abends an. Später weist er dem Gast den Weg ins Restaurant Weltbühne, weiter hinten im Haus. Dort nimmt der Kellner dem Gast den Mantel ab und hängt ihn an die Garderobe, verzichtet jedoch darauf, eine Garderobenmarke auszuhändigen. Sein Mantel ist der einzige Mantel, alle anderen Bügel sind leer. Der Kellner sagt: »Bitte, suchen Sie sich doch einen Platz.« Der Gast sagt: »Danke«, und findet einen ohne jede Mühe. Alle Stühle, alle Bänke im Saal sind leer. Auf einem einzigen Tisch steht ein »Reserviert«-Schild. Es steht so da, daß es von draußen gelesen werden kann.
Lokale in Mitte lassen sich viel einfallen, um Gäste anzulocken. In einem Restaurant Unter den Linden darf in der Herrentoilette auf Eiswürfel uriniert werden. Es gibt Bars mit Tresen aus Silber, andere mit Betten im Raum oder überlebensgroßen Bildern nackter Frauen an der Wand. Andere Orte wiederum warten mit halbprominenten Besitzern oder mobilen japanischen Nudelsuppenküchen auf, die mitten in einem großen Lokal ein Sub-Lokal eröffnen. Und damit alle Japaner der Stadt anlocken.
Die Weltbühne – »Café, Bar und Restaurant«, wie es auf der Streichholzpackung heißt – wollte wohl einfach durch Perfektion überzeugen. Vielleicht war es auch der Wunsch des Architekten, an ein großes Pariser Restaurant zu erinnern. Dunkles Holz, venezianische Lampen, Lederbezüge, direkte und indirekte Beleuchtung: gediegen und künstlich zugleich. Der Gestalter war auch Bühnenbildner, die Innenarchitektur hat Dramaturgie. Dieser Saal müßte laut und voll sein, denkt der einsame Gast. In der Stille, in die nur die Umwälzpumpe des leeren Aquariums hineinplätschert, vertreiben nur Rückblenden die Zeit. In einem Film müßte die Wahrnehmung des einsamsten Gasts von Mitte sich mit einer in Wirklichkeit leider fehlenden Geräuschsinfonie aus der Erinnerung füllen. Mit eingespieltem Frauenlachen, Silberbesteckklappern und dem Klirren voller Gläser.
Der Kellner kommt mit der offenen Karte und sagt: »Die Penne und die frischen Cannelloni sind leider schon aus.« Der Gast wundert sich über das Wort »schon«, wendet den Kopf leicht nach links und sieht nur leere Tische, wendet den Kopf nach rechts und sieht auch dort nur freie Tische, die ihre weißen Tischdecken vielleicht auch, wie eingemottete Möbelstücke, als Staubschutztuch tragen. Und der Gast fragt nicht: »Haben Sie die Cannelloni ganz allein gegessen?«
Die Peinlichkeit des Augenblicks kann der Kellner gekonnt überspielen. Ein inneres Grinsen – warum ist dieser Gast eigentlich so doof, gerade hier essen zu wollen – scheint er sich allerdings nicht verkneifen zu können. Der einsamste Gast muß denken, er sei in die Traumszenen eines Films von Buñuel geraten – dann aber passiert leider doch nichts mit dem Flügel. Und kein Fernando Rey will hier zu Abend essen. Nicht einmal Ameisen laufen dem Gast über die Hände.
Der Kellner kommt wieder und bringt Crostini, drei sehr dünne, sehr harte Weißbrotscheiben. Die erste ist mit einem Klecks Pesto bestrichen, die zweite mit etwas, das wie gehackter Lachs aussieht. Die dritte verschwindet unter einemHäufleinDosenthunfisch. Der einsamste Gast von Mitte traut sich nicht, die Gabe der Küche zu kosten.
Durch die Musik und das Plätschern der Umwälzpumpe hindurch hört er ein Geräusch aus der Küche, das wie das Signal eines Mikrowellenherdes klingt. Der Kellner, der dem Gast nachschenkt, bringt die bestellten Ravioli. Die Ravioli mit Spinat und Ricotta sind sicher irgendwann »hausgemacht« worden, wie die Karte sagt. Nur mit Sicherheit nicht heute, denkt der einsamste Esser von Mitte und stochert auf seinem Teller. Der einsamste Esser stochert in seinen zähen Ravioli und hört Louis Armstrong singen, Louis Armstrong singt »Let’s Do It (Let’s Fall in Love)«. Dreihundert leere Stühle hören zu. Perfektion in der Einrichtung kann auch Beklemmung erzeugen, denkt der Gast. Und stellt sich vor, draußen, in Mitte, sei ein Krieg ausgebrochen und die Weltbühne durch die Front abgeschnitten. Tatsächlich verläuft dieHauptkampfliniedes Nachtlebens nur zwei- bis dreihundert Meter weiter südlich, um den Hackeschen Markt herum. Ein- oder zweimal nur tritt jemand, vielleicht sind es Späher, von der Straße in den offenen Hof. Und starrt, als sei der einsame Gast Teil einer Inszenierung, in den Saal. Der Späher wundert sich, erschrickt vielleicht, von der Leere betroffen, und zieht sich wieder zurück.
Die Leere der Weltbühne hat nichts von der heimeligen, im Grunde sympathisch-verzweifelten Leere, die in den Gemälden Edward Hoppers herrscht. Für eine Hopper-Stimmung ist die Weltbühne viel zu groß. Und ein Stück zu protzig. Ihre Beklemmung gleicht eher der eines Pharaonengrabs. Und der in seiner Konzentration und Professionalität nicht nachlassende Kellner einem lächelnden Grabwächter, der hier vor wer weiß wie vielen tausend Jahren mit begraben wurde. Vielleicht hat die Weltbühne deshalb, obwohl sie erst anderthalb Jahre Leere hinter sich hat, schon etwas Museales. Und so, wie Libeskinds Jüdisches Museum und seine »Voids« ohne Ausstellungsobjekte funktionieren, so funktionieren die Weltbühne und die ihr vorgelagerte Weltbar ohne Gäste. Im Gegenteil, zu viele Gäste würden die erhabene Installation bloß stören.
Im Durchgang von der Weltbar zum Restaurant – gleich neben dem Abstieg in die Toilettenunterwelt, in der auch der Tisch, an dem ein Toilettenbetreuer sitzen könnte, verwaist ist – gibt es eine Zeitungs- und Zeitschriftenecke. Einst für alle wichtigen Zeitungen der Welt gedacht, und einst, das war zur Eröffnung, tatsächlich mit den wichtigen Zeitungen bestückt, liegen da heute die Gratisillustrierten »Feine Adressen in Berlin« und »Bärenstark – das Fachmagazin für Personalservice in Berlin«. Auf der ersten Innenseite von »Bärenstark« grüßt der Geschäftsstellenleiter des Arbeitsamtes Reinickendorf. Der Mann an der Bar und der perfekte Kellner haben – wenn sie nicht gerade telefonieren oder, was allerdings nur ausnahmsweise vorkommt, einen Gast bedienen – genug Zeit, in den Fachmagazinen zu lesen.
Schon seit Jahren befindet sich an gleicher Stelle ein Dunkelrestaurant. Ein Dunkelrestaurant hat immerhin den Vorteil, daß der Gast nicht sieht, wie allein er ißt. – Und sonderbar, hätte mir damals, im Jahr 2001, jemand prophezeit, daß es nur ein paar Schritte weiter, auf der Torstraße (zu dieser Zeit eine ziemlich tote Straße), eines Tages etliche, fast immer gut besuchte Restaurants geben würde – ich hätte ihm nicht geglaubt. Wer hätte gedacht, daß gar nicht einsame Esser im Sommer in Trauben auf den Torstraßengehwegen sitzen und sich vom Verkehrslärm nicht stören lassen würden? Scheint so, als hätten die Steine nicht vergessen, daß hier schon einmal eine Vergnügungsmeile war mit vielen Amüsierlokalen, schon vor und wieder nach dem Ersten Weltkrieg.
Tiergartengeher
Der Tiergartengeher versucht, die frische Luft zu trinken. Der Tiergartengänger zeigt sich dem blauen Himmel und den Blättern am Boden. Oder den Novemberregentropfen. Der Tiergartengänger ist oft ein Läufer, meist in langen, manchmal auch in kurzen Hosen. Und mit kurzen Ärmeln. Der Tiergartenläufer trainiert und rennt, Tiergartenkenner kraulen über die Wege zwischen den Wiesen, auf denen im Sommer gegrillt wird. Der Tiergarten wird von Spazierradfahrern befahren, von Fahrradkurieren gequert, von Schnellgehern durchmessen. Liebhaber lüften sich hier, zeigen sich den Bäumen. Und die Bäume zeigen sich auch. Der Tiergartengänger kann, ohne es zu bemerken, das Gaslaternenmuseum streifen. Der Tiergartengeher kann Enten quaken hören und Kinderwagen fahren sehen, in denen Kinder liegen, die ebenfalls quaken. Gelegentlich füttert der Tiergartengänger die Enten. Oder die Kinder. Oder sich selbst. Oder er sitzt auf einer Bank und tut nichts und macht sich verdächtig. Der Tiergartengänger trägt sonderbare, selbstgestrickte Stirnbänder und sieht für Kinder furchterregend aus. Oder sitzt am Wasser und raucht. Oder lehnt an einer Laterne und wartet auf Kundschaft. Oder genießt doch nur den Duft der frisch verfaulten Blätter. Tiergartenkinder toben durch die trocknenden Blätter wie weiland im Vorspann der »Sesamstraße«. Nah an der Siegessäule trägt der Tiergartentourist oft einen aufgeschlagenen Stadtplan, näher am Brandenburger Tor eine Videokamera. Die Tiergartengängerin schlenkert ihre kleine, silberfarbene Kompaktkamera an einer Kordelschlaufe, an der auch kleinere Hunde hängen könnten, um ihr Handgelenk. Den Tiergartenwanderer umgeben die Geräusche der Vögel. Und der Gesang des Verkehrs. Der Tiergartengänger geht oft im Kreis, auch Tiergartengeher sehen sich im Leben zweimal. Tiergartengänger treten oft zu zweit auf, als leicht- bis mittelverliebtes Paar, der Tiergartengeher bildet sodomitische (Frauen mit Hunden und Hunde mit Männern) und gleich- und gemischtgeschlechtliche Paare. Tiergartengänger sind gelegentlich Männer im Mantel mit Anzug und Krawatte, vielleicht aus dem Bundespräsidialamt entlaufen. Tiergartengänger gehen oft leicht nach vorne gebeugt, in der kontemplativen Haltung des gehenden Denkers. Und spielen, wie sich beim Näherkommen zeigt, doch nur mit ihrem Mobiltelefon. Tiergartengänger führen ihre Jacken, ihre Jogginghosen und ihre Hunde aus. Und ihre langen Leopardenmustermäntel. Der Tiergartenwandler läßt sich von Aktenmappe, Schal, der Zeitung unter dem Arm und dem Matsch am Schuh begleiten. Und perforiert mit zusammengeklapptem Schirm den aufgeweichten Boden.
Nordic Walker sind hinzugekommen, mit Stockprothesen staksen sie wie sehr große Insekten durchs Bild. Ansonsten hat sich, was Gangarten betrifft, nicht viel geändert.
Friedrichstraße
Was die Friedrichstraße einmal war, wissen nur noch alte Ansichtskarten. Heute ist sie die Schneise, in der sich alte und neue Berlinmetaphern aneinanderreihen. Wer vom Bahnhof Friedrichstraße oder dem Eck Unter den Linden Richtung Hallesches Tor spaziert, kann Besuchern, Touristen und manchem Stadtbewohner beim Staunen zusehen.
Teils mit Stadtführern und patentgefalteten Falkplänen, teils mit gut gefüllten Einkaufstüten beschwert, stapfen die einen wie die anderen über das Pflaster. Viele Gesichter sagen: »Wir wollen nun mal sehen, wie es hier aussieht.« Auch Helmut Kohl hat man hier schon flanieren sehen. Andere Passanten, jünger und besser angezogen, benutzen die Straße so selbstbewußt, als hätte es sie so schon immer hier gegeben. Wer Jahre nicht hier war, könnte glauben, in einem Traum aufzuwachen. Großkulissenbauer scheinen am Werk gewesen zu sein, die Leere hat sich – wie eine Opernbühne zur Chorszene – mit telefonierenden Anzugträgern gefüllt. Manchmal fährt einer von ihnen auf einem Tretroller vorbei.
Vor dem Wolfsburger Autopalast am Eck Unter den Linden bleiben schaulustige Menschen stehen, als gäbe es in der Stadt sonst keine Autos zu sehen. Die meisten staunen über das Preisschild neben dem ausgestellten Rolls-Royce. Ein Stück die Straße hinunter sind ein alter schwarzer Bugatti und das silberne Tretauto-Coupé im Fenster der Mercedes-Filiale zu bewundern. Ein Fahrrad mit Hilfsmotor und der Aufschrift »Daimler-Benz« kostet 3.250 Mark. Die Friedrichstraße ist auch Vorführstrecke für die Wagen, die hier hinter den Scheiben stehen. Reisebusse rollen langsamer die Straße hinunter, die Menschen auf den Sitzen halten Ausschau nach dem neuen Berlin. Auf einer Fensterscheibe können sie »Permanent Make-Up« lesen, vielleicht gilt die Beschriftung der Fassade, vielleicht der ganzen Straße. Bis hinunter zum ehemaligen Grenzübergang reihen sich Büro- und Geschäftshäuser selten scheibchenweise aneinander, hier stehen ganze Blöcke, die kleinteilige Parzellierung wurde aufgegeben. Die letzten Bauschilder schreiben Lyrik an den Straßenrand, die Versanfänge lauten: »Hier entsteht …«, »Hier baut …«. Dazwischen wartet eine entkernte, abgestützte Eckfassade auf neue Füllung. Der Glaspalast, den Jean Nouvel für die Galeries Lafayette errichtet hat, mußte sich, nicht lange nach Fertigstellung, mit vorgehängter Folie wieder als Baustelle verkleiden. Hin und wieder löst sich eine Scheibe aus der Fassade und zerbröselt über den Passanten. Einen Block weiter stehen die großen Namen unserer Zeit – italienische, japanische, französische, amerikanische – auf der Fassade. Die großen Marken hängen in den Fenstern aus, einen Block lang möchte die Friedrichstraße Fasanenstraße sein. Italienische Touristen, französisch sprechende Spanier und Amerikaner auf Europaschleife schauen in die Auslagen, Klebebuchstaben schreiben Sonderangebote auf die Scheiben.
In den meisten Gebäuden sind die Fensterbänder gleich-und regelmäßig in die Fassade gestochen. Polierter Stein allerorten, in einem Eingang zitiert roter Marmor Speers Neue Reichskanzlei. Deren Reste finden sich noch als Wandverkleidung im nahe gelegenen U-Bahnhof Mohrenstraße. Auf dieser Höhe wirkt die Friedrichstraße einheitlich, spätere Generationen werden sie betrachten und sagen: »So sahen die neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts aus.« Und schon heute darf man sich fragen, ob die Häuser der neuen Friedrichstraße für einen, der hier in fünfundzwanzig Jahren vorübergeht, nicht so ausschauen werden wie das Europa-Center oder das Neue Kreuzberger Zentrum am Kottbusser Tor heute. Vielleicht wird man dann laut über den Abriß der heute gerade fertig gewordenen Gebäude nachdenken. Nicht wenige von ihnen ducken sich wie riesige polierte und zu eng aneinandergesetzte Grabsteine in den märkischen Sand. Andere ruhen sich wie Sockelgeschosse zukünftiger Hochhäuser noch aus.
Vorbeilaufende Hobbystadtplaner erklären gern, was hier alles anders, viel besser hätte gemacht werden müssen: »Die Straße weiter, weniger glatter Stein, mehr Stuck«, »mehr alte Häuser«, »mehr Glas«. »Hier sieht man Gesichter, die man in Berlin sonst nicht gesehen hat«, erklären Kinder ihren Eltern, »hier suchen Angehörige kürzlich zugezogener Kasten nach der Metropole.« Die Geisterbahnhöfe, auf denen zu Mauerzeiten die Züge nicht hielten, spucken Menschen, keine Gespenster aus. Sie arbeiten beim Fernsehen am Hausvogteiplatz, in einer Bundesbehörde oder bei einem der vielen Verbände. Hier ist alles frisch gestrichen.
Das Jagdgeschäft Frankonia lockt mit Lodenmode im Schaufenster, gegenüber erinnert eine neuere Gedenktafel an die Barrikadenkämpfer des März 1848, die an dieser Stelle auf die Soldaten des zweiten Königsregiments schossen. Barrikaden könnten heute nur noch aus Bauzäunen oder umgestürzten Autos errichtet werden, auf der Friedrichstraße stören keine Bäume die Sicht. Im Sommer 1999 besetzten die letzten militanten Autonomen der Stadt die Friedrichstraße, bekritzelten den Asphalt und versuchten, die Galeries Lafayette zu stürmen. Einige Regale stürzten um. Am Ende der Aktion waren ein paar Designer-Sonnenbrillen verschwunden. Letztere zeigen sich auf der Friedrichstraße beim ersten kleinen Sonnenstrahl. Leider gibt es kaum Straßencafés, in denen Sonnenbrillenträger länger sitzen könnten. Ursprünglich hätte am Eck Unter den Linden, dem Traditionsstandortdes Café Bauer, wieder ein Café einziehen sollen, dann aber zogen doch die Autos aus Wolfsburg ein. Das Café im Haus der Demokratie ist schon lange geschlossen, das Gebäude gehört nun dem Beamtenbund. In den anderen, neu eröffneten Cafés der Friedrichstraße gibt es keine alten Sofas, keine Gesellschaftsspiele, keine Berge alter Zeitungen und keine Wandparolen mehr. In der Bäckerei am U-Bahnhof Stadtmitte und in der Filiale des Café Einstein stehen nur Hocker. Das Einstein gibt sich hier nicht mehr österreichisch wie in der Kurfürstenstraße, sondern amerikanisch. Durch die heruntergezogenen Glasscheiben läßt sich die oft aufgesetzte Hektik mancher Passanten gut beobachten, häufig wirkt sie wie aus den Hollywoodfilmen abgeschaut, die vorgeben, in New York zu spielen. Selbst Fahrradfahrer scheinen hier energischer als anderswo in die Pedale zu treten, manche können, während sie Fahrrad fahren, noch telefonieren.
An der Stelle, wo die Mauerstraße auf die Friedrichstraße trifft, wird eines Tages vergessen sein, daß die Mauerstraße ihren Namen schon lange vor der Mauer von der ehemaligen Stadtmauer hatte. Auf dem leeren Eckgrundstück erinnern die weichen Formen der letzten DDR-Straßenlaternen an die Zeit, in der die Sektorengrenze weiträumig ausgeleuchtet war. Die alte, viel fotografierte Wandschrift wirbt noch immer für die Neue Zeit, die Ost-Tageszeitung, die es schon lange nicht mehr gibt. Daß hier einmal, von 1961 bis 1989, die Mauer stand, muß Touristen und Nachgeborenen mittlerweile erklärt werden, nur ein schmales Metallband markiert den Verlauf im Asphalt. Trotzdem bleiben beim Gangvon Mitte nach Kreuzberg Übergangsgefühle spürbar. Grenzlinien ziehen sich, sichtbar oder unsichtbar, zwar auch anderswo durch die Stadt – nirgendwo aber wäre eine Maßhemdenschneiderei nur hundert Meter weiter südlich so undenkbar wie hier.
Am Checkpoint Charlie wechseln das Straßenpflaster, die Laternen und der Bezirk. Auf einer kleinen Mittelinsel steht der Leuchtkasten mit den großen Porträts, die Frank Thiel von einem sowjetischen und einem amerikanischen Soldaten gemacht hat, auf dem Bürgersteig steht ein weiterer Leuchtkasten mit einem Plan von Kreuzberg. Investitionswunderland ist zu Ende, eine leere Hemdchentüte weht vor dem renovierten Café Adler übers Pflaster. Der angloindischeKulturtheoretiker Homi K. Bhabha, der einmal dort auf demBürgersteig saß und Kaffee trank, sagte, Berlin erinnere ihn an Bombay.
So gegensätzlich die beiden Hälften der Friedrichstraße vor der Maueröffnung waren, so wenig haben sie heute miteinander gemeinsam. Heute ist der Westen alt und Mitte neu; früher war es umgekehrt. Unvoreingenommene Besucher des Mauermuseums könnten den Westen für den Osten halten, denn an dieser Stelle erfüllt der Westen das Klischee, das früher für den Osten galt: ästhetisch weit abgeschlagen zu sein und irgendwie hinter der Zeit zu liegen.*
Das erste kurze Stück der Kreuzberger Friedrichstraße lebt noch von der Erinnerung an die Mauer, Foto Klinke verkauft hier viele Filme, russische Straßenhändler bieten Devotionalien des untergegangenen Sozialismus feil. Hinter der Kreuzung Kochstraße wird die Friedrichstraße sehr vielruhiger. Auf der rechten Straßenseite liegt der Polizeiabschnitt 53, die Wache zeigt dem Bürgersteig die Uhr. Ein Neubau mit betonverblendeten Wannenbalkonen hält eine Hinweistafel, die verrät, daß an dieser Stelle einst das Apollotheater stand, in dem Eisensteins »Panzerkreuzer Potemkin« seine deutsche Erstaufführung erlebte. Der Adler auf dem Landesarbeitsamt schaut nach Norden, nach Mitte – dorthin, wo es heute Arbeit gibt. Kreuzberg hat die höchste Arbeitslosenrate aller Berliner Bezirke. Auf der unteren Friedrichstraße ist es nachts dunkler als in Mitte. In Mitte leuchten die neuen Doppelkandelaber viel heller als die gewöhnlichenKreuzberger Straßenlaternen, in deren Schein die Straße sich verliert. Links sind Lücken mit flachen Barackenbauten gefüllt, Läden stehen leer, eine Schaufensteraufschrift versprichtein Gartenlokal. Die Imbißbude vor dem eingezäunten Abstellplatz eines Gebrauchtwagenhändlers auf einem leeren Eckgrundstück ist exemplarisch für ein Stück West-Berlin. Auf der linken Seite liegt, zurückgesetzt, die Halle des Blumengroßmarkts. Stadtrandgefühle kommen auf, nur Fußminuten entfernt von einem U-Bahnhof, der sich Stadtmitte nennt. Die Hausnummern werden immer höher, Lampenläden, Käsegeschäfte, ein Bioladen und verstaubte, leerstehende Ladenlokale wechseln sich ab. Eine Änderungsschneiderei, keine Maßhemdenfertigung, vom Glamour der großen Marken ist nichts mehr zu sehen. Selbstausgeschnittene Klebebuchstaben schreiben »Krankengymnastik« auf eine Schaufensterscheibe, ein Café heißt »Café Persil«, ein Imbiß »Aladin«. In der Auslage eines Geschäfts sind Naturfaserkleider, Backpinsel und Bürsten aller Art zu sehen: Tassenbürsten, Flaschenbürsten, grobe Handfeger, Schuh-, Spül- und Scheuerbürsten warten auf Käufer. Den Häusern der Bauausstellung von 1987 – damals wurden Blockbebauung, Korridorstraße und Traufhöhe wiederentdeckt – hängen zitierte Erker und Giebelchen in der Fassade. Ein kleiner Bagger parkt am Straßenrand, ein Hund liegt auf der Straße und gähnt, der Boden vibriert nur von der immer wieder unter dem Pflaster durchfahrenden U-Bahn.
Von der Vorkriegsbebauung blieb hier kaum ein Stein auf dem andern. Von Bombenlücken zu sprechen, trifft die Sache nicht, von der ganzen südlichen Friedrichstadt ist nicht mehr als ein Stelenfeld vereinzelt stehender Altbaublöcke übriggeblieben. Sie ragen wie Monolithen aus dem Schlachtfeld, nach dem Krieg haben sie auch den Sanierungskrieg überlebt. Ein sehr großflächiges Mahnmal entstand hier ganz absichtslos. Die Friedrichstraße ist, wie viele Straßen Berlins, eine, der man fast alle Zähne ausgeschlagen hat. Die Zeilenbebauung hat Karies und hin und wieder viel zu große Plomben in den Lücken. Wer es nicht besser weiß, könnte glauben, ein großes Erdbeben hätte diese Stadt heimgesucht. Mancher Besucher hat sich beim Anblick der freigebombten und abgeräumten Flächen schon an die Erdbebenlücken von Mexiko-Stadt erinnert. Wer die südliche Friedrichstraße in der Nacht hinunterspaziert, sieht in der Fluchtlinie sechs weiße Neonbuchstaben, die sich zu dem verkürzten Imperativ »Gedenk« zusammensetzen, erst am Halleschen Tor entpuppt sich das Memento im Nachthimmel als die Dachbeschriftung der Amerika-Gedenkbibliothek, die von der anderen Seite des Landwehrkanals herüberleuchtet.
Die Friedrichstraße endet in einer Fußgängerzone, die in den Mehringplatz mündet. Letzterer ist zum Landwehrkanal hin verbaut. Die Nachkriegsveränderungen haben aus dem letzten Stück der Friedrichstraße eine Sackgasse, einen stummeligen Wurmfortsatz gemacht. Linden- und Wilhelmstraße münden nicht mehr in das ehemalige Rondell, den alten Belle-Alliance- und heutigen Mehringplatz. In seiner jetzigen Gestalt ist der Platz aus einer Epoche überkommen, die sich dem Anspruch, alles neu und viel besser zu machen, übereifrig verpflichtet fühlte. Jeder Zeit die Architektur, die sie verdient: Um den runden Platz liegen Wohnbunker in Doppelreihe. Ihre Balkone sind mit Betonplatten gesichert, die man für Kugelfänger halten könnte. Vielleicht dachten die Planer, hier könnte bei einem kommunistischen Überfall das letzte Widerstandsnest des freien Westens liegen? West-Berlin hat sich an dieser Stelle im Kleinen noch einmal selbst eingemauert. Die Häuser stehen wie eine Betonwagenburg im Kreisrund, der Platz scheint nicht vergessen zu haben, daß er Belle-Alliance nach Blüchers Heerlager bei Waterloo hieß, und daß am Halleschen Tor bis in die letzten Apriltage des Jahres 1945 gegen die Rote Armee gekämpft wurde. Von der ehemals barocken Platzanlage des Rondells ist nicht mehr viel zu ahnen, die Sanierungsidee vom verkehrsfreien Dorfanger zwischen den Häusern ist verlorengegangen. Der Architekt Werner Düttmann hat in der ursprünglich von Hans Scharoun skizzierten Anlage selbst die Schießschartenfenster und Bunkerschlitze nicht vergessen. Kein Wunder, daß die Kneipen in dieser Umgebung vor lauter Sehnsucht nach einer anderen Zeit Zum Eisernen Gustav heißen müssen. Die Videothek ist abends sehr gut besucht, und fast jeder Balkon trägt eine Satellitenantenne. Vielleicht werden andere eines Tages ähnlich entgeistert auf die Reste des »Neuen Berlin« und seine Friedrichstraße schauen. Für die Ewigkeit wird zum Glück nur noch selten gebaut.
Am Mehringplatz dröhnt Musik aus einem Übungskeller, und wie ein Verirrter aus einer anderen Welt radelt ein Anzugträger mit Fahrradklammern am Hosenschlag durch die Fußgängerzone. Wahrscheinlich wohnt der junge Anwalt in einem der renovierten Altbauten um den Chamissoplatz, die so oft als Filmkulisse herhalten müssen. An das 19. Jahrhundert erinnert auf dem Mehringplatz nur noch eine Brunnensäule von Cantian, auf der eine Viktoria von Christian Daniel Rauch über allen Niederlagen steht. Unter der Hochbahn am Halleschen Tor, die man durch eine Öffnung des Betonrings sieht, sitzt ein Bettler mit Bart. Wer die Friedrichstraße bis hierher zu Fuß hinuntergegangen ist, hat den Rolls-Royce im Schaufenster an der Ecke Unter den Linden wahrscheinlich schon vergessen.
* Zur Berlin Biennale 2012 wurde die Mauer in der Friedrichstraße wieder aufgebaut. Die Künstlerin Nada Prlja errichtete eine zwölf Meter breite und fünf Meter hohe, »Peace Wall« genannte Installation. Wollte sie damit sagen, daß Berlin und diese Straße noch immer geteilt sind? Daß der nördliche Teil (in Mitte, im alten Osten) heute reicher ist als der Süden (Kreuzberg, früher Westen)? Vielleicht. Einige Anwohner und Geschäftsleute beschwerten sich bald über die neue Mauer Höhe Besselstraße, sie schneide sie von ihren Kunden ab, meinten sie, grenze ihre Bewegungsfreiheit ein. Andere freuten sich über die Verkehrsberuhigung.
Seit dem Sommer 2012 geht es so: Wer mit der U6 aus dem Wedding nach Kreuzberg fahren möchte, hört am Bahnhof Friedrichstraße eine Lautsprecherstimme rufen: »Please walk from Friedrichstraße to Französische Straße«. Die U6 ist unterbrochen, Unter den Linden wird ein neuer Kreuzungsbahnhof gebaut. Die Stationen Friedrichstraße und Französische Straße sind zu provisorischen Endbahnhöfen geworden, sie zwingen die Fahrgäste hinauf ans Tageslicht, U-Bahnfahrer werden zu Fußgängern. Oben auf der Friedrichstraße können sie bemerken: Es ist einiges los.
Fußgängerströme wälzen sich über die Gehwege, kommen in Wellen. Fußgänger weichen einander gekonnt oder unbeholfen aus, drängeln, bleiben stehen, rempeln. Rollkofferpiloten ziehen, Kinderwagenschieber schieben, Vierzehnjährige rauchen ungeübt im Gehen. Einer steht an der Ecke, schreibt etwas in ein Notizbuch, bückt sich und hebt eine 1-Euro-Münze auf. Das Geld liegt hier, so sieht es aus, auf der Straße.
Schnellgeher eilen, Passanten schlendern, Tütenträger schlenkern mit ihren Tüten, sie alle folgen den auf dem Pflaster klebenden Folien-Fußabdrücken in BVG-Gelb. Die Fußstapfen sollen zum nächsten Eingang in den Untergrund führen. Einige sind schon abgetreten und eingegraut, andere sehen aus, als hätten Ratten ihnen nachts eine Zehe abgeknabbert.