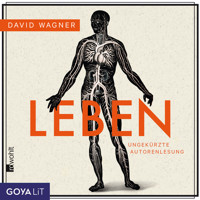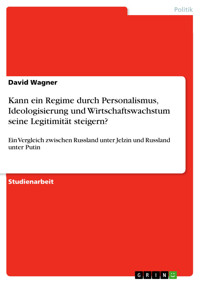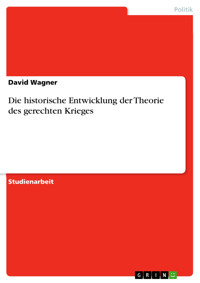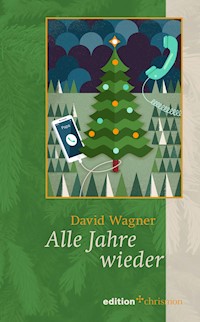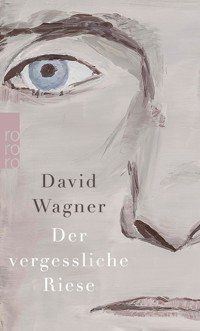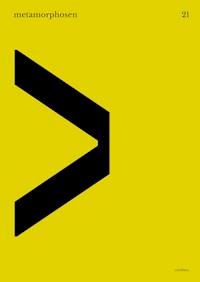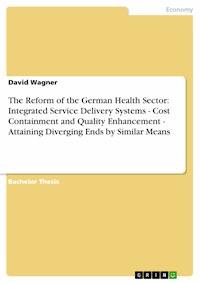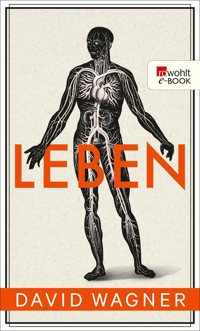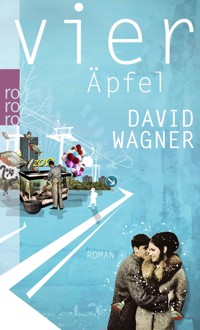
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit vier Äpfeln fängt alles an. Ein Mann, der weniger zu tun hat, als ihm lieb ist, erlebt an der Obst- und Gemüsewaage seines Supermarkts einen magischen Moment: Die grünen Leuchtziffern zeigen 1 0 0 0. Vier Äpfel, die zusammen genau tausend Gramm wiegen? In der Hoffnung, dieser Tag werde ein besonderer sein, klebt er das Etikett mit der Strichcodezeichnung auf die Tüte und schiebt seinen Einkaufswagen weiter durch den Nachmittag. Seine Gedanken schweifen ab in eine Zeit, als man noch in kleineren Läden andere Dinge kaufte, zu Frühergerüchen, zum gewandelten Einkaufsverhalten überhaupt. Und er erinnert sich an L., die Frau, die ihn verlassen hat. «Vier Äpfel» handelt von einer verlorenen Liebe und der mal tieftraurigen, mal skurrilen Schönheit der alltäglichsten Dinge. Ein in glasklarer, rhythmischer Prosa erzählter Liebes- und Supermarktroman, der durch seine präzisen, beinahe ethnologischen Beschreibungen Wahrnehmungsweisen schärft, sie vielleicht sogar verändert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
David Wagner
Vier Äpfel
Roman
Über dieses Buch
Mit vier Äpfeln fängt alles an. Ein Mann, der weniger zu tun hat, als ihm lieb ist, erlebt an der Obst- und Gemüsewaage seines Supermarkts einen magischen Moment: Die grünen Leuchtziffern zeigen 1 0 0 0.Vier Äpfel, die zusammen genau tausend Gramm wiegen? In der Hoffnung, dieser Tag werde ein besonderer sein, klebt er das Etikett mit der Strichcodezeichnung auf die Tüte und schiebt seinen Einkaufswagen weiter durch den Nachmittag.
Seine Gedanken schweifen ab in eine Zeit, als man noch in kleineren Läden andere Dinge kaufte, zu Frühergerüchen, zum gewandelten Einkaufsverhalten überhaupt. Und er erinnert sich an L., die Frau, die ihn verlassen hat.
«Vier Äpfel» handelt von einer verlorenen Liebe und der mal tieftraurigen, mal skurrilen Schönheit der alltäglichsten Dinge. Ein in glasklarer, rhythmischer Prosa erzählter Liebes- und Supermarktroman, der durch seine präzisen, beinahe ethnologischen Beschreibungen Wahrnehmungsweisen schärft, sie vielleicht sogar verändert.
Vita
«Ein Künstler müßte alles nur mit einer dünnen Wachsschicht überziehen und warten, bis eine hohe, undurchdringbare Dornenhecke um den Supermarkt gewachsen ist, und schon nach zwanzig Jahren wäre sein Wachsguß eines der genauesten und detailliertesten Abbilder der vergangenen Zeit, denn hier steht und liegt ja das, womit und wovon wir leben.»
David Wagner, geboren 1971, veröffentlichte seit 2000 den Roman «Meine nachtblaue Hose», die Erzählungen «Was alles fehlt», den Prosaband «Spricht das Kind», den Essay «Für neue Leben» und anderes mehr. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Walter-Serner-Preis, der Dedalus-Preis für Neue Literatur und der Georg-K.-Glaser-Preis. David Wagner lebt in Berlin.
Der schönste Tag in meinem Leben war ein Donnerstag
Auf der Straße auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt
Tocotronic
1
Lange bin ich gar nicht gern in Supermärkte gegangen. Heute aber trete ich durch die leise zur Seite gleitende Schiebetür und sehe gleich den Rücken meiner Lieblingskassiererin an der Kasse links, ich erkenne sie an ihrem langen, blonden, gewellten Haar. Ich bleibe stehen, suche in meiner Hosentasche nach einer Münze für das Einkaufswagenschloß und schaue zu, wie sie das Strichcode-Etikett einer Käse- oder Fleischwarentüte mit unnachahmlicher Handbewegung über das Scannerfeld ihrer Computerkasse schwenkt. Dann durchquere ich den Raum vor den Kassen, löse einen Einkaufswagen von der Kette, ziehe ihn heraus, wende Richtung Drehkreuz und schiebe ihn durch den Vorhang aus den drei signalorangefarbenen Plastikelementen, die mich immer an ihre entfernten Verwandten, die Fliegenvorhänge aus bunten Plastikstreifen, erinnern. Hinter solchen Strandhüttenvorhängen liegt das Meer, hier, im Supermarkt, zeigen sie nur an, wo der Verkaufsraum beginnt. Ich gebe dem Einkaufswagen einen Stoß, er rollt unter der Sperre hindurch, die schmalen Plastikzungen klappen nach hinten und schwingen schon wieder vor, während ich durch das Drehkreuz gehe, in dem ich mich, wie immer, für einen kurzen Augenblick gefangen fühle,[*] bevor ich die Verkaufsfläche betrete und in ein großes, gut ausgeleuchtetes Stillleben gelange, aus Äpfeln, Birnen, Pfirsichen und Bananen, Gurken, Möhren, Paprikaschoten und Tomaten.
2
Vor dem Obst reiße ich eine transparente Plastiktüte von einer der senkrecht angebrachten, drehbar gelagerten Tütenrollen und suche unter all den angebotenen Apfelsorten nach einer, die mir weniger künstlich erscheint als die anderen. Natürlich muß ich dabei berücksichtigen, daß die Züchter, die heute womöglich Produktdesigner heißen, sicher längst einen Apfel entwickelt haben, der den Anschein erweckt, gerade erst von einer naturbelassenen Streuobstwiese gepflückt worden zu sein, tatsächlich aber schon Wochen im Bauch eines Schiffes oder in der kontrollierten Atmosphäre eines Lagerhauses bei abgesenktem Sauerstoffgehalt gelegen hat. Die Züchter haben die Abweichung, den kleinen Makel, die Apfelschönheitsflecken wahrscheinlich schon in den perfekten Apfel hineingezüchtet, was mich nun nach Äpfeln greifen läßt, die ihre Perfektion nicht tarnen. Ich wähle italienische aus Südtirol, weil die so viele tausend Kilometer weniger unterwegs gewesen sind als die aus Chile oder Neuseeland, und suche mir vier schöne, aber nicht zu schöne Exemplare aus. Einen nach dem anderen lege ich in die Tüte, die dabei so raschelt, wie die Blätter des Baumes, an dem die Äpfel gewachsen sind, vielleicht geraschelt haben. Als ich den letzten in die Tüte stecke, bin ich mir allerdings gar nicht mehr so sicher, ob sie überhaupt an einem Baum gewachsen sind. Vielleicht sind sie ja auch, wie die im Märchen von Schneewittchen, das Erzeugnis einer bösen Stiefmutter und, feil, feil, schöne Ware, dem Supermarkt geliefert worden.
3
Mit der Tüte in der Hand gehe ich zur Waage, lege sie auf die Wiegefläche und drücke die Apfeltaste. Auf allen Wahltasten der Obst- und Gemüsewaage befinden sich Abbildungen, die mich immer an Kinderbuchillustrationen und Memory-Kärtchen erinnern.[*] Kurz warte ich, daß sich das mit dem Strichcode bedruckte Klebeetikett aus dem Schlitz des Thermodruckers schiebt, dann muß ich staunen. Erst halte ich es für einen Fehler, aber nein, die grüne Leuchtanzeige zeigt 1000 an, die vier Äpfel wiegen zusammen genau tausend Gramm. Ganz vorsichtig entnehme ich das Etikett, auf dem ich die Zahl noch einmal lese, klebe es auf die Apfeltüte, knote sie zu und lege sie in den noch leeren Einkaufswagen. Vielleicht ist heute ein besonderer Tag.
4
Ich nehme auch zwei unbehandelte Zitronen, die ich nicht wiegen muß, weil sie pro Stück verkauft werden, lege sie neben die Äpfel und schwenke mit dem Wagen hinüber zu den Kartoffeln, die hinter den Salaten in durchsichtigen Plastikbehältern liegen. Ich mutmaße, daß ohnehin nur fast perfekte, um die zweihundertfünfzig Gramm wiegende Äpfel in die Supermarktregale gelangen. Hier liegt die Apfelelite, während andere, weniger ansehnliche Exemplare in Fertigkuchen verbacken oder zu naturtrübem Saft gepreßt werden oder, Apfelschicksale, in heißen Apfeltaschen enden. Die Kartoffeln gibt es lose und in Netzen, es gibt Bio- und Nicht-Biokartoffeln, es gibt welche, an denen noch Erde klebt, und sehr saubere andere, gewaschen, gebürstet und geschrubbt, die in ihren Kilonetzen aussehen, als wären sie eben erst aus dem Meer gefischt und nicht aus dem Boden gegraben worden. Ich kann mich nicht entscheiden. Brauche ich überhaupt Kartoffeln? Ich kaufe heute keine.[*]
5
Ich bin im Paradies. Ich sehe rote, gelbe und grüne Äpfel, blaue, grüne und weiße Trauben, Mangos, Feigen, Melonen und Orangen. Ich sehe Bananen und Biobananen, Zitronen und unbehandelte Zitronen, Biogurken und ganz gewöhnliche, wahrscheinlich pestizidbelastete Gurken, ich sehe kandierte und getrocknete Früchte, aufgeschnittene, auf Styroporträgern arrangierte und mit Klarsichtfolie überzogene Ananas, ich sehe Obstsalate in transparenten Plastikbechern und kühlgestellte, frischgepreßte Säfte, ich sehe Salate mit Käse oder Putenfleisch, denen kleine, manchmal leicht, manchmal weniger leicht aufzureißende Vinaigrette-Päckchen beigegeben sind, ich sehe Blätterteigpasteten, Fleischterrinen, Forellen, Hummer, Hammelkeulen, Wachteln, Wildschweine und Käseräder, ich bin im Schlaraffenland, alles ist da. So viel zu essen, und ich habe gar keinen Hunger, so viel zu trinken, und ich habe gar keinen Durst.
6
Mein Einkaufswagen ist ein EL 240. Er ist siebenundzwanzig Kilogramm schwer, hundertzehn Zentimeter lang und sechzig Zentimeter breit, er hat vier selbstlenkende Rollen mit jeweils zwölfeinhalb Zentimetern Durchmesser und ein Fassungsvermögen von zweihundertachtunddreißig Litern. Könnte ich Milchtüten entsprechend stapeln, ließen sich in ihm zweihundertachtunddreißig davon unterbringen.[*] Ich schiebe den Wagen und schiebe mich hinterher; nicht zum Vergnügen, sondern zum Einkaufen bin ich hier, und für einen Moment bilde ich mir ein, mich daran erinnern zu können, wie es war, als ich im Kinderwagen lag und so geschoben wurde, wie ich jetzt diesen Einkaufswagen schiebe. Vielleicht aber ist es auch nur eine Ahnung vom Alter und ein Vorgeschmack auf den Rollator, auf den ich mich eines Tages gebeugt werde stützen müssen. Eigentlich bräuchte ich gar keinen Einkaufswagen. Die paar Sachen, die ich mitnehme, könnte ich auch in einem Korb zur Kasse tragen. Ich könnte auch einen der neueren Fahrkörbe mit Teleskopgriff benutzen, die sich wie Trolleyköfferchen ziehen lassen, aber ich nehme, auch wenn ich ihn nie fülle, ja kaum seinen Gitterboden bedecke, lieber einen Wagen. Einmal habe ich geträumt, mit meinem Einkaufswagen gegen einen anderen Einkaufswagen zu stoßen, in dem genau die gleichen Lebensmittel liegen wie in meinem. Die gleiche Sorte Butter, der gleiche Orangensaft, Mineralwasser des gleichen Abfüllers und noch ein paar andere identische Produkte mehr. In diesem Traum, ich habe ihn schon ein paarmal geträumt, wird dieser andere Einkaufswagen von einer selbstverständlich aufregend wunderschönen Frau geschoben, in die ich mich, ich kann gar nichts dagegen tun, sofort verliebe, und ihr geht es genauso, wir beide wissen sofort, wir sind füreinander bestimmt, aber als ob wir unser gemeinsames Schicksal noch abwenden könnten, weichen wir beide zur selben Seite aus, blockieren uns erst links, dann rechts, und denken beide für kurze Zeit, daß wir vielleicht vor einem Spiegel stehen – aber nein, wir sind zwei Individuen und bräuchten von nun an eigentlich nur noch einen Einkaufswagen. So ging der Traum, tatsächlich aber habe ich noch nie jemanden im Supermarkt kennengelernt. Ich habe Bekannte getroffen, ja vielleicht ist mir auch mal die Begleitung eines Bekannten oder der Freund einer Freundin vorgestellt worden, noch nie aber habe ich jemanden einfach so kennengelernt.
7
Ich nehme den Gang, der parallel zu dem mit den Teigwaren verläuft, und betrachte ein schmales Marmeladenglas, an dessen Außenseite ein Konfitürenlöffel klebt. Ich überlege einen Augenblick, ob ich die Marmelade kaufen soll, immerhin bekäme ich ja einen Löffel dazu, lasse mich dann aber doch nicht verführen, sondern schiebe mich und meinen Wagen weiter bis zu den langen, offenen Tiefkühltruhen, über denen, wie überall hier, weißes Neonlicht leuchtet. Mit ihren gläsernen Seitenwänden sehen sie, das ist mir bisher nie aufgefallen, wie sehr in die Länge gezogene Schneewittchensärge aus. Es gibt Pizza Salami, Pizza Hawaii, Pizza Prosciutto, Pizza mit Spinat und Mozzarella und Pizza Hähnchenfleisch, daneben Pizza Vier Jahreszeiten, Steinofenpizza und Pizza im Doppel- oder Dreierpack. Die Kartonquadrate, ich zähle fünf verschiedene Hersteller und unübersichtlich viele Sorten, sind, geht mir durch den Sinn, Teil eines großen Mosaiks, das ich nur deshalb nicht erkennen kann, weil ich viel zu dicht davorstehe. Ich glaube, ich habe sie schon alle, Pizza Hähnchenfleisch ausgenommen, probiert. In den ersten Wochen nach L.s Auszug bin ich jeden Tag in den Supermarkt gegangen und habe mir, ich vermute, ich wollte mich bestrafen, Tiefkühlpizza gekauft. Das ging drei Wochen oder drei Monate so, ich weiß es nicht mehr genau, erst als es anfing, mir besserzugehen, bemerkte ich, daß Tiefkühlpizza gar nicht schmeckt. Eine Tiefkühlpizza ist, wie liebevoll ihr Karton auch aufgerissen, wie vorsichtig die Aromaschutzfolie auch entfernt und auf welcher Stufe der vorgebackene Rohling auch in den Ofen geschoben wird, ich kann mir nicht helfen, ein tieftrauriges Produkt. Das wurde mir klar, als ich einmal ein Photo sah, das fünf Frauen mit blaßblauen Plastikhandschuhen und ebenso blaßblauen Haarnetzen zeigte, die in einer Fabrik damit beschäftigt waren, jeweils sieben Salamischeiben auf mit Tomatensoße bestrichene Pizzarohlinge zu legen. Die Wurstscheiben, auf dem Photo fleischfarbene Kreise, ordneten sie zu Salamiblumen, Blumen, wie sie in Kindergärten gemalt werden – eine Scheibe in der Mitte, sechs als Blütenblätter drum herum. Ich hatte Mitleid mit diesen fünf Frauen, die, das wollte ich mir gar nicht vorstellen, vielleicht schon seit Jahren jeden Tag Salamiblumen auf Teigrohlinge legten. Die Schneewittchensärge, in denen die traurigen Tiefkühlpizzen liegen, werden nach Geschäftsschluß jedenfalls zugedeckt, als ob die Pizzen sonst nachts frieren könnten.
8
Eine Frau, die mich, ohne daß ich mir große Mühe geben müßte, an L. erinnert, kommt in den Marmeladengang und biegt, sie schiebt ihren Einkaufswagen an mir vorbei, gleich wieder um die Ecke. Ich sehe ihr hinterher und frage mich, warum L. mir immer noch und immer wieder erscheint, als Wiedergängerin und Supermarktgespenst – sie hat doch, als ließe sich das auf diese Art erledigen, mir oft genug gesagt: Hör bitte auf, mich zu lieben, ich liebe jetzt einen anderen. Und obwohl das schon ein oder zwei Jahre her ist, denke ich immer wieder, L. müßte hier jeden Augenblick, einen Einkaufswagen schiebend, um die Ecke biegen. Dabei geht sie gar nicht mehr in diesen Supermarkt.
9
Die Tiefkühltorten, über die ich mich nun beuge, sehen auf ihrer Verpackung immer köstlich aus. Einmal brachten sie mich auf den Gedanken, mir eine tiefgefrorene Schwarzwälder Kirschtorte zu kaufen und einen Sonntagnachmittagskaffee nachzustellen, wie es ihn, das muß vor Äonen gewesen sein, bei Oma und Opa gegeben hatte, mit Papierservietten, die auf den Tellern des guten Geschirrs zu Schmetterlingen gefaltet waren und zwischen den Zinken der silbernen Kuchengabeln steckten, mit einer Porzellankaffeekanne, die eine Wärmehaube trug, und weißen Spitzendeckchen unter den Tassen und mit einer Zuckerdose, in der ein silberner Motivlöffel stand, und natürlich gab es einen großen Berg Sahne, den meine Großmutter nach dem Schlagen in eine Schüssel aus geschliffenem Kristall gefüllt hatte – Sonntagnachmittage in unendlich weiter Ferne. Ich erinnere mich an sie nur, wenn ich Tiefkühltorten sehe, die ich gar nicht mag, weil sie nie echt, sondern bloß aufgetaut schmecken, aber das sollte einer Tiefkühltorte eigentlich nicht zum Vorwurf gemacht werden, eine Tiefkühltorte ist eben eine Tiefkühltorte und nicht mit einer zu vergleichen, die aus der Kuchenvitrine einer Konditorei stammt oder von einer Großmutter nach überliefertem Rezept selbst gebacken wurde.
10
Als L. noch mit mir redete, hat sie mich einmal darauf aufmerksam gemacht, wie viele Lebensmittel Parallelexistenzen in verschiedenen Aggregatzuständen führen, Torten und Tiefkühltorten sind nur ein Beispiel, es gibt auch Brötchen vom Bäcker und tiefgefrorene Aufbackbrötchen, Pizzen und Tiefkühlpizzen, Erbsen in Dosen und Tiefkühlerbsen und, fast vergessen, weil so unpraktisch, getrocknete Erbsen zum Einweichen vor dem Kochen, meine Großmutter hatte die in großen Gläsern in ihrer Speisekammer stehen. Dem Spinat ist das Tiefgefrorensein zum Hauptaggregatzustand geworden, nur wenn ich mich anstrenge, finde ich vielleicht frischen Blattspinat, vorne, in der Gemüseabteilung, trotzdem, Spinat bleibt für mich das ziegelsteinharte, grüne, mit weißlich schimmernden Eiskristallen durchsetzte Zeug, das sich erhitzt in einem Topf langsam verflüssigt. Spinett? Spinoza? Spinat? Das Wort klingt in meinen Ohren noch heute so, als ob es für ein neuentwickeltes, gentechnisch manipuliertes Nahrungsmittel erfunden worden wäre, dessen genaue Zusammensetzung niemand kennt. Spinat, hieß es immer, sei sehr gesund, denn es enthalte viel Eisen, wie aber sollte Eisen, ich sah davon ja nichts, in dieses Grünzeug kommen? Spinat, so vermutete ich als Kind, ist wahrscheinlich gar kein Gemüse, denn es kommt aus keinem Garten, sondern wird, deshalb ist es schließlich tiefgefroren, in einer Fabrik produziert – woraus, wollte ich nicht genau wissen. Es mußte etwas sein wie Soylent Green, und Soylent Green ist Menschenfleisch, erfuhr ich, Jahre später, aus dem gleichnamigen Film, in dem die harte, grüne, allerdings trockene Masse das Hauptnahrungsmittel der Menschen dieser Zukunftsvision ist und in einer streng geheimen Hochsicherheitsfabrik hergestellt wird. Spinat – das Wort, das wegen der beiden langen Vokale fremd klingt, stammt aus dem Persischen und die Pflanze selbst aus Persien – muß es früher, vor der Verbreitung von Tiefkühltruhen, auch in anderen Aggregatzuständen gegeben haben. Ursprünglich kam er, das weiß ich aus den Popeye-Comics der Apothekenheftchen, aus der Dose, aber ich selbst habe ihn, der in meiner Kindheit fast immer zusammen mit Fischstäbchen auf den Teller kam, nie in Dosen gesehen. Fischstäbchen mit Spinat und Kartoffelpüree war ein Kindergericht, das zwei Tiefkühlprodukte und ein Tütengericht zusammenbrachte. Dreimal eine Kartonverpackung aufreißen und einmal eine Tüte – die, in der die Kartoffelpüreeflocken steckten –, das Gefrorene antauen lassen, erwärmen, anbraten, die Flocken einrühren, die Fischstäbchen vor dem Verzehr vielleicht noch mit Zitronensaft aus der Plastikzitrone bespritzen. Wahrscheinlich war die angedunkelte, teils schwarze Panade schon in der Pfanne abgefallen, als hätte sich der Fisch, der als Fisch doch gar nicht zu erkennen war, aus seiner panierten Haut gepellt. Im Mund hatte ich dann zwei Konsistenzen, die dünne, rauhe, entweder noch harte oder bereits fettdurchsogene und daher weiche Panade, die offenbar bloß dazu da ist, den Fisch zu verbergen, sowie den Fisch selbst, anfangs noch kantig, dann zerfallend in seine Fasern. Fischstäbchen, ich sehe sie nun hier in Packungen zu fünf, zehn, dreizehn und fünfzehn Stück,[*] haben keine Schuppen, keine Flossen und keinen Schwanz, sie haben, meistens jedenfalls, auch keine Gräten, riechen nicht einmal nach Fisch und haben auch keine Augen, was mir als Kind erleichterte, sie zu essen, denn ich konnte nicht essen, was Augen hatte und mich ansah.[*] Schon damals wußte ich, daß Fischstäbchen in England fishfingers heißen, weshalb ich zuerst vermutete, die ab- und glattgehobelten Finger sehr großer Fische zu essen, weil ich aber inzwischen aus Bilderbüchern gelernt hatte, daß Fische keine Finger haben, mußten Fischstäbchen doch anderswo herkommen. Ich stellte mir also vor, daß Fischstäbchen hoch oben im Norden geerntet würden, ich dachte an eine Stäbchenstecherei am Eismeer, in der die weiße, tiefgefrorene Masse wie Torf im Moor gestochen und dann paniert wird, und es kam vor, daß ich im Sommer am Strand darauf wartete, daß die Wellen das eine oder andere an einem kleinen Eisberg klebende Fischstäbchen anspülten, angespült aber wurden nur ausgedrückte Sonnencremetuben, in der Brandung rundgeschliffene Glasscherben und leere Waschmittelkanister, die niemals Schatzkarten enthielten.
11
Schon friere ich. Neben den Fischstäbchen, die statt wie Stäbchen wie längliche Bauklötze aussehen, liegen in der Tiefkühltruhe weißgefrorene Hühner, Enten und polnische Gänse. Die Krabben in den Tüten sehen aus wie Insekten, und das Tiefkühlgemüse steckt, es muß wohl so sein, in Kartons, die in Grüntönen gehalten sind, die Verpackungen der Tiefkühlbeeren hingegen leuchten in verschiedenen Abstufungen rot. L. hat mir einmal, aber das ist lange her, gesagt, wenn Küsse eine Farbe hätten, müßten sie die Farbe von Himbeeren haben. Sie meinte auch, daß es Erdbeerküsse gebe und solche, die nach Himbeere schmeckten. Ich konnte darauf nur erwidern, daß jeder Kuß auf ihren Lippen ein klein wenig anders schmecke, aber das sei bei den wilden Himbeeren, die man im Wald pflücke, ja auch so. Und ich fügte hinzu, daß im Mund jede Himbeere die Erinnerung an den Geschmack der davor auslösche, und genauso lasse jeder ihrer Küsse den vorhergehenden vergessen. Küsse aber, denke ich jetzt, lassen sich nicht einfrieren, das unterscheidet sie von Himbeeren.[*]
12
Die vier Äpfel in der Tüte und die beiden Zitronen rollen auf dem Bodengitter des Einkaufswagens hin und her, was mich daran erinnert, daß die Äpfel im Haus meiner Großmutter im Apfelkeller lagerten, einem Raum mit vielen Regalen, auf deren Brettern die Äpfel einzeln, jeder für sich – sie durften einander nicht berühren, weil ein Wurm sonst von einem in den nächsten hätte kriechen können – auf ihre Verarbeitung warteten. Sie hielten sich den Winter hindurch, bis schließlich, kurz vor Ostern, nur noch die kleinsten, immer schrumpeliger gewordenen Exemplare auf den Apfelregalbrettern lagen, weil meine Großmutter mich immer wieder hinunter in den Keller geschickt hatte, um fünf oder sechs große Äpfel zu holen, aus denen sie Bratäpfel, Apfelpfannkuchen, Apfelkuchen oder Kompott mit Nelken zubereitete. Frischgekochtes Apfelkompott stand oft zum Abkühlen auf dem Fensterbrett, zwei Schüsseln aus Glas nebeneinander. Zu dem Kompott gab es meist Reibekuchen, knusprige, in heißem Sonnenblumenöl ausgebackene Kartoffelpuffer, die meine Großmutter natürlich nicht tiefgefroren, vorgeformt und vorgebraten aus einer Pappverpackung nahm, sondern aus einem Teig briet, für den sie rohe Kartoffeln selbst gerieben hatte. Nach diesem Essen roch es immer eine Weile nach Fett, ein Geruch, der, wenn ich zu lange in der Küche gesessen hatte, dann auch in meinen Kleidern hing.
13
Vor dem Kühlregal steht eine Angestellte in einem weißen, mit roten und grünen Bordüren abgesetzten Kittel und gut eingelaufenen, fast schon ausgelatschten, früher vielleicht reinweiß gewesenen Turnschuhen und sortiert Milchkartons und Trinkjoghurts. Meine Mutter, daran muß ich nun denken, hat mich als Kind hin und wieder Milch holen geschickt. Leider ging es, auch wenn ich mich gern an eine solche Idylle erinnern würde, dabei nicht über Wiesen und Felder, sondern über Verbundsteinpflaster und frischasphaltierte Straßen eines Neubaugebiets zu einem Bauernhof, der neben einem großen, mit buschigen Friedhofsträuchern und anderem dornigen Ziergestrüpp bepflanzten Besucherparkplatz der Landesnervenklinik stand. Eigentlich müßte es wohl heißen, daß neben dem Bauernhof ein großer Parkplatz lag, denn der Bauernhof war ja vor dem Parkplatz und dem Neubaugebiet dagewesen. Allerdings empfand ich es als unangebracht, beinahe demütigend, mit zwei leeren Milchkannen – eine war aus roter Emaille, die andere, kleinere aus einem halbtransparenten Kunststoff mit gelbem Deckel – zu einem Bauernhof gehen zu müssen, der sich mitten in einem Neubaugebiet befand und überhaupt nicht zu den BMWs und Golf Cabriolets paßte, die in den Einfahrten der mit Zierklinker verkleideten Eigenheime parkten. Auf dem Hof stank es nach Gülle, und ich haßte den Hund, der immer an seiner Kette zerrte, laut bellte und jaulte, wenn ich an ihm vorüberging, und ich mochte auch die Kühe nicht, die im Stall brüllten, anstatt ein sanftes, zufriedenes Muhen hören zu lassen. Diese immer eingesperrten Kühe, da war ich mir sicher, mußten unglückliche Kühe sein, und ich konnte auch die Bäuerin nicht leiden, eine mißmutig, leicht verschlagen wirkende Person, die mir die Milch aus einem riesigen Bottich, in dem sie gleich mehrere Kinder hätte ertränken können, in die Kannen schöpfte. Sie schöpfte mit großer Kelle, erst in die rote Emaillekanne, in die zwei Liter paßten, dann in die kleinere aus Plastik, die ich lieber mochte, eben weil sie aus Plastik war. In dem Raum mit dem riesigen Bottich roch es nach saurer Milch, und wie überall auf dem Bauernhof gab es Fliegen, die sich auch von einem Fliegenvorhang, der ihren Facettenaugen vortäuschen sollte, an seiner Stelle befände sich ein Wasserfall, nicht davon abhalten ließen, zur Milch zu wollen, die in einem offenen Kessel gerührt wurde. Lieber wäre ich in ein Geschäft gegangen und hätte Tütenmilch gekauft, ich hatte kein Bedürfnis nach frischer Kuhmilch und der Haut, die sich beim Erwärmen auf ihr bildete, außerdem wußte ich schon damals, daß es in unserem Europa viel zu viele Kühe, einen Milchsee und einen Butterberg gab und dieser Bauernhof demzufolge gar nicht mehr nötig gewesen wäre, zumindest nicht hier, im Neubaugebiet, neben dem Parkplatz der Landesnervenklinik. Nicht einmal den konnten die Kühe aus ihrem Stall sehen, sie verließen ihn nur, wenn sie in den Schlachthof gefahren wurden. Eines Tages bin ich dann einfach nicht mehr zum Bauernhof, sondern in die entgegengesetzte Richtung, zum Supermarkt, gegangen und habe dort Vollmilch im Tetrapack gekauft und draußen auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt in die Kannen umgegossen, die leeren Milchkartons warf ich hinter ein Auto. Ein paarmal machte ich das so, dann fand auch meine Mutter, daß die Kuhmilch vom Hof sich kaum mehr von der Milch aus der Kühltheke unterschied. Bald brachte sie die Milch aus dem Supermarkt selber mit.
14
In dem Kühlregal, das die Supermarktfee in ihrem weiß-grün-roten Umhang aufgefüllt hat, steht aus verschiedenen Molkereien stammende Vollmilch mit eineinhalb und dreieinhalb Prozent Fett, es gibt Biomilch im Tetrapack und in braunen Pfandflaschen aus Glas sowie in eckigen Flaschen aus blauem Kunststoff, die wie Blumenvasen aussehen. Neben dem Kühlbereich steht die H-Milch, Haarmilch